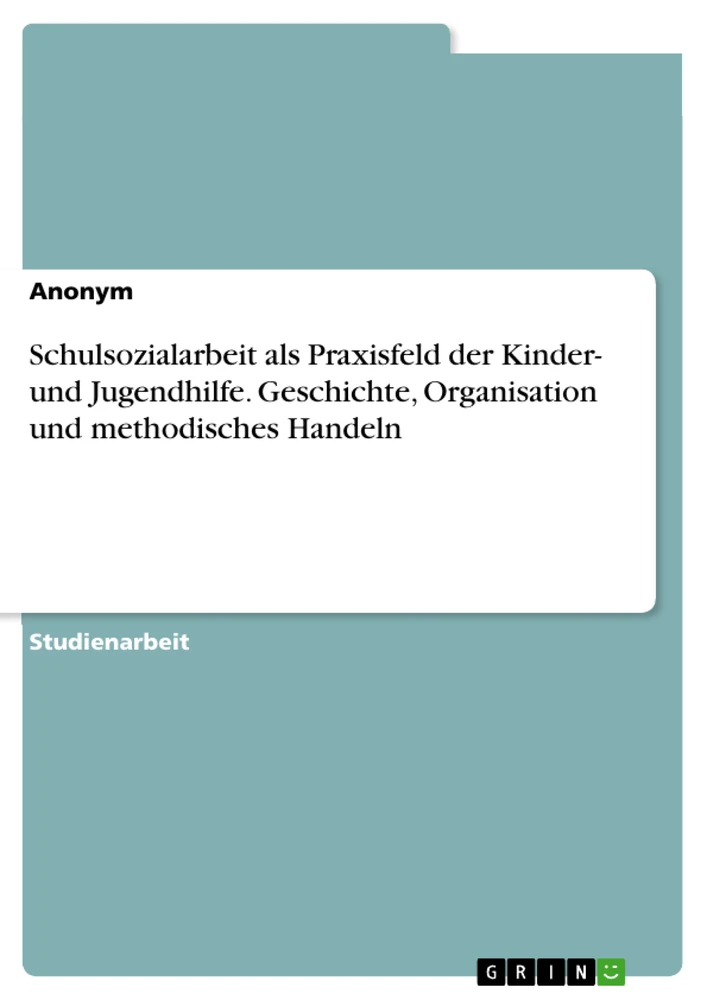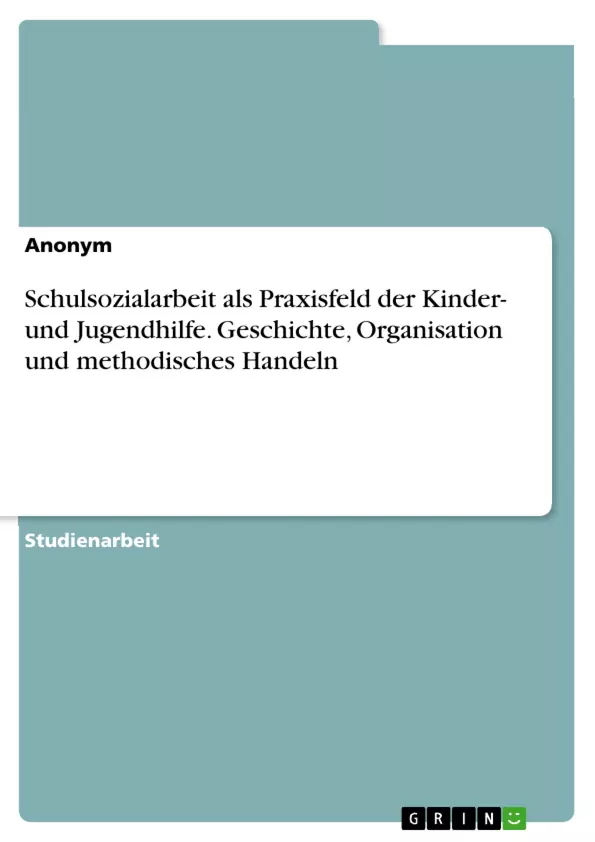Die wissenschaftliche Arbeit behandelt das Handlungsfeld der Schulsozialarbeit (SSA), welches einen Teilbereich des Arbeitsfeldes der Kinder- und Jugendhilfe darstellt. Die Fragestellung beschäftigt sich damit, welche Herausforderungen sich in der Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen beziehungsweise der Stadt Dortmund aufgrund verschiedener Trägerschaften sowie fehlender rechtlicher Grundlagen ergeben.
Die Institution Schule des deutschen Bildungssystems ist ein Reproduzent sozialer Ungleichheiten. Spätestens die Ergebnisse der Vergleichsstudie PISA verdeutlichen, dass der Schulerfolg von Schüler*innen stark von der sozialen Herkunft abhängig ist. Um leistungsbezogenen Selektionsmechanismen des Schulsystems und damit verbundene Folgen zu analysieren und auf-arbeiten zu können, ist eine Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule von großer Bedeutung. Die Schulsozialarbeit dient als Kompensator dieser Ungleichheiten und zielt darauf ab, alle Kinder und Jugendliche im Lebensbereich der Schule zu erreichen.
Der erste Abschnitt dieser Arbeit thematisiert die historische Entwicklung der Profession, indem die Entstehung der Kinder- und Jugendhilfe sowie die Verbindung zur Schule er-läutert wird. Des Weiteren findet eine Annäherung an den Begriff der Schulsozialarbeit und den verschiedenen Definitionen der SSA statt, um zu veranschaulichen, wie sich das Verständnis der SSA im Laufe der Zeit durch neue Forschungsergebnisse, dem gesellschaftlichen Wandel und neue Zielsetzungen verändert hat.
Der zweite Abschnitt beinhaltet die Einordnung der SSA in die Rechtsgrundlage, um zu überprüfen, ob das Sozialgesetzbuch VIII (SGB Vlll) als eine Handlungsgrundlage dienen kann. Darüber hinaus werden sowohl die Trägerstrukturen, die Finanzierung und das Begründungsmuster dargestellt als auch die Zielgruppe und die Zielsetzung der SSA.
Im dritten Abschnitt erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem methodischen Handeln von Fachkräften in der SSA. Hierbei wird zunächst das methodische Handeln definiert, anschließend werden Grundsätze und Handlungsprinzipien erläutert und eine Auswahl von drei Basismethoden fokussiert. Das Fazit ergibt sich aus einer zusammenfassenden Betrachtung der wichtigsten Ergebnisse dieser Hausarbeit sowie einem Ausblick für zukünftig mögliche und notwendige Handlungsansätze in der SSA.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Historische Entwicklung und Begriffsdefinition der Schulsozialarbeit
- 1.1 Historische Entwicklung
- 1.2 Begriffserklärung und Definitionsproblematik
- 2. Organisation der Schulsozialarbeit
- 2.1 Zielgruppe und Zielsetzung
- 2.2 Rechtlicher Rahmen
- 2.3 Trägerstrukturen / Finanzierung
- 2.4 Begründungsmuster
- 3. Methodisches Handeln in der Schulsozialarbeit
- 3.1 Definition
- 3.2 Grundsätze und Handlungsprinzipien
- 3.3 Einzelfallhilfe
- 3.4 Gruppenarbeit
- 3.5 Gemeinwesenarbeit bzw. innerschulische und außerschulische Vernetzung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Schulsozialarbeit (SSA) in Nordrhein-Westfalen, insbesondere in Dortmund, und analysiert die Herausforderungen aufgrund unterschiedlicher Trägerschaften und fehlender rechtlicher Grundlagen. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der SSA als Kompensationsinstrument für soziale Ungleichheiten im Bildungssystem.
- Historische Entwicklung der Schulsozialarbeit
- Organisation und rechtliche Rahmenbedingungen der SSA
- Methodisches Handeln in der SSA
- Herausforderungen durch unterschiedliche Trägerschaften und fehlende rechtliche Grundlagen
- SSA als Kompensationsinstrument für soziale Ungleichheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Schulsozialarbeit (SSA) ein und benennt die zentrale Fragestellung: welche Herausforderungen ergeben sich in der SSA in Nordrhein-Westfalen/Dortmund aufgrund unterschiedlicher Trägerschaften und fehlender rechtlicher Grundlagen? Sie betont die Rolle der Schule als Reproduzent sozialer Ungleichheiten und die Bedeutung der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule zur Förderung von Bildungs- und Lebenskompetenzen. Die SSA wird als Kompensationsinstrument für diese Ungleichheiten positioniert, mit dem Ziel, alle Kinder und Jugendlichen im schulischen Lebensbereich zu erreichen. Die Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte: historische Entwicklung und Begriffsdefinition, Organisation der SSA, und methodisches Handeln.
1. Historische Entwicklung und Begriffsdefinition der Schulsozialarbeit: Dieses Kapitel skizziert die historische Entwicklung der SSA, beginnend mit frühen Bestrebungen zur allgemeinen Schulpflicht und den Herausforderungen der Industrialisierung. Es beschreibt die Entstehung von Industriebetriebsschulen und die Einführung der Schulkinderfürsorge. Die Entwicklung wird weiter verfolgt über die Unterordnung der Jugendhilfe unter die Schule im Jahre 1924 bis zur Renaissance der SSA in den 1970er Jahren im Kontext von Bildungsreformzielen und der Einführung der Gesamtschule. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Definitionen von SSA und deren Wandel im Laufe der Zeit aufgrund neuer Forschungsergebnisse, gesellschaftlicher Veränderungen und neuer Zielsetzungen, und betont die fehlende allgemeingültige Definition aufgrund der Vielfältigkeit und Abhängigkeit von Rahmenbedingungen.
2. Organisation der Schulsozialarbeit: Der zweite Abschnitt befasst sich mit der Organisation der SSA. Er untersucht den rechtlichen Rahmen, indem er überprüft, ob das Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) als Handlungsgrundlage dienen kann. Weiterhin werden die Trägerstrukturen, die Finanzierung, das Begründungsmuster, die Zielgruppe und die Zielsetzung der SSA detailliert dargestellt. Diese Aspekte geben einen umfassenden Einblick in die organisatorischen Strukturen und Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit und ihren Einfluss auf die praktische Arbeit.
3. Methodisches Handeln in der Schulsozialarbeit: Das Kapitel widmet sich dem methodischen Handeln von Fachkräften in der SSA. Es beginnt mit einer Definition des methodischen Handelns und erläutert anschließend Grundsätze und Handlungsprinzipien. Der Fokus liegt auf drei ausgewählten Basismethoden (Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit/Vernetzung), die detailliert beschrieben und in ihren Anwendungsmöglichkeiten und Bedeutungen für die SSA erläutert werden. Die Kapitelzusammenfassung fasst die Bedeutung der methodischen Ansätze für eine effektive Schulsozialarbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendhilfe, soziale Ungleichheit, Bildung, Integration, methodisches Handeln, Rechtlicher Rahmen, Trägerschaft, Finanzierung, Nordrhein-Westfalen, Dortmund.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen/Dortmund
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Schulsozialarbeit (SSA) in Nordrhein-Westfalen, insbesondere in Dortmund. Sie analysiert die Herausforderungen aufgrund unterschiedlicher Trägerschaften und fehlender rechtlicher Grundlagen und beleuchtet die Rolle der SSA als Kompensationsinstrument für soziale Ungleichheiten im Bildungssystem. Der Inhalt umfasst eine historische Entwicklung der SSA, die Organisation und rechtlichen Rahmenbedingungen, das methodische Handeln, und die Herausforderungen durch unterschiedliche Trägerschaften und fehlende rechtliche Grundlagen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die historische Entwicklung der Schulsozialarbeit, die Organisation und rechtlichen Rahmenbedingungen der SSA, das methodische Handeln in der SSA, die Herausforderungen durch unterschiedliche Trägerschaften und fehlende rechtliche Grundlagen, und die SSA als Kompensationsinstrument für soziale Ungleichheiten.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung, Historische Entwicklung und Begriffsdefinition der Schulsozialarbeit, Organisation der Schulsozialarbeit, Methodisches Handeln in der Schulsozialarbeit, und Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeschlüsselt.
Wie wird die historische Entwicklung der Schulsozialarbeit dargestellt?
Das Kapitel zur historischen Entwicklung beschreibt die Entstehung der SSA von frühen Bestrebungen zur allgemeinen Schulpflicht über die Industriebetriebsschulen und die Schulkinderfürsorge bis zur Renaissance in den 1970er Jahren. Es analysiert den Wandel der Definitionen von SSA im Laufe der Zeit und die fehlende allgemeingültige Definition aufgrund der Vielfältigkeit und Abhängigkeit von Rahmenbedingungen.
Wie wird die Organisation der Schulsozialarbeit beschrieben?
Der Abschnitt zur Organisation der SSA untersucht den rechtlichen Rahmen (u.a. SGB VIII), die Trägerstrukturen, die Finanzierung, das Begründungsmuster, die Zielgruppe und die Zielsetzung. Es wird ein umfassender Einblick in die organisatorischen Strukturen und Rahmenbedingungen gegeben.
Wie wird das methodische Handeln in der Schulsozialarbeit dargestellt?
Das Kapitel zum methodischen Handeln definiert dieses und erläutert Grundsätze und Handlungsprinzipien. Es fokussiert auf Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit/Vernetzung, beschreibt deren Anwendung und Bedeutung für die SSA.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendhilfe, soziale Ungleichheit, Bildung, Integration, methodisches Handeln, Rechtlicher Rahmen, Trägerschaft, Finanzierung, Nordrhein-Westfalen, Dortmund.
Welche zentrale Fragestellung wird in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Fragestellung lautet: Welche Herausforderungen ergeben sich in der SSA in Nordrhein-Westfalen/Dortmund aufgrund unterschiedlicher Trägerschaften und fehlender rechtlicher Grundlagen?
Welche Rolle spielt die Schulsozialarbeit im Kontext sozialer Ungleichheiten?
Die Arbeit positioniert die SSA als Kompensationsinstrument für soziale Ungleichheiten im Bildungssystem, mit dem Ziel, alle Kinder und Jugendlichen im schulischen Lebensbereich zu erreichen. Die Schule wird als Reproduzent sozialer Ungleichheiten betrachtet, und die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule zur Förderung von Bildungs- und Lebenskompetenzen wird hervorgehoben.
Gibt es einen Ausblick in der Arbeit?
Die Arbeit enthält ein Fazit und einen Ausblick, der jedoch im bereitgestellten Textfragment nicht detailliert beschrieben ist.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Schulsozialarbeit als Praxisfeld der Kinder- und Jugendhilfe. Geschichte, Organisation und methodisches Handeln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1284750