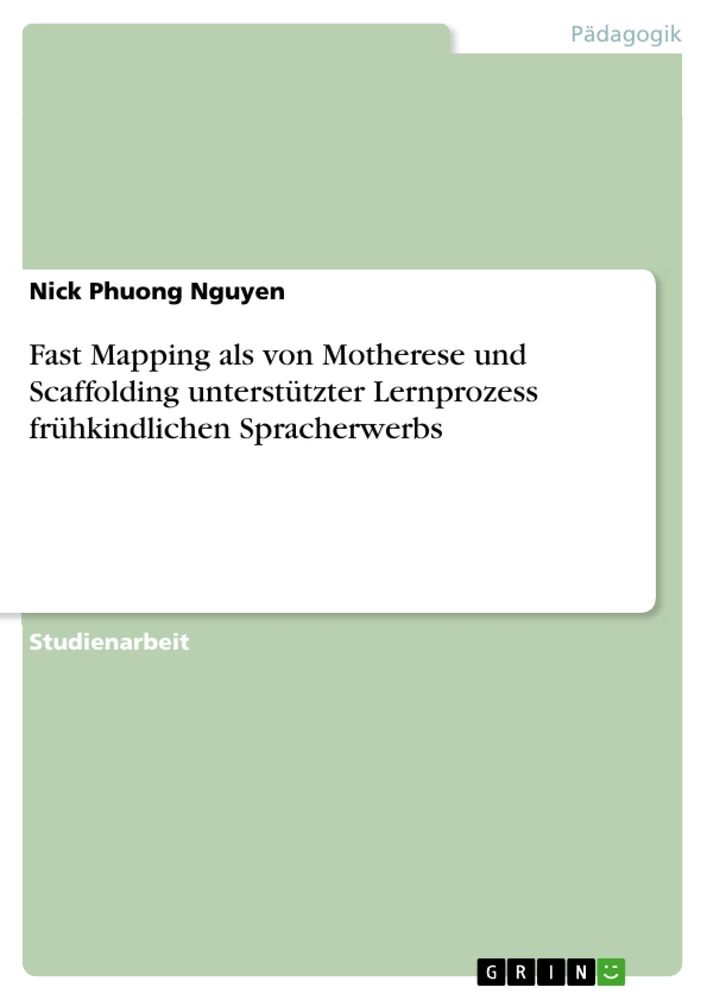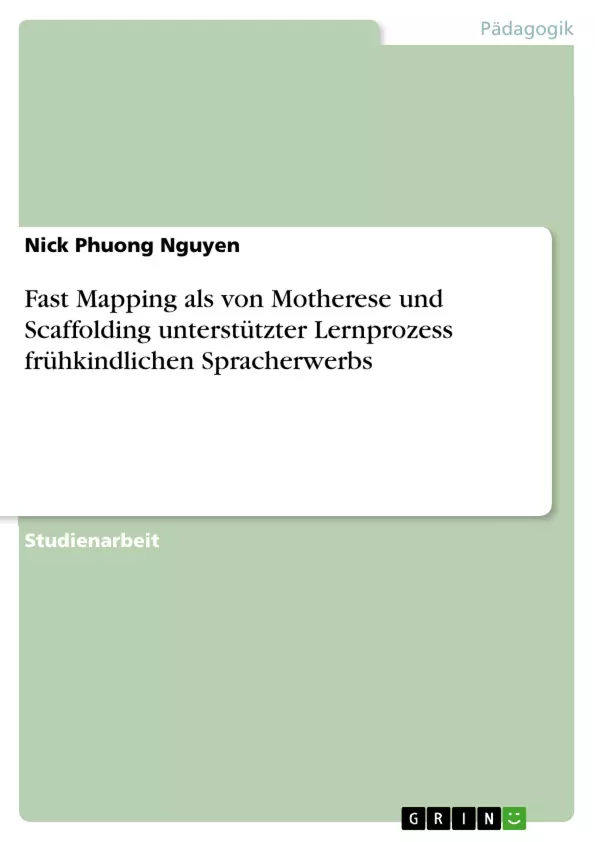Im Rahmen dieser Arbeit wird das Fast Mapping als von Motherese und Scaffolding unterstützter Sprachlernprozess eingehend beleuchtet. Durch die zwei benannten mütterlichen bzw. elterlichen Sprechstile der Motherese und des Scaffolding kann das Kind mit Einsetzen des Wortschatzspurtes signifikant in seiner Sprachentwicklung gefördert werden.
In diesem Sinne braucht das Kind mit Ende des zweiten Lebensjahres, in dem der Wortschatzspurt einsetzt, Erwachsene, aber auch ältere Kinder, die ihm bei seinem Wortschatzerwerb sozial-interaktiv unterstützen. Dies geschieht zum Beispiel durch kindgerechte Intonation, Wiederholung des Gesagtem, langsames Sprechen und Sprechpausen.
Zu Beginn der Arbeit erfolgt eine theoretische Zuordnung des Fast Mappings, indem wichtige Aspekte des frühkindlichen Spracherwerbs aufgezeigt werden und die Auseinandersetzung der damit verbundenen Grammatikentwicklung des Kindes, die die Anfänge des kindlichen Wortschatzspurtes voraussetzt.
Im Kern wird sich mit dem Fast Mapping als Wortlernmechanismus beschäftigt, der in bedeutendem Maße von der Motherese und dem Scaffolding als "lehrende Sprachen" begünstigt werden kann. Hierzu wird im Besonderen die Rolle und die unterstützenden Funktionen der Motherese hinsichtlich des Fast Mappings herausgestellt. Zusätzlich spielen die sprachförderlichen Dialogroutinen des Scaffoldings als unterstützendes "Baugerüst" in den Wortschatzerwerb mit ein.
Abgerundet wird die Arbeit mit einem zusammenfassenden Resümee mit Blick auf den alltagspraktischen Umgang der beleuchteten sprachlichen Varietäten. Dies kann zusammen mit den Ergebnissen aus der Arbeit im Zuge einer Unterstützung der kindlichen Wortschatzerweiterung durch pädagogische Fachkräfte als kompakte, aber nützliche Handreichung gesehen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Frühkindliche Spracherwerb
- Die pragmatische Sprachentwicklung
- Wortschatzerwerb bei Kindern
- Die Anfänge des kindlichen Wortschatzspurts
- Fast Mapping - Übergang vom langsamen Wortlernen zum Wortschatzspurt
- Wortäußerungen und ihre linguistischen Informationen
- Das mentale Lexikon
- Fast Mapping als von Motherese und Scaffolding unterstützter Sprachlernprozess
- Die Rolle der Motherese im frühkindlichen Spracherwerb
- Einführung in die Charakteristik der Motherese
- Unterstützende Funktionen der Motherese für das Fast Mapping
- Scaffolding als stützende Sprache
- Sprachförderliche Dialogroutinen des Scaffoldings
- Scaffolding als unterstützendes „Baugerüst“ im Wortschatzerwerb
- Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Prozess des Fast Mappings im frühkindlichen Spracherwerb und beleuchtet die Rolle von Motherese und Scaffolding als unterstützende Faktoren. Das Hauptziel ist es, das Fast Mapping zu erörtern und seine Beziehung zu den genannten elterlichen Sprechweisen aufzuzeigen.
- Der frühkindliche Spracherwerb und seine Entwicklungsphasen
- Das Fast Mapping als beschleunigter Wortschatzerwerbsprozess
- Die Bedeutung von Motherese für den Spracherwerb
- Scaffolding als unterstützende Lernstrategie
- Zusammenhang zwischen Fast Mapping, Motherese und Scaffolding
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des frühkindlichen Spracherwerbs und des Fast Mappings ein. Sie beschreibt den Spracherwerb als interaktiven Prozess zwischen angeborenen Fähigkeiten und Umwelteinflüssen und definiert Fast Mapping als beschleunigten Wortschatzerwerb. Die Arbeit fokussiert auf die Rolle von Motherese und Scaffolding als unterstützende Faktoren im Fast Mapping Prozess und kündigt den Aufbau der Arbeit an, welcher den frühkindlichen Spracherwerb, den Wortschatzspurt und schließlich das Fast Mapping im Detail behandelt.
Der Frühkindliche Spracherwerb: Dieses Kapitel beschreibt den frühkindlichen Spracherwerb als aktiven Konstruktionsprozess des Kindes, der jedoch stark von sozialer Interaktion abhängig ist. Es werden verschiedene Sprachkompetenzen des Kindes, wie die prosodische, linguistische und pragmatische Kompetenz, erläutert. Die Bedeutung der Interaktion mit Erwachsenen und die Rolle der gemeinsamen Aufmerksamkeit (Joint Attention) für den Spracherwerb werden hervorgehoben. Die Kapitel beschreibt den Spracherwerb als mehrstufigen Prozess, der die Aneignung phonologischer, morphologischer, syntaktischer und semantischer Regeln umfasst.
Fast Mapping - Übergang vom langsamen Wortlernen zum Wortschatzspurt: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Fast Mapping, einen Mechanismus des schnellen Wortschatzaufbaus. Es beleuchtet die linguistischen Informationen in Wortäußerungen und die Struktur des mentalen Lexikons. Der Fokus liegt auf der Rolle der Motherese als unterstützende Sprechweise, die durch ihre charakteristischen Merkmale den Spracherwerb fördert. Darüber hinaus wird Scaffolding als weitere unterstützende Lernstrategie dargestellt, welche durch sprachförderliche Dialogroutinen den Wortschatzerwerb strukturiert und als „Baugerüst“ fungiert. Der Zusammenhang zwischen Fast Mapping und dem Wortschatzspurt wird herausgestellt.
Schlüsselwörter
Frühkindlicher Spracherwerb, Fast Mapping, Motherese, Scaffolding, Wortschatzspurt, pragmatische Kompetenz, linguistische Kompetenz, Sprachentwicklung, Lernprozess, Sprachförderung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Frühkindlicher Spracherwerb, Fast Mapping, Motherese und Scaffolding
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den frühkindlichen Spracherwerb, mit besonderem Fokus auf den Prozess des Fast Mappings und der Rolle von Motherese und Scaffolding als unterstützende Faktoren. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist Fast Mapping?
Fast Mapping ist ein Mechanismus des schnellen Wortschatzerwerbs im frühen Kindesalter. Das Dokument beschreibt ihn als Übergang vom langsamen Wortlernen zum Wortschatzspurt und beleuchtet, wie Kinder in kurzer Zeit die Bedeutung neuer Wörter lernen.
Welche Rolle spielen Motherese und Scaffolding beim Fast Mapping?
Motherese (auch "Kindersprache" genannt) und Scaffolding sind unterstützende Sprechweisen von Erwachsenen, die den Spracherwerb von Kindern fördern. Motherese zeichnet sich durch bestimmte charakteristische Merkmale aus, die das Verstehen und Lernen erleichtern. Scaffolding hingegen beschreibt eine unterstützende Lernstrategie, die durch sprachförderliche Dialogroutinen den Wortschatzerwerb strukturiert und als "Baugerüst" dient. Das Dokument untersucht den Zusammenhang zwischen Fast Mapping und diesen beiden Faktoren.
Welche Aspekte des frühkindlichen Spracherwerbs werden behandelt?
Das Dokument behandelt verschiedene Aspekte des frühkindlichen Spracherwerbs, darunter die pragmatische Sprachentwicklung, den Wortschatzerwerb, die Entwicklungsphasen des Spracherwerbs, die Bedeutung der Interaktion mit Erwachsenen und die Rolle der gemeinsamen Aufmerksamkeit (Joint Attention). Es werden auch linguistische Kompetenzen wie die prosodische, linguistische und pragmatische Kompetenz erläutert.
Welche Kapitel enthält das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in die Kapitel "Einleitung", "Der Frühkindliche Spracherwerb", "Fast Mapping - Übergang vom langsamen Wortlernen zum Wortschatzspurt" und "Resümee und Ausblick". Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter des Dokuments sind: Frühkindlicher Spracherwerb, Fast Mapping, Motherese, Scaffolding, Wortschatzspurt, pragmatische Kompetenz, linguistische Kompetenz, Sprachentwicklung, Lernprozess, Sprachförderung.
Was ist das Hauptziel des Dokuments?
Das Hauptziel ist es, den Prozess des Fast Mappings im frühkindlichen Spracherwerb zu untersuchen und die Rolle von Motherese und Scaffolding als unterstützende Faktoren zu beleuchten. Es soll der Zusammenhang zwischen Fast Mapping und diesen elterlichen Sprechweisen aufgezeigt werden.
Wie wird der frühkindliche Spracherwerb beschrieben?
Der frühkindliche Spracherwerb wird als aktiver Konstruktionsprozess des Kindes beschrieben, der stark von sozialer Interaktion abhängig ist. Es ist ein mehrstufiger Prozess, der die Aneignung phonologischer, morphologischer, syntaktischer und semantischer Regeln umfasst.
Für wen ist dieses Dokument bestimmt?
Dieses Dokument ist für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich mit dem Thema des frühkindlichen Spracherwerbs, insbesondere mit Fast Mapping, Motherese und Scaffolding, auseinandersetzen möchte. Es eignet sich beispielsweise für Studenten der Sprachwissenschaften, Psychologie oder Pädagogik.
- Citation du texte
- Nick Phuong Nguyen (Auteur), 2022, Fast Mapping als von Motherese und Scaffolding unterstützter Lernprozess frühkindlichen Spracherwerbs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1285100