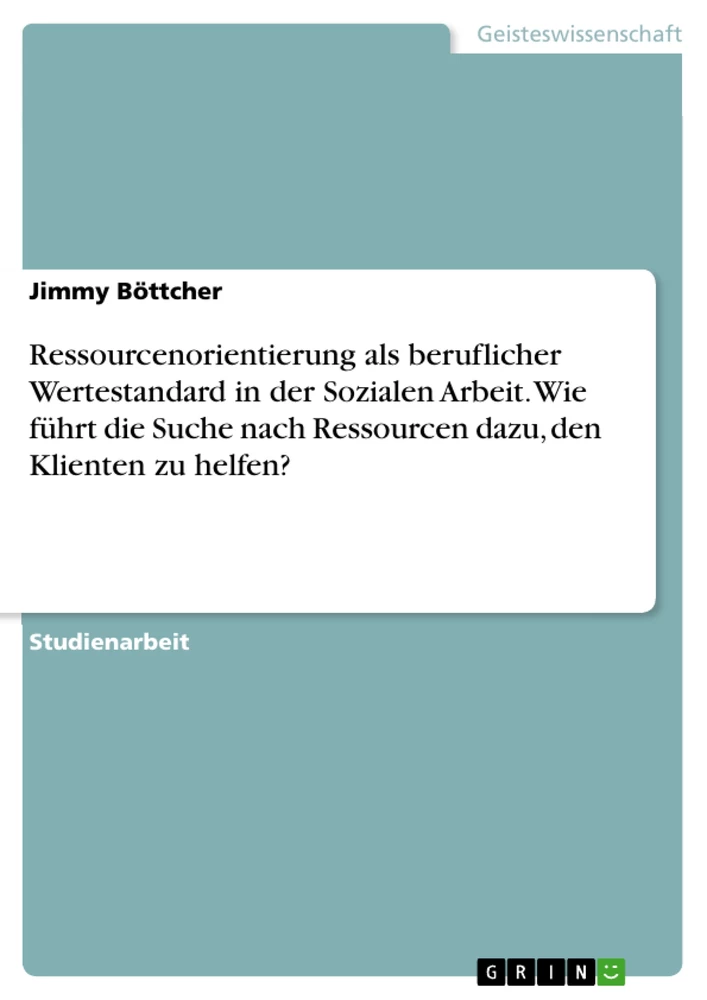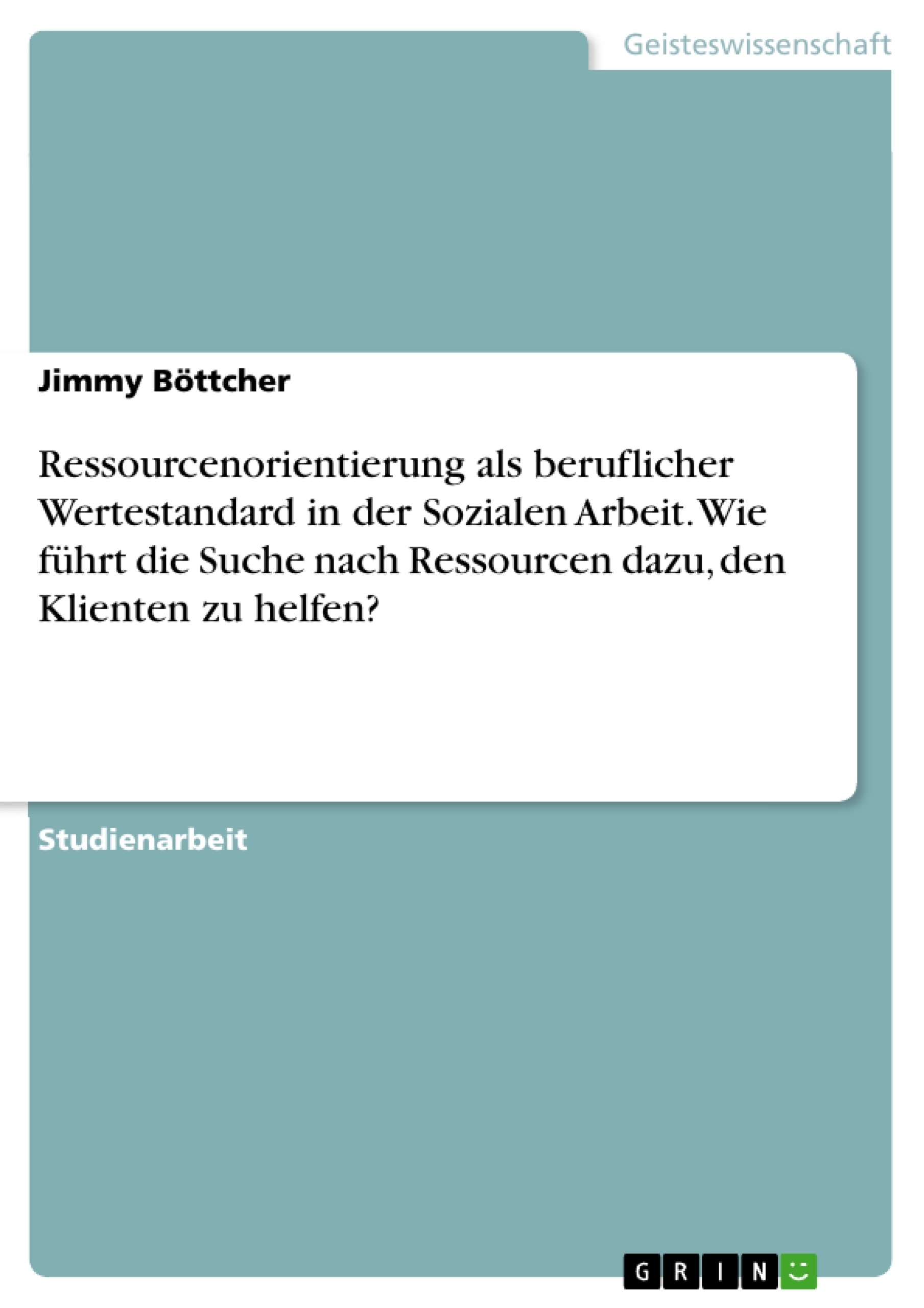Die Hausarbeit ist eine theoretische Auseinandersetzung mit den relevanten Aspekten der ressourcenorientierten Arbeit. Es wird aufgezeigt, inwieweit der theoretische Ansatz der Ressourcenorientierung in der Sozialen Arbeit umgesetzt wird und welche Methoden dabei zum Einsatz kommen.
Es werden hierbei nicht nur die Grundzüge der Ressourcenarbeit erläutert, sondern vorhandene Methoden und Techniken explizit erklärt. Durch die explizite Beschreibung soll deutlich werden, weshalb die Ressourcenorientierung eine Notwendigkeit im Hilfeprozess darstellt. Innerhalb der Hausarbeit wird dennoch kritisch hinterfragt, zu welchen potenziellen Problemen eine Ressourcenorientierung führen kann.
Die Ressourcenorientierung hat seit den 1980er Jahren die Defizitorientierung als Wertestandard in der Sozialen Arbeit abgelöst. Ein ressourcenorientiertes Arbeiten ist die sozialstaatliche Reaktion darauf, dass es Personen häufig nicht gelingt, Ressourcen selbständig zu nutzen. Vorhandene Eigenschaften, Merkmale, Objekte und andere Potenziale werden häufig nicht als Ressource eigesetzt, was dazu führt, dass die Klient*innen Probleme damit haben, individuelle sowie gesellschaftliche Anforderungen bewältigen zu können.
Die Professionellen haben daher das Ziel, den Klient*innen die vorhandenen Potenziale als Ressource zugänglich zu machen. Ein ressourcenorientiertes Arbeiten ist eines der wichtigsten Merkmale der Sozialen Arbeit und gilt als ein nicht hinterfragter beruflicher Wertestandard, dessen Einhaltung Priorität hat. Die Ressourcenorientierung ist ein Konzept, welches eine komplexe, professionelle Perspektiveinnahme und ein methodisch strukturiertes Vorgehen benötigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Gefahr der Defizitorientierung
- 3. Was ist eine Ressource
- 4. Die taxonomische Aufteilung von Ressourcen
- 5. Die Hierarchisierung von Ressourcen
- 6. Ressourcendiagnostik in der Sozialen Arbeit
- 7. Basiskompetenzen der Professionellen
- 8. Ressourceninstrumente
- 9. Ressourcen im Umfeld: Die VIP-Karte
- 10. Die Notwendigkeit der Ressourcenerhaltung
- 11. Die Ressourcenaustauschtheorie
- 12. Die Kapitalarten nach Pierre Bourdieu
- 13. Kritik an der Ressourcenorientierung
- 14. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Ressourcenorientierung in der Sozialen Arbeit. Ziel ist es, den theoretischen Ansatz der Ressourcenorientierung darzulegen, dessen Umsetzung in der Praxis aufzuzeigen und verwendete Methoden zu erläutern. Die Arbeit beleuchtet sowohl die Vorteile als auch die potenziellen Probleme dieses Ansatzes.
- Die Ablösung der Defizitorientierung durch die Ressourcenorientierung
- Definition und taxonomische Einordnung von Ressourcen
- Ressourcendiagnostik und die Rolle der Professionellen
- Ressourcen im Umfeld und deren Nutzung
- Kritikpunkte an der Ressourcenorientierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Ressourcenorientierung in der Sozialen Arbeit ein. Sie beschreibt den Wandel von der Defizit- zur Ressourcenorientierung und hebt die Bedeutung der Ressourcenaktivierung für den Erfolg sozialer Arbeit hervor. Die Arbeit kündigt eine theoretische Auseinandersetzung mit den relevanten Aspekten der ressourcenorientierten Arbeit an, inklusive der Erläuterung von Methoden und Techniken sowie einer kritischen Betrachtung potenzieller Probleme.
2. Die Gefahr der Defizitorientierung: Dieses Kapitel beleuchtet die Defizitorientierung in der Sozialen Arbeit und deren potenziell negative Auswirkungen. Es argumentiert, dass die Fokussierung auf Defizite deren Persistenz verstärken kann und zu einer verzerrten Wahrnehmung der Klient*innensituation durch die Professionellen führt. Die generalisierte Erwartung, dass mit den Klient*innen „etwas nicht stimmt“, wird als problematisch dargestellt, da sie den Dialog und die Problemlösung behindert.
3. Was ist eine Ressource?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Ressource“ im Kontext der Sozialen Arbeit. Es verfolgt die historische Entwicklung des Begriffs und zeigt die Herausforderungen auf, die mit seiner ungenauen und vielschichtigen Bedeutung verbunden sind. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit einer klaren kommunikativen Basis über den Ressourcenbegriff für einen produktiven Austausch zwischen Professionellen und Klient*innen. Die Bedeutung der Hilfe zur Selbsthilfe und die Veränderungen im Wohlfahrtsstaat werden ebenfalls diskutiert.
4. Die taxonomische Aufteilung von Ressourcen: Dieses Kapitel beschreibt die taxonomische Einteilung von Ressourcen in Personen- und Umweltressourcen, unterstreicht aber gleichzeitig die Interdependenz beider. Eine strikte Trennung wird als nicht sinnvoll betrachtet, da die Ressourcennutzung immer einen Kommunikationsprozess zwischen Person und Umwelt beinhaltet. Die verschiedenen Kategorien von Ressourcen (physisch, psychisch, kulturell/symbolisch, relational) werden kurz angerissen.
Schlüsselwörter
Ressourcenorientierung, Defizitorientierung, Soziale Arbeit, Ressourcendiagnostik, Hilfeprozess, Personenressourcen, Umweltressourcen, Ressourcenaktivierung, Selbsthilfe, Kapitalarten nach Bourdieu.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Ressourcenorientierung in der Sozialen Arbeit
Was ist der Hauptfokus dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich umfassend mit der Ressourcenorientierung in der Sozialen Arbeit. Sie untersucht den theoretischen Ansatz, dessen praktische Umsetzung und die dabei verwendeten Methoden. Dabei werden sowohl die Vorteile als auch die potenziellen Probleme dieses Ansatzes beleuchtet.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Ablösung der Defizitorientierung durch die Ressourcenorientierung, die Definition und taxonomische Einordnung von Ressourcen, die Ressourcendiagnostik und die Rolle der Professionellen, Ressourcen im Umfeld und deren Nutzung sowie kritische Punkte der Ressourcenorientierung. Die Kapitel befassen sich detailliert mit der Definition von Ressourcen, ihrer taxonomischen Einteilung (Personen- und Umweltressourcen), der Hierarchisierung von Ressourcen und der Bedeutung von Ressourceninstrumenten und der Ressourcenaustauschtheorie. Auch die Kapitalarten nach Pierre Bourdieu werden diskutiert.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit enthält eine Einleitung, die den Wandel von der Defizit- zur Ressourcenorientierung beschreibt. Es folgen Kapitel zur Gefahr der Defizitorientierung, zur Definition von Ressourcen, zu deren taxonomischer Aufteilung, zur Ressourcendiagnostik in der Sozialen Arbeit, zu den Basiskompetenzen Professioneller und zu Ressourceninstrumenten. Weitere Kapitel befassen sich mit Ressourcen im Umfeld, der Notwendigkeit der Ressourcenerhaltung, der Ressourcenaustauschtheorie, den Kapitalarten nach Bourdieu und einer abschließenden Kritik an der Ressourcenorientierung sowie einem Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel kurz erläutert.
Was versteht die Hausarbeit unter Ressourcen?
Die Hausarbeit definiert den Begriff "Ressource" im Kontext der Sozialen Arbeit und betrachtet dessen historische Entwicklung und die Herausforderungen, die mit seiner vielschichtigen Bedeutung verbunden sind. Es wird die Notwendigkeit einer klaren kommunikativen Basis über den Ressourcenbegriff für den Austausch zwischen Professionellen und Klient*innen betont. Die Bedeutung der Hilfe zur Selbsthilfe und der Veränderungen im Wohlfahrtsstaat wird ebenfalls diskutiert. Ressourcen werden taxonomisch in Personen- und Umweltressourcen eingeteilt, wobei deren Interdependenz hervorgehoben wird. Die verschiedenen Kategorien von Ressourcen (physisch, psychisch, kulturell/symbolisch, relational) werden ebenfalls angesprochen.
Welche Rolle spielen die Professionellen in der Ressourcenorientierung?
Die Hausarbeit betont die wichtige Rolle der Professionellen in der Ressourcendiagnostik und -aktivierung. Die Basiskompetenzen der Professionellen im Umgang mit Ressourcen werden erläutert. Es wird hervorgehoben, wie die Professionellen dazu beitragen können, Ressourcen zu identifizieren und zu nutzen, um die Selbstbestimmung und die Hilfe zur Selbsthilfe der Klient*innen zu fördern.
Welche Kritikpunkte an der Ressourcenorientierung werden angesprochen?
Die Hausarbeit widmet ein eigenes Kapitel der Kritik an der Ressourcenorientierung. Es werden potenzielle Probleme und Limitationen des Ansatzes beleuchtet, um ein umfassendes und ausgewogenes Bild zu liefern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Ressourcenorientierung, Defizitorientierung, Soziale Arbeit, Ressourcendiagnostik, Hilfeprozess, Personenressourcen, Umweltressourcen, Ressourcenaktivierung, Selbsthilfe, Kapitalarten nach Bourdieu.
- Quote paper
- Jimmy Böttcher (Author), 2022, Ressourcenorientierung als beruflicher Wertestandard in der Sozialen Arbeit. Wie führt die Suche nach Ressourcen dazu, den Klienten zu helfen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1285386