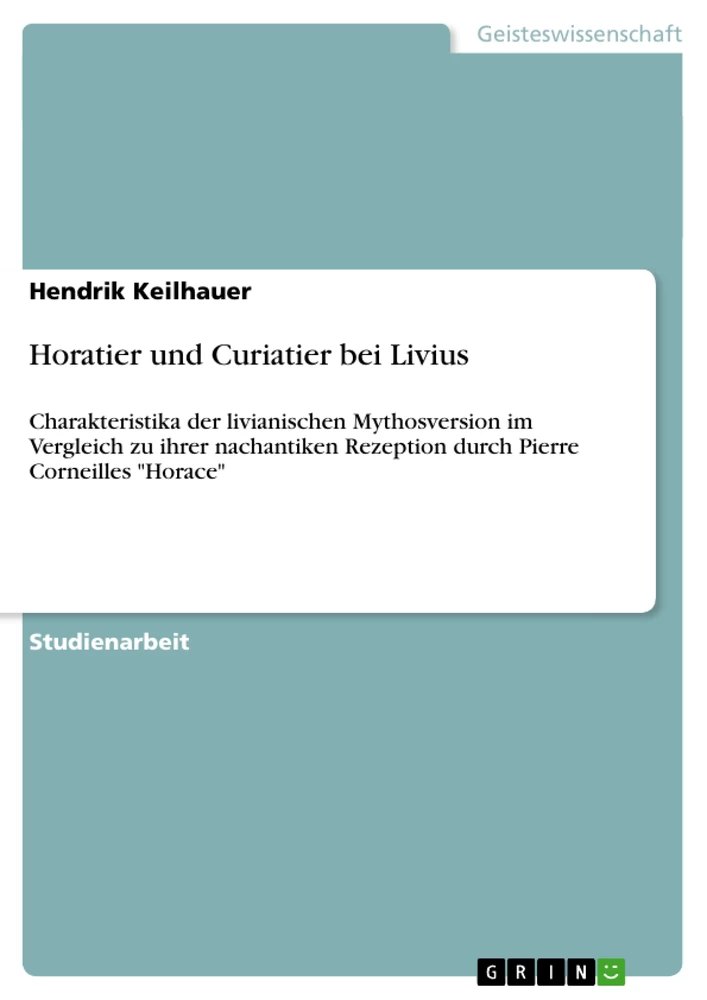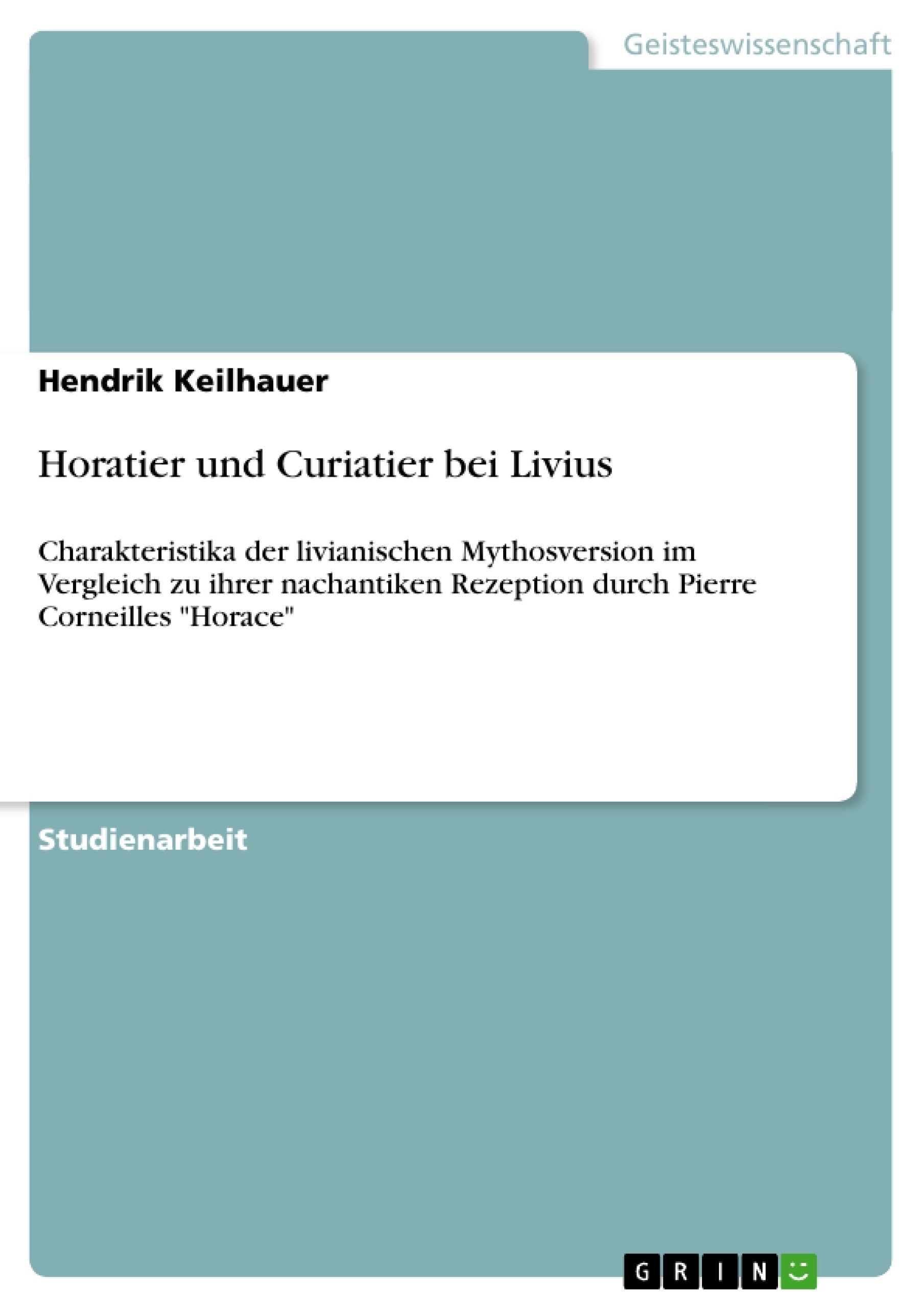Gegenstand dieser Arbeit ist es, diesen, ungeachtet seiner héritage indo-européen fondamental (POUCET) indigen römischen Mythos in der bei Livius auftretenden Form als frühest fassbare
Quelle durch teilweisen Vergleich mit der Parallelüberlieferung des Dionys darzustellen, die
Charakteristiken dieser Version aufzuzeigen sowie Aussagen über die Motivation des Livius zu
treffen. Dabei findet auch die Frage Beachtung, was den Text des Livius so „römisch“ macht.
Anschließend wird ein Zeitsprung über anderthalb Jahrtausende vielfältiger Rezeption der
livianischen Vorlage unternommen, um an dem konkreten Beispiel der Tragöde "Horace" des
Pierre Corneille einen Vergleich darüber zu ziehen, was, wie und warum der französische
Dramatiker konkrete Bestandteile des livianischen Mythos‘ aufgreift und weiterentwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Horatii et Curiatii apud Livium (I 24-26)
- Der Mythos
- Die Besonderheiten der livianischen Gestaltung
- Die Motivation der Darstellung des Mythos' in ab urbe condita
- Pierre Corneilles Horace (1640/41)
- Die Handlung des Corneilleschen Dramas
- Vergleich mit Livius
- Schlussbetrachtung
- Verzeichnis der verwendeten Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Darstellung des Mythos von den Horatiern und Curiatiern bei Livius und seiner Rezeption durch Pierre Corneille. Ziel ist es, die Charakteristika der livianischen Version des Mythos aufzuzeigen und die Motivation des Autors für seine Darstellung zu analysieren. Im Vergleich mit Corneilles Horace wird untersucht, wie der französische Dramatiker den livianischen Mythos aufgreift und weiterentwickelt.
- Die livianische Version des Mythos von den Horatiern und Curiatiern
- Die Motivation des Livius für seine Darstellung des Mythos
- Die Rezeption des Mythos durch Pierre Corneille
- Vergleich der livianischen und der Corneilleschen Version des Mythos
- Die Bedeutung des Mythos für die römische Geschichte und Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Mythos von den Horatiern und Curiatiern vor und skizziert die Rezeption des Mythos von der Antike bis zur Gegenwart. Das zweite Kapitel analysiert die livianische Version des Mythos, wobei die Besonderheiten der livianischen Gestaltung und die Motivation des Autors für seine Darstellung im Vordergrund stehen. Das dritte Kapitel widmet sich der Rezeption des Mythos durch Pierre Corneille und untersucht die Handlung des Corneilleschen Dramas im Vergleich mit der livianischen Vorlage. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen über die Bedeutung des Mythos für die römische Geschichte und Kultur.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Mythos von den Horatiern und Curiatiern, die livianische Geschichtsschreibung, die Rezeption des Mythos in der Literatur, Pierre Corneille, die römische Geschichte und Kultur, die Bedeutung des Mythos für die römische Identität.
- Quote paper
- Hendrik Keilhauer (Author), 2009, Horatier und Curiatier bei Livius, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128583