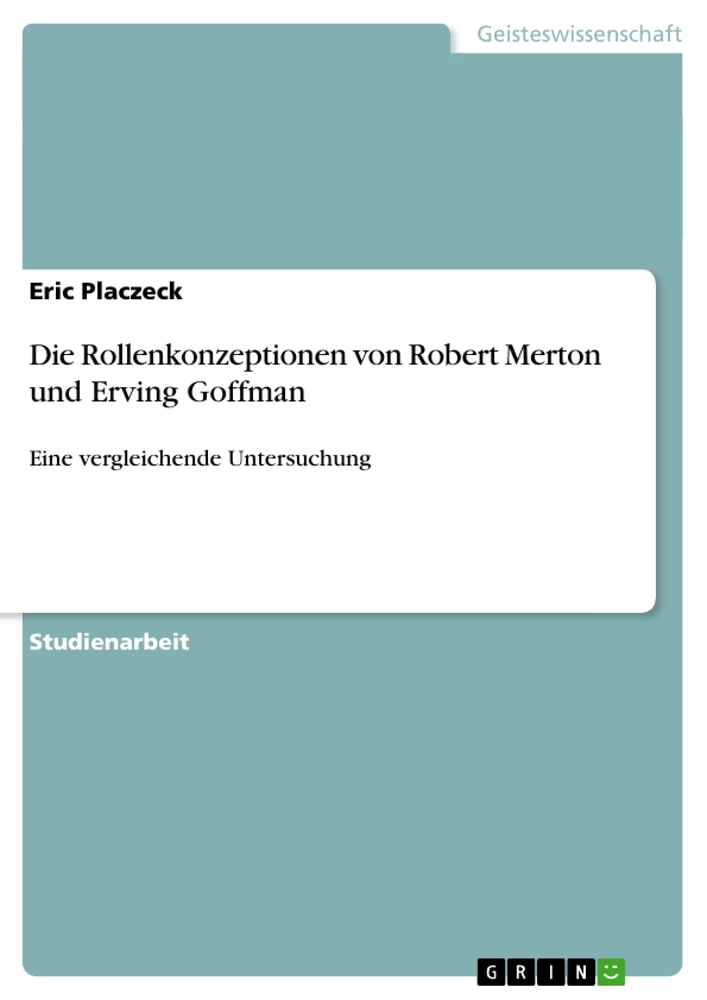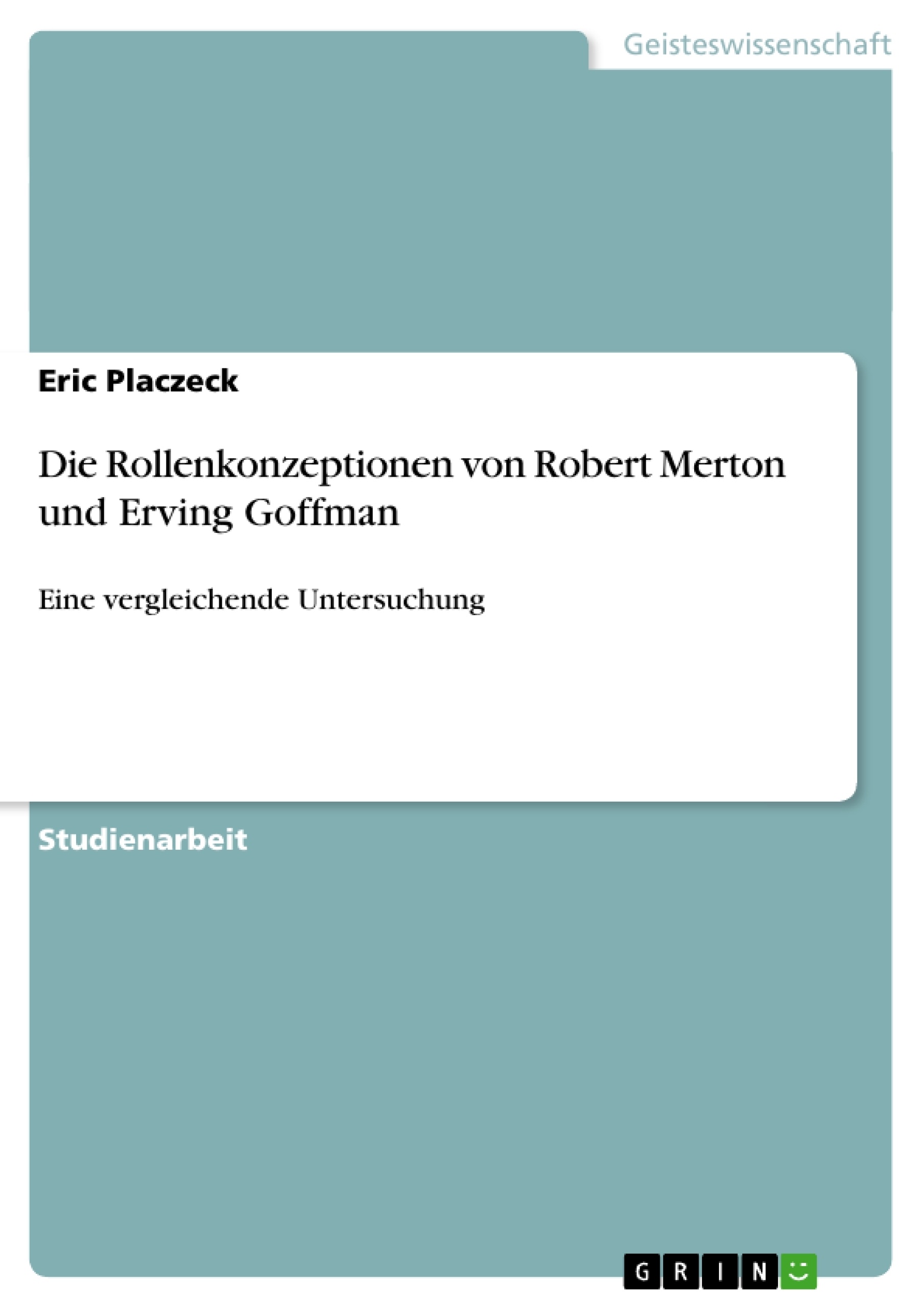Die Rolle als soziologische Kategorie hat einen ebenso naheliegenden, wie auch undefinierten Charakter. Die Alltagssprache verwendet diesen Begriff in vielerlei Zusammenhängen von der kulinarischen Teigrolle über die sportliche Bodenrolle bis zur theatralischen Bühnenrolle. Allen Verwendungen wohnt aus etymologischer Sicht etwas „Rundes inne, was auf der Herkunft des Begriffes vom Lateinischen rotula für kleines Rad beruht" (Coburn-Staege 1973: 9). Die umgangssprachliche Leichtigkeit des Begriffs macht es der sozialen Rolle schwer, sich als soziologischer Begriff eine theoretische Nische zu suchen, wie zum Beispiel die aus der Umgangssprache herausgelösten Fachtermini Norm, Sanktion oder Sozialisation.
Dabei ist das Prinzip, welches eine Rolle im sozialen Kontext ausfüllt, bereits in der Anfangsliteratur der Disziplin implizit erwähnt worden. So sprach Durkheim (König 1984) von einem äußeren Zwang, der von der Gesellschaft auf das Verhalten des Einzelnen wirkt. An die strukturelle Eingliederung des Subjekts in seine Umwelt, welche Durkheim beschrieb, knüpften in der Folge explizite Rollenkonzepte an.
Um die Aufnahme des Begriffs in die soziologische Terminologie machten sich eine überschaubare Anzahl von Soziologen verdient, die dem Konzept in gegenseitigem Rekurs ein Profil verliehen. Ohne die Geschichte der Rolle in der Soziologie aus Kapitel 2 vorwegnehmen zu wollen, legten Robert K. Merton und Erving Goffman sehr differenzierte und für die Folgeforschung fruchtbare Konzepte einer sozialen Rolle vor. Der Elaboration und dem Vergleich dieser Konzeptionen soll diese Arbeit gewidmet sein.
Eine umfassende Eingliederung von Merton und Goffman ist jedoch nicht möglich, ohne im besonderen auf einschlägige Vorarbeiten von Linton und Mead einzugehen. Der Sinnzusammenhang soll im zweiten Kapitel vorgestellt werden, bevor Merton und Goffman zunächst gesondert anhand ihrer Kernbegriffe Rollen-Set und Rollendistanz nachvollzogen werden. In der Integration und Synthese ihrer Ansätze werden a priorische Unterschiede in der Methodologie aufgezeigt und der Versuch unternommen, trotzdem Konvergenzen zu entdecken.
Insgesamt wäre dieses Thema in seinem Umfang einer ausführlicheren Betrachtung, als der vorliegenden, durchaus gewachsen. Jedoch ist der Anspruch dieser Arbeit die Rollenkonzeptionen von Merton und Goffman im Wesentlichen nachzuvollziehen und ineinander integrieren zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Die Geschichte des Rollen-Begriffs in der Soziologie
- Der Strukturansatz: Linton, Parsons, Merton
- Der interaktionistische Ansatz: Mead, Turner, Goffman
- Robert K. Mertons Soziologie
- Der Rollen-Set
- Mechanismen zur Integration der Rollen im Rollen-Set
- Die Soziologie von Erving Goffman
- Die soziale Rolle bei Erving Goffman
- Rollendistanz
- Ausdruck der Rollendistanz
- Ursachen der Rollendistanz
- Vergleich der sozialen Rolle von Merton und Goffman
- Integration
- Identität und Funktion
- Synthese
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Rollenkonzeptionen von Robert Merton und Erving Goffman und untersucht diese vergleichend. Ziel ist es, die jeweiligen Ansätze der beiden Soziologen zu analysieren und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Dabei werden die historischen Wurzeln der Rollenkonzeption in der Soziologie beleuchtet, insbesondere die Beiträge von Linton und Mead, auf denen Merton und Goffman aufbauten.
- Die Entwicklung des Rollenbegriffs in der Soziologie
- Die Rollenkonzeption von Robert Merton
- Die Rollenkonzeption von Erving Goffman
- Vergleich der Rollenkonzeptionen von Merton und Goffman
- Integration und Synthese der Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der sozialen Rolle ein und beleuchtet die Vielschichtigkeit des Begriffs in der Alltagssprache. Es wird die Bedeutung der Rolle als soziologische Kategorie hervorgehoben und die historische Entwicklung des Rollenbegriffs in der Soziologie skizziert.
Das zweite Kapitel widmet sich der Geschichte des Rollenbegriffs in der Soziologie. Es werden vier Ansätze vorgestellt, die die Diskussion des Rollenbegriffs prägten: der Strukturansatz von Linton, der interaktionistische Ansatz von Mead, der Ansatz von Moreno und die Gestalt-Theorie von Lewin. Die jeweiligen Ansätze werden in ihren Grundideen nachvollzogen und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Rollendiskussion in der Soziologie herausgestellt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Soziologie von Robert K. Merton und seiner Rollenkonzeption. Es werden Mertons Kernbegriffe "Rollen-Set" und "Mechanismen zur Integration der Rollen im Rollen-Set" erläutert und ihre Bedeutung für die Analyse sozialer Rollen dargestellt.
Das vierte Kapitel widmet sich der Soziologie von Erving Goffman und seiner Rollenkonzeption. Es werden Goffmans Kernbegriffe "Soziale Rolle" und "Rollendistanz" erläutert und ihre Bedeutung für die Analyse sozialer Rollen dargestellt.
Das fünfte Kapitel vergleicht die Rollenkonzeptionen von Merton und Goffman. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Ansätze in Bezug auf die Integration von Rollen, die Bedeutung der Identität und die Funktion von Rollen herausgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die soziale Rolle, Rollenkonzeptionen, Robert Merton, Erving Goffman, Strukturansatz, Interaktionismus, Rollen-Set, Rollendistanz, Integration, Identität, Funktion, Soziologie.
- Quote paper
- Eric Placzeck (Author), 2009, Die Rollenkonzeptionen von Robert Merton und Erving Goffman , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128640