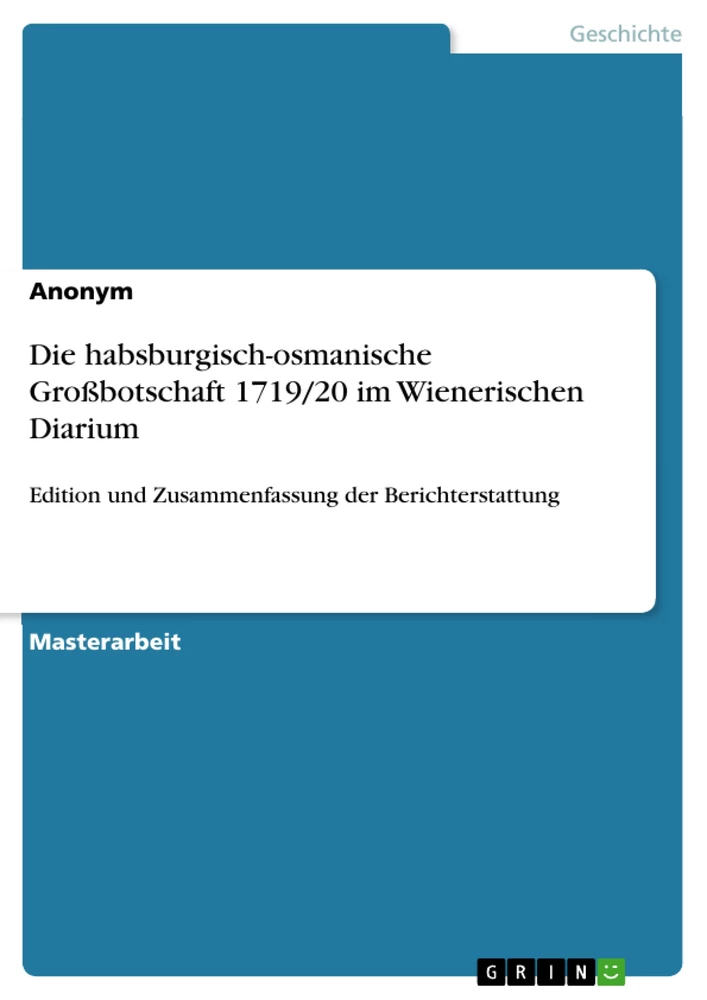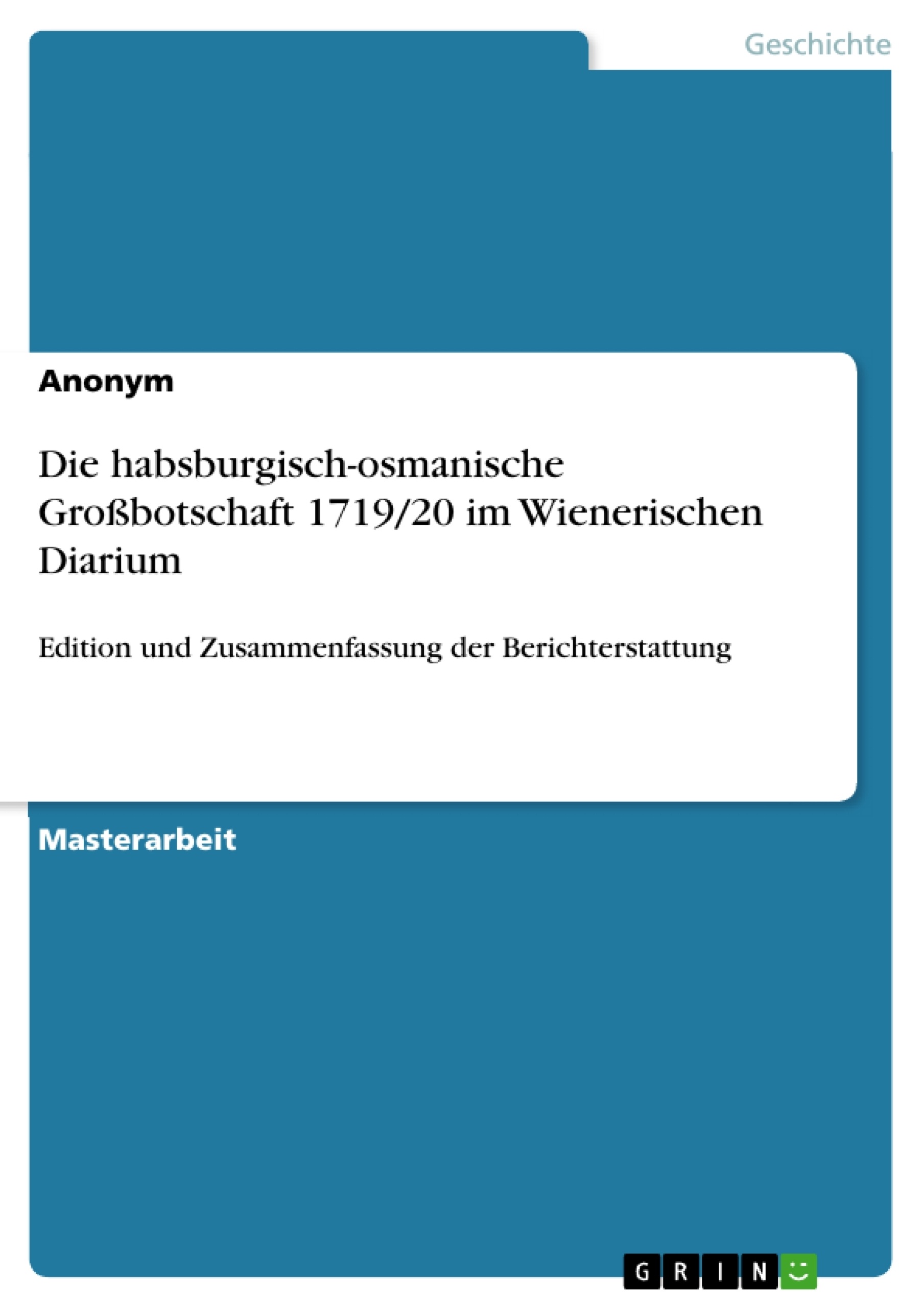Diese Arbeit untersucht die zeitgenössische Berichterstattung über die habsburgisch-osmanische Großbotschaft 1719/20. Im Fokus steht dabei das „Wienerische Diarium“, die älteste, noch erscheinende Tageszeitung der Welt. Neben einer inhaltlichen Zusammenfassung, welche einen Überblick über die Berichte der damaligen Zeit geben soll, enthält diese Arbeit auch einen Editionsteil. Darin sind sämtliche transkribierte Texte der Berichterstattung zu finden. Die Transkription und weitere digitale Aufbereitung, im Zuge derer unter anderem auch das Markieren von bestimmten Wörtern erfolgte, wurde über das Programm „Transkribus“ realisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Historischer Kontext
- Entstehung und Charakteristika von Großbotschaften
- Die habsburgisch-osmanische Großbotschaft von 1719/20
- Das Medium Zeitung
- Historische Entwicklung
- Das Wienerische Diarium
- Methode
- Quellenbeschaffung
- Digitale Aufbereitung mit Transkribus
- Zusammenfassung der Quellen
- Überblick
- Auswechslung der Großbotschafter
- Audienz des kaiserlichen Großbotschafters bei Sultan Ahmed III.
- Abschließende Worte
- Editionsteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der zeitgenössischen Berichterstattung über die habsburgisch-osmanische Großbotschaft 1719/20, wobei der Fokus auf dem Wienerischen Diarium, der ältesten noch erscheinenden Tageszeitung der Welt, liegt. Ziel ist es, einen Überblick über die Berichterstattung des Wienerischen Diariums zu geben und die Texte der damaligen Zeit zu editieren.
- Untersuchung der zeitgenössischen Berichterstattung über die Großbotschaft
- Analyse des Wienerischen Diariums als Medium
- Digitale Edition der Quellen
- Einblick in die habsburgisch-osmanischen Beziehungen
- Bedeutung publizistischer Quellen in der Geschichtsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den historischen Kontext der Arbeit dar, wobei die Bedeutung der habsburgisch-osmanischen Beziehungen im 18. Jahrhundert hervorgehoben wird.
- Historischer Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Charakteristika von Großbotschaften im Allgemeinen und geht dann speziell auf die habsburgisch-osmanische Großbotschaft von 1719/20 ein.
- Das Medium Zeitung: Hier wird die historische Entwicklung von Zeitungen und die Bedeutung des Wienerischen Diariums als eines der wichtigsten Medien der damaligen Zeit erörtert.
- Methode: Das Kapitel beschreibt die Methode, die für die Quellenbeschaffung und die digitale Aufbereitung der Texte eingesetzt wurde.
- Zusammenfassung der Quellen: In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die Berichte des Wienerischen Diariums zur Großbotschaft gegeben, wobei besondere Ereignisse wie die Auswechslung der Großbotschafter und die Audienz beim Sultan Ahmed III. behandelt werden.
Schlüsselwörter
Habsburgisch-osmanische Großbotschaft, Wienerisches Diarium, Zeitungsberichterstattung, digitale Edition, Transkribus, Diplomatie, Beziehungen, 18. Jahrhundert, QhoD, Publizistische Quellen.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Großbotschaft von 1719/20?
Es handelte sich um eine diplomatische Mission zwischen dem Habsburgerreich und dem Osmanischen Reich zur Festigung der Beziehungen nach dem Frieden von Passarowitz.
Was ist das Wienerische Diarium?
Das Wienerische Diarium (heute Wiener Zeitung) ist die älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt und diente als Hauptquelle für diese Untersuchung.
Wie wurden die historischen Texte aufbereitet?
Die Texte wurden mit dem Programm „Transkribus“ digitalisiert, transkribiert und für eine Edition aufbereitet.
Welche Ereignisse wurden in der Zeitung besonders thematisiert?
Besonders ausführlich wurde über die Auswechslung der Großbotschafter an der Grenze und die Audienz beim Sultan Ahmed III. berichtet.
Warum sind Zeitungen als historische Quellen so wichtig?
Sie bieten einen Einblick in die zeitgenössische Wahrnehmung politischer Ereignisse und zeigen, wie Informationen im 18. Jahrhundert verbreitet wurden.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2022, Die habsburgisch-osmanische Großbotschaft 1719/20 im Wienerischen Diarium, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1286661