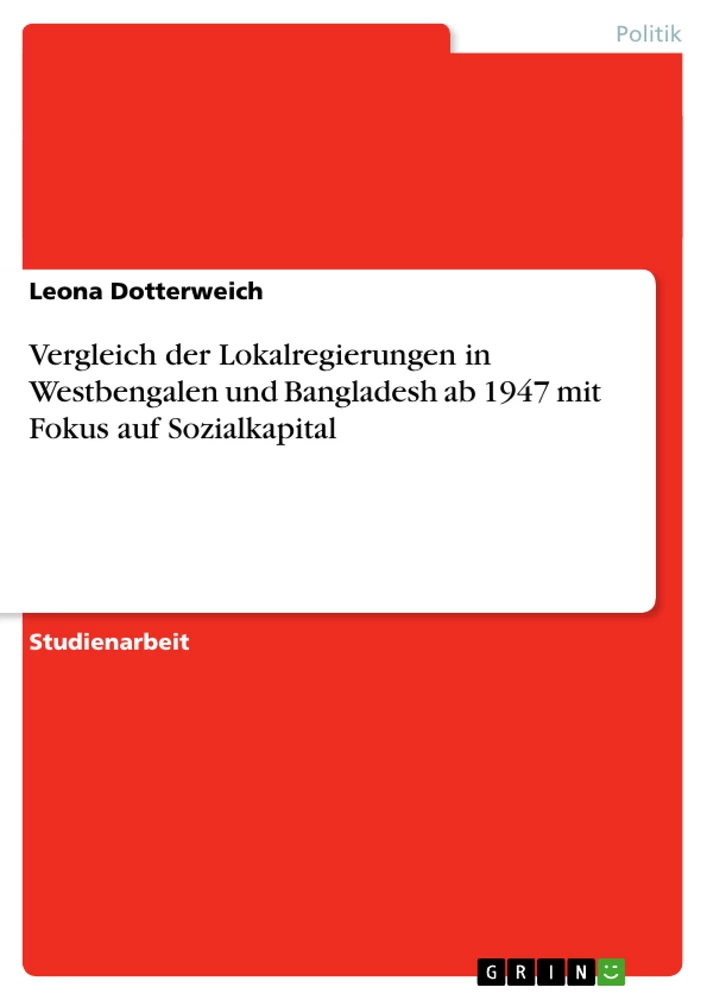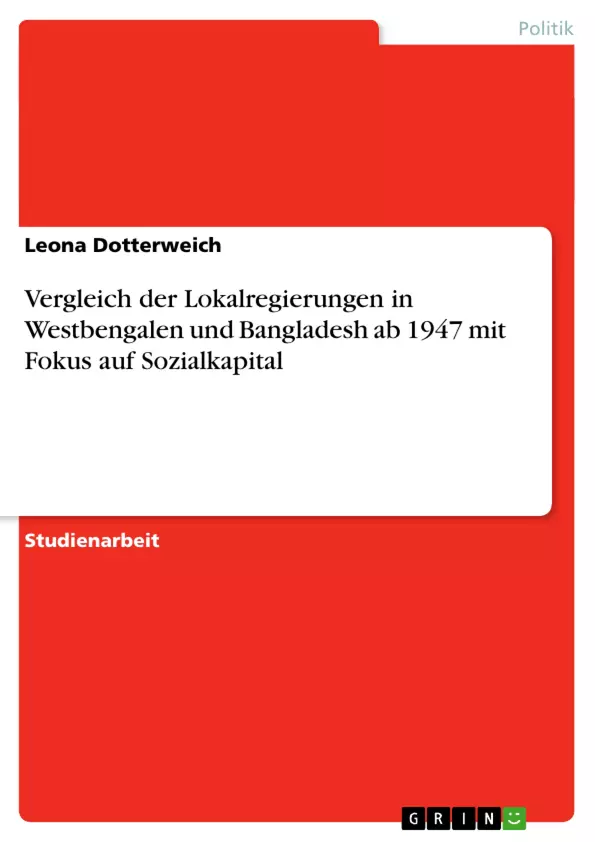In der nachfolgenden Arbeit werde ich mich mit der Frage beschäftigen, wieso es nach der Teilung Indiens 1947 zu einer unterschiedlichen Entwicklung in Westbengalen und im heutigen Bangladesh kam. Hierbei werde ich näher darauf eingehen, welche Rolle Sozialkapital bei der Bildung der effektiven Regierungen im Positivbeispiel Westbengalen spielt, aber auch ob- und wenn ja, inwieweit- es in Bangladesh Einfluss hat oder ob es erst noch aktiviert werden muss. Einsteigen in die Thematik werde ich mit einem kurzen historischen Abriss der Sozialkapitalidee und hierbei die wichtigsten Thesen kurz vorstellen und gegenüberstellen, bevor ich auf die heutige Definition von Sozialkapital durch die Weltbank übergehe und auf deren Idee von dessen Messbarkeit. Nach diesem eher theoretisch gehaltenen Teil komme ich auf meinen regionalen Fokus- Westbengalen und Bangladesh zu sprechen und beziehe mich zunächst auf eine Studie von Thörlind (1999), welcher sich intensiv mit der unterschiedlichen Entwicklung von Westbengalen und Bangladesh auseinandergesetzt hat und sich hierbei die Frage nach dem Einfluss von Sozialkapital stellt. Hieran werde ich mit Bhattacharyya (2002) und seiner Untersuchung in Westbengalen bezüglich Sozialkapital anknüpfen sowie mit einer Studie von Pargal, Gilligan und Huq (2004) in Bangladesh das voluntary solid waste management betreffend. Abschließend werde ich die in diesen Studien gefundenen Ergebnisse gegenüber stellen und die positive Rolle von Sozialkapital bei der Entstehung von dezentralisierten effektiven Regierungen diskutieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Sozialkapital-Debatte
- Definition von Sozialkapital nach der Weltbank
- The Social Capital Assessment Tool (SOCAT)
- Studie von Thörlind zur unterschiedlichen Entwicklung Bangladeshs und Westbengalens mit Fokus auf Sozialkapital
- Analyse der Generierung von Sozialkapital in Westbengalen und Bangladesh
- Ergebnisse Westbengalen
- Ergebnisse Bangladesh
- Zusammenfassung
- Analyse der Generierung von Sozialkapital in Westbengalen und Bangladesh
- Studie von Bhattacharyya über Sozialkapital in Westbengalen
- Der Fall Westbengalen
- Bildung von Sozialkapital während der Kolonialzeit und danach
- Zivile Kompetenz und Volksvertrauen
- Panchayats und Sozialkapital
- Untersuchung auf dem Land
- Untersuchung bei den Schedules Castes und Scheduled Tribes
- Untersuchung in der Stadt
- Beispiel von Sozialkapital und seinen Auswirkungen in Bangladesh anhand voluntary solid waste management in Dhaka
- Untersuchung
- Ergebnisse
- Zusammenfassende Ergebnisse bezüglich der Rolle von Sozialkapital bei der Entwicklung von dezentralisierten effektiven Regierungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die unterschiedliche Entwicklung von Westbengalen und Bangladesh nach der Teilung Indiens im Jahr 1947. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle von Sozialkapital bei der Bildung effektiver Regierungen, insbesondere in Westbengalen. Die Arbeit untersucht, ob und inwieweit Sozialkapital in Bangladesh Einfluss hat oder ob es erst noch aktiviert werden muss.
- Die Bedeutung von Sozialkapital für die Entwicklung effektiver Regierungen
- Die unterschiedliche Entwicklung von Westbengalen und Bangladesh nach 1947
- Die Rolle von Sozialkapital in der Entwicklung von dezentralisierten Regierungen
- Die Herausforderungen der Aktivierung von Sozialkapital in Entwicklungsländern
- Die Bedeutung von Vertrauen, Netzwerken und Normen für die Entwicklung von Sozialkapital
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach der unterschiedlichen Entwicklung von Westbengalen und Bangladesh nach 1947. Dabei wird die Rolle von Sozialkapital als Schlüsselfaktor für die Bildung effektiver Regierungen hervorgehoben. Das zweite Kapitel bietet einen historischen Abriss der Sozialkapitaldebatte und stellt die wichtigsten Thesen von James Coleman und Robert Putnam gegenüber. Es wird die Bedeutung von Sozialkapital als Ressource für Individuen und Gesellschaften sowie seine Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung und der Entstehung demokratischer Gesellschaften beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich der Definition von Sozialkapital nach der Weltbank und stellt das Social Capital Assessment Tool (SOCAT) vor. Es werden die verschiedenen Elemente von Sozialkapital, wie structural social capital und cognitive social capital, sowie die unterschiedlichen Ebenen der Analyse (Mikro-, Meso- und Makroebene) erläutert. Die Weltbank betont die Bedeutung von Sozialkapital für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes, indem es Transaktionen zwischen Individuen, Haushalten und Gruppen erleichtert.
Kapitel 4 analysiert die Studie von Thörlind (1999) zur unterschiedlichen Entwicklung von Westbengalen und Bangladesh. Thörlind untersucht den Einfluss von Sozialkapital auf die Entwicklung der beiden Regionen und stellt fest, dass Westbengalen aufgrund eines höheren Sozialkapitals eine positivere Entwicklung verzeichnet hat. Die Studie analysiert die Generierung von Sozialkapital in beiden Regionen und zeigt die Unterschiede in den Ergebnissen auf.
Kapitel 5 befasst sich mit der Studie von Bhattacharyya (2002) über Sozialkapital in Westbengalen. Bhattacharyya untersucht die Bildung von Sozialkapital während der Kolonialzeit und danach und analysiert die Rolle von zivilem Engagement und Volksvertrauen. Die Studie untersucht auch die Bedeutung von Panchayats (lokalen Selbstverwaltungseinheiten) für die Entwicklung von Sozialkapital in Westbengalen.
Kapitel 6 präsentiert eine Studie von Pargal, Gilligan und Huq (2004) in Bangladesh, die sich mit dem voluntary solid waste management in Dhaka befasst. Die Studie untersucht die Rolle von Sozialkapital bei der erfolgreichen Implementierung dieses Programms und zeigt die positiven Auswirkungen von Sozialkapital auf die lokale Entwicklung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Sozialkapital, Entwicklung, Dezentralisierung, Westbengalen, Bangladesh, Teilung Indiens, effektive Regierungen, Vertrauen, Netzwerke, Normen, ziviles Engagement, Weltbank, SOCAT, Panchayats, voluntary solid waste management.
Häufig gestellte Fragen
Warum entwickelten sich Westbengalen und Bangladesh nach 1947 so unterschiedlich?
Studien deuten darauf hin, dass das höhere Maß an Sozialkapital und die effektivere Dezentralisierung in Westbengalen zu einer stabileren politischen Entwicklung führten.
Was ist Sozialkapital im Kontext der Politikwissenschaft?
Sozialkapital umfasst soziale Netzwerke, Normen der Gegenseitigkeit und Vertrauen, die es einer Gesellschaft ermöglichen, kollektive Probleme effizienter zu lösen.
Welche Rolle spielen Panchayats in Westbengalen?
Panchayats sind lokale Selbstverwaltungseinheiten, die in Westbengalen zur Stärkung der zivilen Kompetenz und zur Aktivierung von Sozialkapital beigetragen haben.
Was ist das SOCAT-Tool der Weltbank?
Das Social Capital Assessment Tool (SOCAT) dient der Messung von Sozialkapital auf verschiedenen Ebenen, um dessen Einfluss auf wirtschaftliche Entwicklungsprojekte zu analysieren.
Gibt es Beispiele für funktionierendes Sozialkapital in Bangladesh?
Ja, das freiwillige Abfallmanagement in Dhaka zeigt, wie lokale Gemeinschaften durch soziale Netzwerke und Normen öffentliche Aufgaben erfolgreich bewältigen können.
- Citation du texte
- Leona Dotterweich (Auteur), 2007, Vergleich der Lokalregierungen in Westbengalen und Bangladesh ab 1947 mit Fokus auf Sozialkapital, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128708