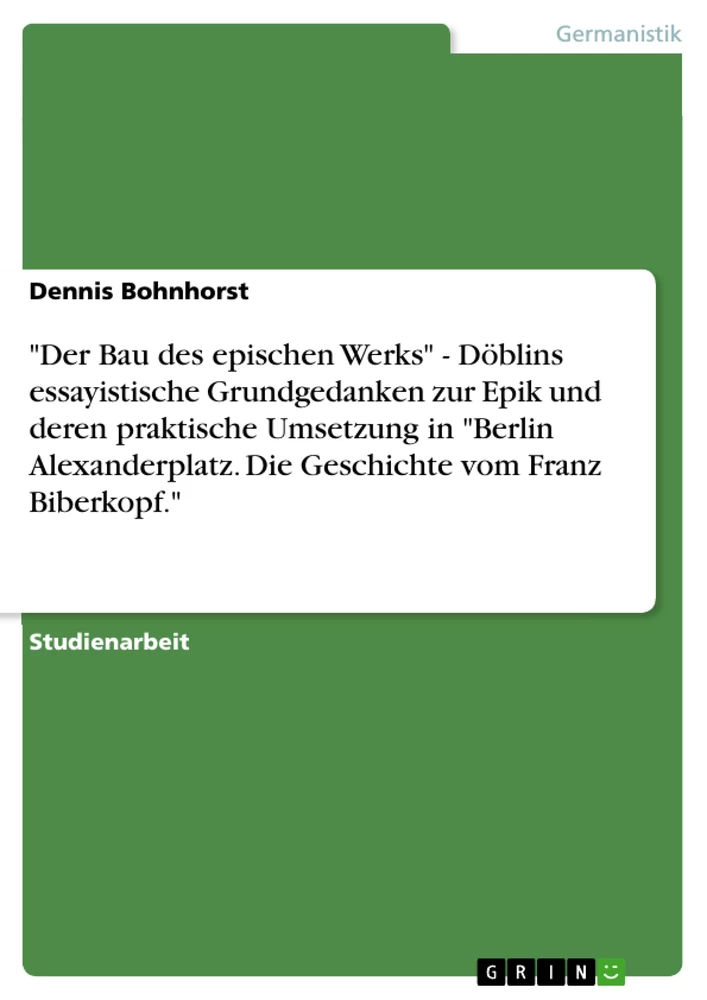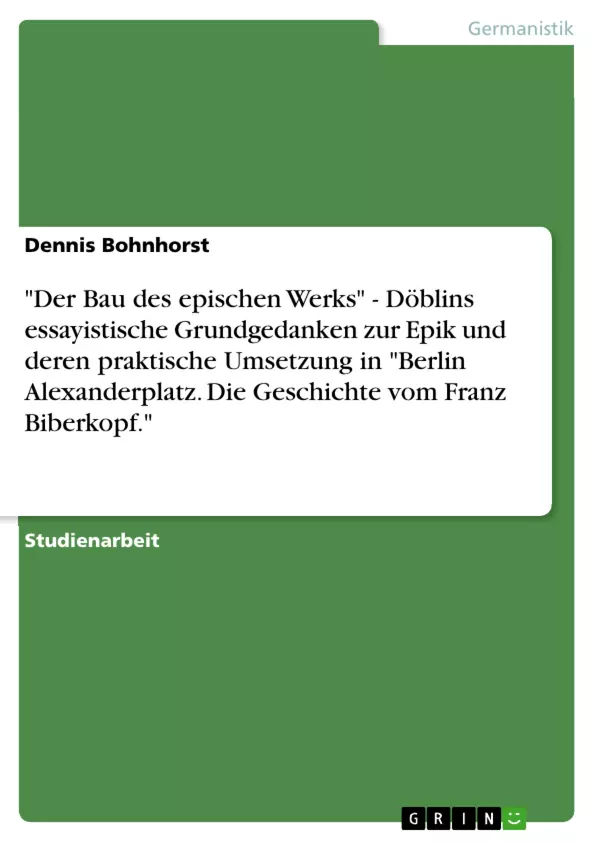Alfred Döblins Essay "Der Bau des epischen Werks" liest sich wie eine fast deckungsgleiche Anleitung zur Niederschrift des Romans "Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf." Der genannte Aufsatz entstand 1928 parallel zur Arbeit am Roman, weshalb hier zunächst Form und Inhalt sowie das für die Seminararbeit Wesentliche des Aufsatzes analysiert und im nächsten Schritt erläutert wird, inwieweit Döblin seine Überlegungen praktisch umgesetzt hat, indem Parallelen zwischen beiden Texten aufgezeigt werden. Der Schwerpunkt der dann folgenden, ebenfalls vergleichenden Analysen liegt auf der Untersuchung der vorhandenen inhaltlichen Thematik sowie der Erzählerrolle vor dem Hintergrund der heutigen Erzähltheorie und Ziolkowskis Interpretation zum Roman .
Der Schlussteil der Seminararbeit antwortet auf die Frage, inwieweit Döblin seine selbst gesetzten Postulate erfüllt hat.
[...]
Die vorgestellten Postulate des Essays lassen sich auch auf die nun abschließende vergleichende Untersuchung der Erzählsituation anwenden. Beachtung findet in diesem Zusammenhang der Aspekt der Fokalisierung gemäß der heutigen Erzähltheorie von Martinez und Scheffel.
Die Forderungen des Essays münden darin, dass Döblins erzählerisches Konzept der „Depersonation“ aus seinem „Berliner Programm“ lediglich „punktuell modifiziert“ werde, erklärt Sander (Ebd. S. 282 und 283). Sie zitiert in diesem Zusammenhang Kleinschmidt, der das depersonale Erzählprinzip Döblins als „produktive[...] Selbstverhüllung, markiert unter dem Stichwort des Maskenanlegens“ beschreibt, und erklärt, die „Entwicklung [in BA] besteht darin, dass die Grade der erzählerischen Depersonation bewußt sind und narrativ ausgestaltet werden“ (Sander: S. 282). Somit sieht Sander den „auktorialen Erzähler“ in Döblins Epik als „rehabilitiert“ sowie als „erkennendes und vermittelndes bzw. montierendes Medium“ (Ebd.).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitungsteil/ Vorgehensweise
- 2. Hauptteil
- 2.1 Analyse des Essays Der Bau des epischen Werks
- 2.2 Theorie und Praxis
- 2.3 Erzählerrolle in Theorie und Praxis
- 3. Schlussteil/ Fragestellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Alfred Döblins Essay "Der Bau des epischen Werks" und vergleicht ihn mit seinem Roman "Berlin Alexanderplatz". Ziel ist es, Döblins theoretische Überlegungen zur modernen Epik mit ihrer praktischen Umsetzung im Roman zu untersuchen. Die Arbeit konzentriert sich auf die inhaltliche Thematik und die Erzählerrolle im Kontext der modernen Erzähltheorie.
- Analyse von Döblins Essay "Der Bau des epischen Werks"
- Vergleich zwischen Theorie und Praxis in Döblins Werk
- Untersuchung der Erzählerrolle in Döblins Essay und Roman
- Bewertung der Übereinstimmung zwischen Döblins Theorie und Praxis
- Einordnung der Theorie in den Kontext der modernen Erzähltheorie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitungsteil/ Vorgehensweise: Die Einleitung beschreibt den Ansatz der Arbeit: Analyse von Döblins Essay "Der Bau des epischen Werks" von 1928 und dessen Vergleich mit "Berlin Alexanderplatz". Es wird die Methodik erläutert, die auf der Gegenüberstellung von Form und Inhalt des Essays und der praktischen Umsetzung in Döblins Roman basiert. Der Fokus liegt auf der inhaltlichen Thematik und der Erzählerrolle, wobei die heutige Erzähltheorie und Ziolkowskis Interpretation von "Berlin Alexanderplatz" als Grundlage dienen. Die Fragestellung, inwieweit Döblin seine eigenen Postulate erfüllt hat, wird als Leitfaden für den Schlussteil genannt.
2. Hauptteil: Dieser Teil gliedert sich in die Analyse des Essays "Der Bau des epischen Werks", die Betrachtung der Theorie und Praxis in Döblins Werk und die Untersuchung der Erzählerrolle. Er analysiert Döblins essayistischen Stil, der als unsystematisch und subjektiv beschrieben wird, im Gegensatz zu einem wissenschaftlichen Anspruch. Der Essay wird als "Grenzgänger zwischen Literatur und Wissenschaft" eingeordnet. Der Hauptteil untersucht die erzähltheoretischen Positionen des Essays und beleuchtet Döblins Ansichten zur Beziehung zwischen Autor und epischem Kunstwerk, sowie seine formalen Ansprüche an die Epik. Es wird Döblins Begründung für die Berichtform als angemessene Darstellungsweise für das epische Werk analysiert und seine Auffassung von Realität und deren Verhältnis zur epischen Darstellung diskutiert.
Schlüsselwörter
Alfred Döblin, Der Bau des epischen Werks, Berlin Alexanderplatz, Moderne Epik, Erzähltheorie, Berichtform, Realität, Autor, Romanpoetik, Essay.
Häufig gestellte Fragen zu "Analyse von Alfred Döblins Essay 'Der Bau des epischen Werks' und 'Berlin Alexanderplatz'"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Alfred Döblins Essay "Der Bau des epischen Werks" und vergleicht ihn mit seinem Roman "Berlin Alexanderplatz". Der Fokus liegt auf der Untersuchung von Döblins theoretischen Überlegungen zur modernen Epik und deren praktischer Umsetzung in seinem Roman.
Welche Aspekte werden im Einzelnen untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die inhaltliche Thematik und die Erzählerrolle in beiden Werken. Sie analysiert Döblins essayistischen Stil, seine erzähltheoretischen Positionen, seine Ansichten zur Beziehung zwischen Autor und epischem Kunstwerk, sowie seine formalen Ansprüche an die Epik. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Untersuchung der Berichtform und das Verhältnis von Realität und epischer Darstellung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Die Einleitung beschreibt den Ansatz und die Methodik der Arbeit. Der Hauptteil analysiert den Essay "Der Bau des epischen Werks", vergleicht Theorie und Praxis in Döblins Werk und untersucht die Erzählerrolle. Der Schlussteil fasst die Ergebnisse zusammen und beantwortet die Forschungsfrage, inwieweit Döblin seine eigenen Postulate erfüllt hat.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Methodik basiert auf der Gegenüberstellung von Form und Inhalt des Essays und der praktischen Umsetzung in "Berlin Alexanderplatz". Die heutige Erzähltheorie und Ziolkowskis Interpretation von "Berlin Alexanderplatz" dienen als Grundlage für die Analyse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Alfred Döblin, Der Bau des epischen Werks, Berlin Alexanderplatz, Moderne Epik, Erzähltheorie, Berichtform, Realität, Autor, Romanpoetik, Essay.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel ist es, Döblins theoretische Überlegungen zur modernen Epik mit ihrer praktischen Umsetzung im Roman "Berlin Alexanderplatz" zu untersuchen und die Übereinstimmung zwischen Theorie und Praxis zu bewerten. Die Arbeit ordnet Döblins Theorie in den Kontext der modernen Erzähltheorie ein.
Wie wird der Essay "Der Bau des epischen Werks" charakterisiert?
Der Essay wird als "Grenzgänger zwischen Literatur und Wissenschaft" beschrieben, sein Stil als unsystematisch und subjektiv, im Gegensatz zu einem wissenschaftlichen Anspruch.
Welche Rolle spielt die Erzählerrolle in der Analyse?
Die Erzählerrolle in Döblins Essay und Roman wird ausführlich untersucht und im Kontext der modernen Erzähltheorie eingeordnet. Die Analyse beleuchtet Döblins Ansichten zur Beziehung zwischen Autor und epischem Kunstwerk.
- Citar trabajo
- Dennis Bohnhorst (Autor), 2008, "Der Bau des epischen Werks" - Döblins essayistische Grundgedanken zur Epik und deren praktische Umsetzung in "Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf.", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128719