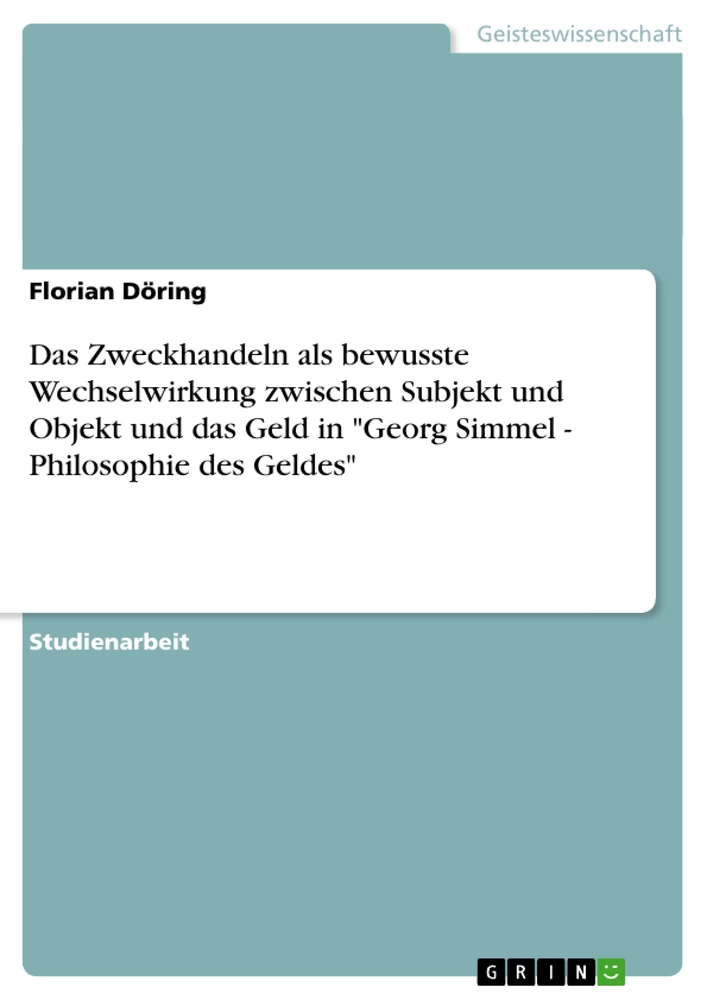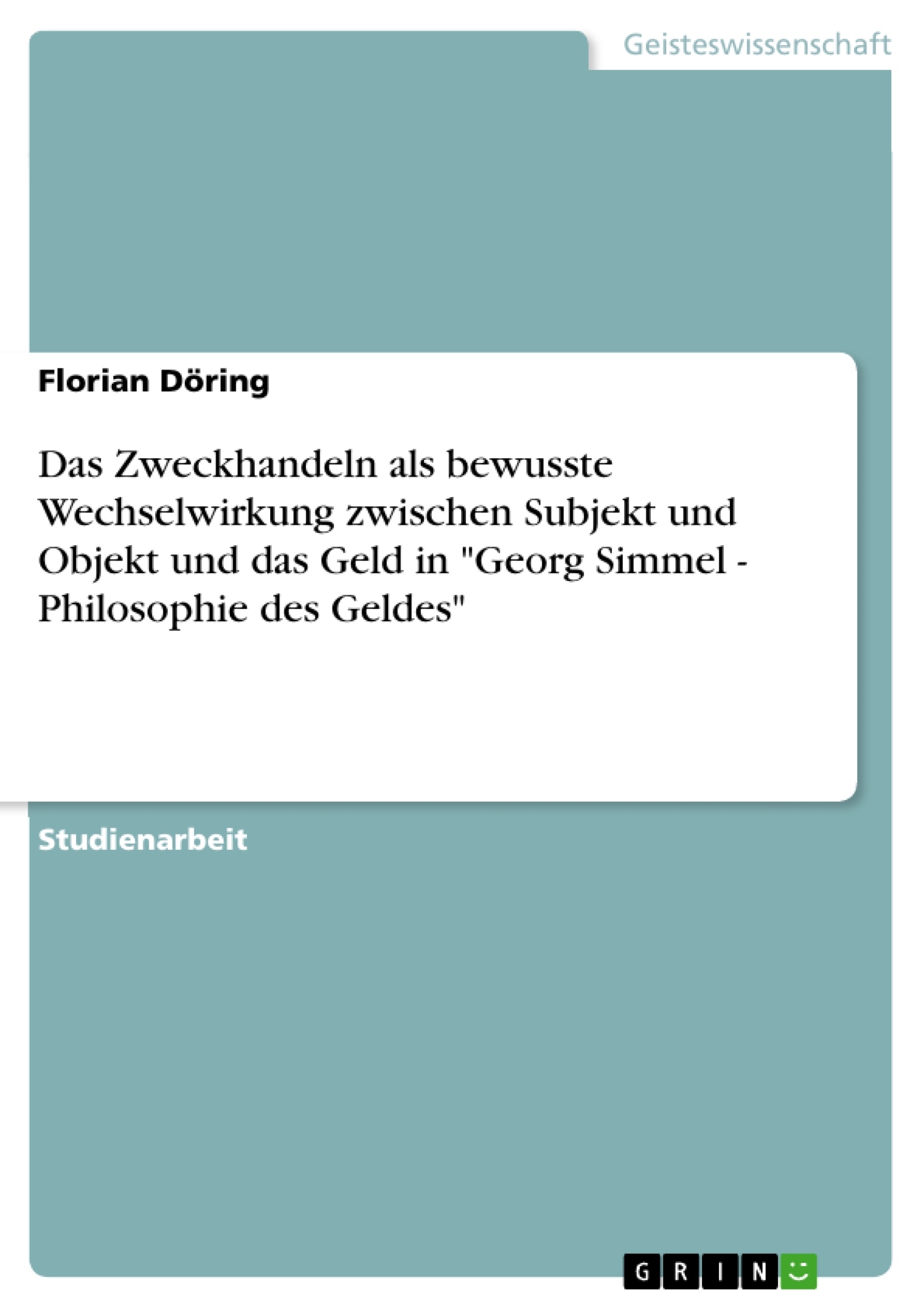Um in die Mechanismen des menschlichen Zweckhandelns einzuführen, verweist Simmel zu Beginn seiner Ausführungen des `Geldes in seinen Zweckreihen´ auf die Unterscheidung zwischen der kausalen und der teleologischen Denkrichtung. Diese Unterscheidung ist für Simmel „[d]er große Gegensatz aller Geistesgeschichte“, weil sich in ihr die Betrachtung und das Begreifen der „Inhalte der Wirklichkeit“ von ihren Ursachen oder von ihren Folgen her differenziert. Das „Urbild“ dieser Differenzierung erkennt Simmel wiederum in der Unterscheidung „unserer praktischen Motivationen“. Als kausal bezeichnet er dabei stets jene physiologischen Vorgänge, bei denen wir uns „von hinten getrieben“ fühlen, wodurch „gespannte Energien auf ihre Lösung drängen“. Dadurch, dass diese sich in eine Handlung umsetzen, tritt die Befriedigung eines Triebes ein. Die Energien erlöschen, der Trieb endet aufgrund seines Auslebens. Der Vorgang der Triebbefriedigung bleibt dabei innerhalb des tätigen Subjekts vollkommen geschlossen, denn mit der alleinigen „Aktion“, der „Umsetzung der drängenden Energien in subjektive Bewegung“ wird das „Gefühl der Spannung“, das Getriebensein behoben. Zwischen der Ursache des Handelns und seinem Resultat in der Triebbefriedigung besteht dabei für Simmel weder eine inhaltliche Gleichheit noch eine qualitative Beziehung. Demgegenüber unterscheidet sich der teleologische Triebzusammenhang vom kausalen und „primitiven Triebgefühl“ dadurch, dass wir uns „von vorn gezogen“ fühlen und somit die Ursache einer teleologischen Handlung in der „Vorstellung ihres Erfolges“ besteht. Das Gefühl der Befriedigung tritt dabei nicht durch das alleinige `Tun´ selbst ein, wie es beim kausalen Triebzusammenhang der Fall ist, sondern „durch den Erfolg, den das Tun hervorruft“. Insofern decken sich beim teleologischen Handlungszusammenhang „Ursache und Wirkung ihrem begrifflichen oder anschaulichen Inhalte nach.“ Der gedankliche Inhalt des teleologischen Triebzusammenhanges kann für Simmel jedoch nur insofern Wirklichkeit werden, als sich eine reale menschliche Energie diesem an sich „absolut kraftlos[en]“ Inhalt annimmt. Der „Kompetenzstreit zwischen Kausalität und Teleologie“ schlichtet sich für Simmel im Rahmen des menschlichen Handelns dadurch, dass „der Erfolge“ einer Handlung „seinem Inhalte“ nach seine seelische Wirksamkeit entfaltet, ohne dass er sich bereits in die „Form [...] objektive[r] Sichtbarkeit [ge]kleidet“ hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Kausaler und teleologischer Triebzusammenhang
- 2. Charakteristik des teleologisch zusammenhängenden Zweckhandelns
- 2.1 Die Länge der teleologischen Reihen
- 2.2 Das Werkzeug als das potenzierte Mittel, das Geld als das reinste Beispiel des Werkzeugs
- 3. Die Stellung des Geldes in den teleologischen Zweckreihen
- 3.1 Die Wertsteigerung des Geldes durch die Unbegrenztheit seiner Verwendungsmöglichkeiten
- 3.2 Das `Superadditum des Reichtums`
- 3.3 Gelderwerb als Einkommensquelle der Verachteten, Verfolgten und Entmachteten
- 3.4 Die Rolle des `Fremden` in Geldwirtschaft und Handel
- 3.5 Fremdenhass und Geldhass
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Simmels Philosophie des Geldes, insbesondere den Aspekt des Zweckhandelns als bewusste Wechselwirkung zwischen Subjekt und Objekt. Die Arbeit analysiert die Unterscheidung zwischen kausalem und teleologischem Handeln und beleuchtet die Rolle des Geldes in diesem Kontext.
- Kausaler vs. teleologischer Triebzusammenhang
- Charakteristik des teleologischen Zweckhandelns
- Die Stellung des Geldes in teleologischen Zweckreihen
- Die Länge teleologischer Reihen und die Rolle des Werkzeugs
- Geld und soziale Beziehungen (Fremdenhass, Reichtum)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Kausaler und teleologischer Triebzusammenhang: Simmel differenziert zwischen kausalem und teleologischem Handeln. Kausales Handeln ist triebgesteuert, die Befriedigung erfolgt durch die Handlung selbst. Teleologisches Handeln ist zielorientiert; die Befriedigung resultiert aus dem Erreichen des Ziels. Simmel veranschaulicht dies mit Beispielen wie dem Essen zur Hungerbefriedigung (kausal) im Gegensatz zum Essen aus kulinarischem Genuss (teleologisch). Diese Unterscheidung bildet die Grundlage für das Verständnis des Zweckhandelns.
2. Charakteristik des teleologisch zusammenhängenden Zweckhandelns: Dieses Kapitel beschreibt das teleologische Handeln als bewusste Wechselwirkung zwischen Subjekt und Objekt. Der Prozess beinhaltet eine Trennung von Subjekt und Objekt, deren Interaktion den Abschluss der Handlung darstellt. Simmel betont die „Wechselwirkung“ als grundlegend für menschliches Handeln. Er vergleicht das Zweckhandeln mit einer Kurve, die vom Subjekt zum Objekt und zurückführt, unterscheidet kulturelles und natürliches Handeln anhand von methodischem versus unregelmäßigem Vorgehen.
3. Die Stellung des Geldes in den teleologischen Zweckreihen: Dieses Kapitel erörtert die einzigartige Position des Geldes im teleologischen Zweckhandeln. Die unbegrenzten Verwendungsmöglichkeiten des Geldes führen zu seiner Wertsteigerung. Simmel untersucht den Geld-Erwerb als Einkommensquelle für marginalisierte Gruppen und analysiert die Rolle des „Fremden“ im Kontext von Geldwirtschaft und Handel, wobei er den Zusammenhang zwischen Fremdenhass und Geldhass beleuchtet.
Schlüsselwörter
Zweckhandeln, Kausalität, Teleologie, Georg Simmel, Philosophie des Geldes, Geld, Werkzeug, Wert, Wechselwirkung, Subjekt, Objekt, Fremdenhass, Reichtum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Simmels Philosophie des Geldes
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Georg Simmels Philosophie des Geldes, insbesondere die Rolle des Zweckhandelns und die Stellung des Geldes in diesem Kontext. Sie untersucht die Unterscheidung zwischen kausalem und teleologischem Handeln und beleuchtet die soziale Dimension des Geldes, einschließlich der Aspekte Fremdenhass und Reichtum.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Kausaler und teleologischer Triebzusammenhang; 2. Charakteristik des teleologisch zusammenhängenden Zweckhandelns; 3. Die Stellung des Geldes in den teleologischen Zweckreihen; 4. Schlussbetrachtung. Kapitel 2 wird weiter unterteilt in die Länge teleologischer Reihen und die Rolle des Werkzeugs (2.1 und 2.2), Kapitel 3 beleuchtet die Wertsteigerung des Geldes, den Gelderwerb marginalisierter Gruppen, die Rolle des "Fremden" und den Zusammenhang zwischen Fremdenhass und Geldhass (3.1 - 3.5).
Wie unterscheidet Simmel zwischen kausalem und teleologischem Handeln?
Simmel differenziert zwischen kausalem Handeln, das triebgesteuert ist und dessen Befriedigung in der Handlung selbst liegt (z.B. Essen aus Hunger), und teleologischem Handeln, das zielorientiert ist und dessen Befriedigung im Erreichen des Ziels besteht (z.B. Essen aus kulinarischem Genuss). Diese Unterscheidung ist grundlegend für das Verständnis des Zweckhandelns.
Was ist die Charakteristik des teleologischen Zweckhandelns nach Simmel?
Simmel beschreibt teleologisches Handeln als bewusste Wechselwirkung zwischen Subjekt und Objekt. Es beinhaltet eine Trennung von Subjekt und Objekt, deren Interaktion den Abschluss der Handlung darstellt. Die "Wechselwirkung" ist dabei grundlegend. Simmel vergleicht das Zweckhandeln mit einer Kurve und unterscheidet zwischen kulturellem (methodischem) und natürlichem (unregelmäßigem) Handeln.
Welche Rolle spielt das Geld in Simmels teleologischen Zweckreihen?
Das Geld nimmt eine einzigartige Stellung ein, da seine unbegrenzten Verwendungsmöglichkeiten zu seiner Wertsteigerung führen. Die Arbeit untersucht den Gelderwerb als Einkommensquelle für marginalisierte Gruppen und analysiert die Rolle des "Fremden" im Kontext von Geldwirtschaft und Handel, sowie den Zusammenhang zwischen Fremdenhass und Geldhass.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Zweckhandeln, Kausalität, Teleologie, Georg Simmel, Philosophie des Geldes, Geld, Werkzeug, Wert, Wechselwirkung, Subjekt, Objekt, Fremdenhass, Reichtum.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Arbeit untersucht Simmels Philosophie des Geldes, insbesondere den Aspekt des Zweckhandelns als bewusste Wechselwirkung zwischen Subjekt und Objekt. Sie analysiert die Unterscheidung zwischen kausalem und teleologischem Handeln und beleuchtet die Rolle des Geldes in diesem Kontext, insbesondere in Bezug auf soziale Beziehungen (Fremdenhass, Reichtum).
- Quote paper
- Diplom-Verwaltungswirt (FH) Florian Döring (Author), 2007, Das Zweckhandeln als bewusste Wechselwirkung zwischen Subjekt und Objekt und das Geld in "Georg Simmel - Philosophie des Geldes", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128746