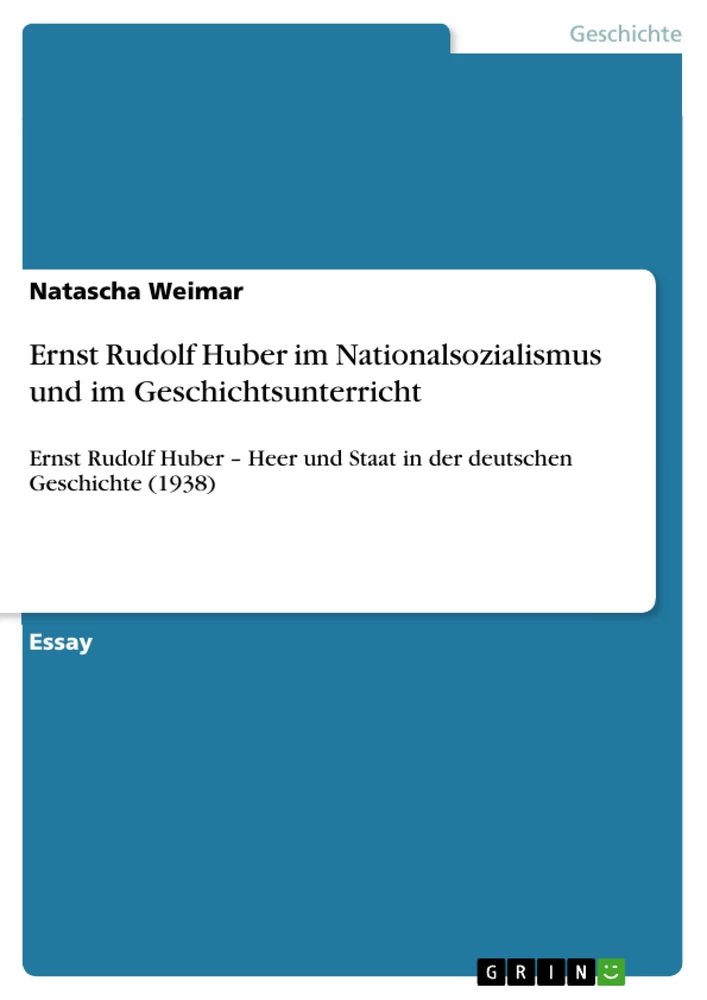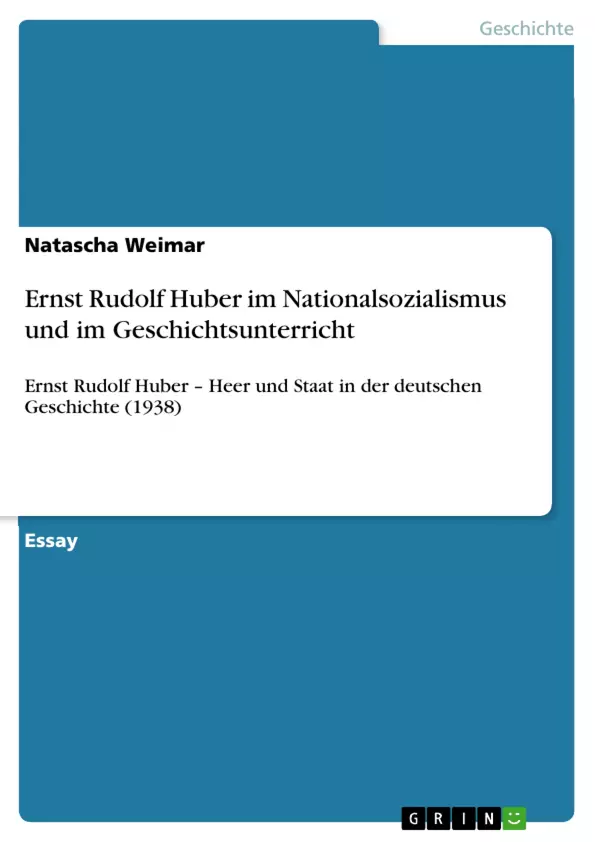Die Entnazifizierung der deutschen Elite ist ein zwar interessantes und wichtiges, dennoch meist vernachlässigtes Thema im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I und II. Auch hat sie in der Wissenschaftsgeschichte des Nationalsozialismus bisher nur zweitrangigen Charakter. Fragen wie die des Ablaufs der Reintegration in die Gesellschaft, dem Umgang mit den schlimmsten Jahren deutscher Geschichte, Schuldgefühlen und der Verarbeitung und Reflexion getroffener Entscheidungen können nur beantwortet werden, wenn man die Zeit nach 1945 unter dem Gesichtspunkt Nationalsozialismus an deutschen Schulen präsent macht. Schüler könnten leicht den falschen Eindruck gewinnen, der Nationalsozialismus endete am 8. Mai 1945 und alle Nationalsozialisten bekamen in den Nürnberger Prozessen (1945-1949) ihre gerechte Strafe. Umso schwerer kann Verständnis für die „Deutschen nach Auschwitz“ entstehen, die im ständigen Bewusstsein der Schuld und Verantwortung leben sollten. Wie kleinschrittig und mühsam dieser Weg der Entnazifizierung in Deutschland war, und wie schwer, wenn auch erfolgreich, sich dieser für die „Mittäter“ zeigte, muss mehr Beachtung beigemessen werden. Somit kann ein weiterer Beitrag gegen das Vergessen des schlimmsten Kapitels deutscher Geschichte geleistet werden. Ein exemplarischer Fall, der den Weg hinaus aus nationalsozialistischem Gedankengut in eine demokratische Gesellschaft aufzeigt, ist der eines Staatsrechtlers und Verfassungshistorikers. Im November 1944, mehr als elf Jahre nach Hitlers Machtergreifung vom 30. Januar 1933, flüchtet er mit einem kleinen Boot über den Rhein. Die Alliierten erobern zuvor das Elsass zurück, womit er seine Professur an der Reichsuniversität Straßburg verliert. In seinem Land beginnt langsam der Prozess der Entnazifizierung und ein neues Zeitalter deutscher Geschichte. Für ihn beginnt ein Entnazifizierungsverfahren, welches entscheiden soll, ob er Mitläufer oder Täter, Opfer der nationalsozialistischen Ideologie oder Mitbegründer dieser, ein ehrbar Handelnder oder zum Scheitern auf Lebenszeit verurteilter Nationalsozialist ist. Und auch er muss sich diese Fragen stellen, womit er sich nicht immer gerne befasst.
Inhaltsverzeichnis
- Ernst Rudolf Huber im Nationalsozialismus und im Geschichtsunterricht
- Ernst Rudolf Huber - Heer und Staat in der deutschen Geschichte (1938)
- Literatur
- Primärliteratur (Auswahl)
- Huber, Ernst Rudolf. Wirtschaftsverwaltungsrecht. 2 Bd. Tübingen 1932.
- Huber, Ernst Rudolf. Die Gestalt des deutschen Sozialismus. Hamburg 1934.
- Huber, Ernst Rudolf. Heer und Staat in der deutschen Geschichte. Hamburg 1938.
- Huber, Ernst Rudolf. Verfassungsrecht des Großdeutschen Reiches. 2. Auflage. Hamburg 1939.
- Huber, Ernst Rudolf. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Stuttgart 1957-1990.
- Band 1: Reform und Restauration 1789-1830. 1957.
- Band 2: Der Kampf um Einheit und Freiheit 1830-1850. 1960.
- Band 3: Bismarck und das Reich. 1963.
- Band 4: Struktur und Krisen des Kaiserreichs. 1969.
- Band 5: Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung 1914-1919. 1978
- Band 6: Die Weimarer Reichsverfassung. 1981.
- Band 7: Ausbau, Schutz und Untergang der Weimarer Republik. 1984.
- Band 8: Registerband. 1990.
- Huber, Ernst Rudolf. Nationalstaat und Verfassungsstaat. Studien zur Geschichte der modernen Staatsidee. Stuttgart 1965.
- Huber, Ernst Rudolf. Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert. Dokumente zur Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts. 5 Bd. Berlin 1973-1995.
- Huber, Ernst Rudolf. Bewahrung und Wandlung. Studien zur deutschen Staatstheorie und Verfassungsgeschichte. Berlin 1975.
- Sekundärliteratur (Auswahl)
- Böckenförde, Ernst Wolfgang (Hg.). Staatsrecht und Staatsrechtlehre im Dritten Reich. Heidelberg 1985.
- Forsthoff, Ernst (Hg.). Festschrift zum 70. Geburtstag Ernst Rudolf Hubers. Göttingen 1973.
- Grothe, Ewald. „Über den Umgang mit Zeitenwenden. Der Verfassungshistoriker Ernst Rudolf Huber und seine Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart 1933 und 1945". In: Zeitschrift der Geschichtswissenschaft (53) 2005. S. 216-235.
- Grothe, Ewald. „Eine „lautlose“ Angelegenheit? Zur Rückkehr des Verfassungshistorikers Ernst Rudolf Huber in die universitäre Wissenschaft nach 1945". In: Zeitschrift der Geschichtswissenschaft (47) 1999. S. 980-1001.
- Grothe, Ewald. Zwischen Geschichte und Recht. Deutsche Verfassungsgeschichtsschreibung 1900-1970. München 2005.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der Person Ernst Rudolf Hubers, einem umstrittenen Staatsrechtler und Verfassungshistoriker des 20. Jahrhunderts. Er analysiert Hubers Rolle im Nationalsozialismus und seine spätere Entnazifizierung. Der Essay untersucht, wie Hubers Biografie im Geschichtsunterricht verwendet werden kann, um den Nationalsozialismus und die Entnazifizierung zu beleuchten.
- Hubers politische und wissenschaftliche Entwicklung im Nationalsozialismus
- Hubers Entnazifizierung und seine Rückkehr in die akademische Welt
- Die Bedeutung von Hubers Biografie für den Geschichtsunterricht
- Die Herausforderungen der Vergangenheitsbewältigung in Deutschland
- Die Rolle von Wissenschaftlern im Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Entnazifizierung und ihrer Bedeutung für den Geschichtsunterricht. Er argumentiert, dass die Entnazifizierung ein wichtiges Thema ist, das in der Sekundarstufe I und II stärker berücksichtigt werden sollte. Der Essay stellt die Person Ernst Rudolf Huber vor und beschreibt seine politische und wissenschaftliche Entwicklung im Nationalsozialismus. Huber trat 1933 der NSDAP bei und leistete durch seine Schriften und Lehre einen Beitrag zur nationalsozialistischen Ideologie. Nach 1945 wurde er im Entnazifizierungsverfahren als „Mitläufer" eingestuft und konnte erst nach einigen Jahren wieder in die akademische Welt zurückkehren. Der Essay analysiert Hubers Werk „Heer und Staat in der deutschen Geschichte" und zeigt, wie Huber in seinen Schriften nationalsozialistische Ideologien vertrat. Er beleuchtet auch Hubers spätere Versuche, sich von seiner nationalsozialistischen Vergangenheit zu distanzieren. Der Essay schließt mit einer Diskussion über die Bedeutung von Hubers Biografie für den Geschichtsunterricht. Er argumentiert, dass Hubers Geschichte ein wertvolles Beispiel dafür ist, wie Wissenschaftler im Nationalsozialismus agierten und wie die Entnazifizierung in Deutschland ablief. Der Essay betont die Bedeutung der Vergangenheitsbewältigung und die Notwendigkeit, die Geschichte des Nationalsozialismus und der Entnazifizierung im Geschichtsunterricht zu behandeln.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Ernst Rudolf Huber, Nationalsozialismus, Entnazifizierung, Geschichtsunterricht, Vergangenheitsbewältigung, deutsche Geschichte, Staatsrecht, Verfassungsgeschichte, Weimarer Republik, „Mitläufer", „Täter", „Opfer", „Resozialisierung", „Heer und Staat in der deutschen Geschichte", „Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789".
- Citation du texte
- Natascha Weimar (Auteur), 2009, Ernst Rudolf Huber im Nationalsozialismus und im Geschichtsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128818