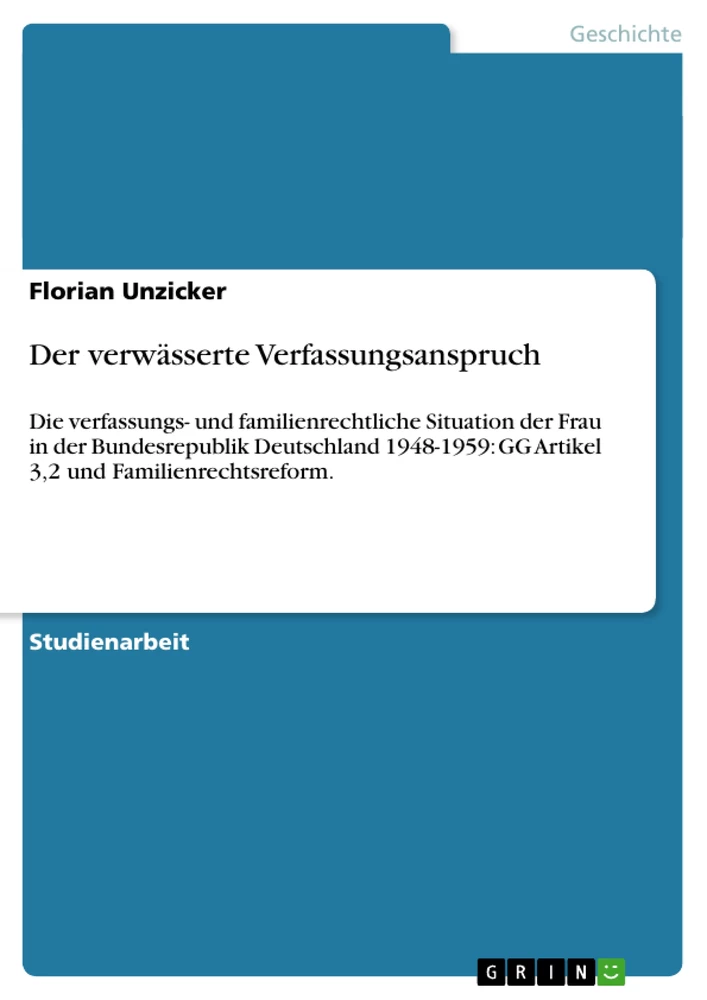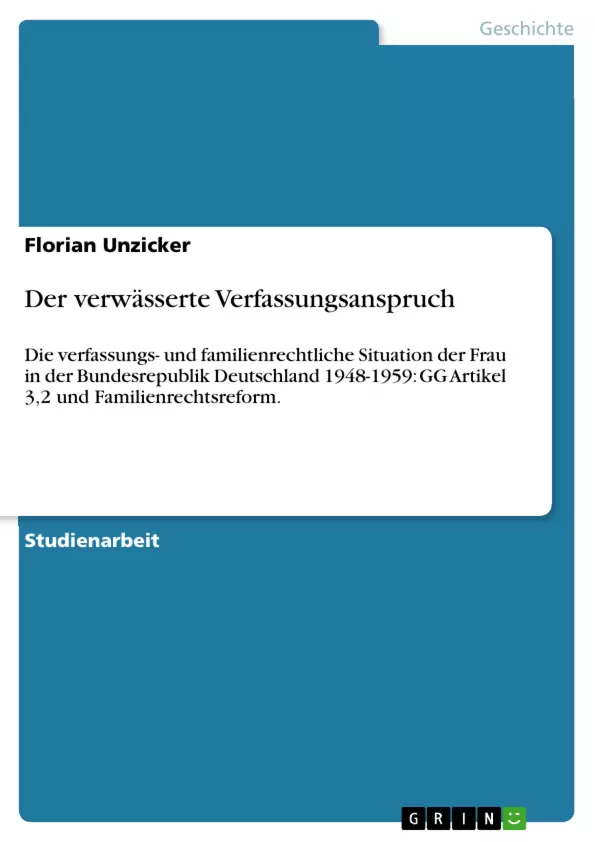Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn offiziell verkündet. In Abstimmung mit den Alliierten hatten die Abgeordneten des Parlamentarischen Rates damit den Rahmen geschaffen „für die freieste Demokratie, die je auf deutschem Boden existiert hat.“ Im Grundrechtsteil findet sich unter Artikel 3,2 die Aussage „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Diese fünf sich in ihrer Formulierung recht unspektakulär ausnehmenden Worte markierten einen bahnbrechenden Fortschritt für die rechtliche Stellung der Frau und hatten in den Verhandlungen des Parlamentarischen Rates zu einer recht scharfen Kontroverse geführt. Niemals zuvor waren den deutschen Frauen derart weitreichende Rechte garantiert worden, wie in der Verfassung der jungen Republik. Im Grundgesetz war man damit einen entscheidenden Schritt weiter gegangen als in seinem verfassungsrechtlichen Vorgänger, der Weimarer Reichsverfassung von 1919, die Frauen zwar das aktive und passive Wahlrecht zugestanden hatte, ihre durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) fixierte niedere zivilrechtliche Stellung jedoch unangetastet ließ. Der Gleichberechtigungsartikel des Grundgesetzes – und hier liegt die entscheidende Verbesserung – erweiterte die Gleichstellung der Geschlechter auf alle Rechtsbereiche. Sie war unmittelbar geltendes Recht geworden, an das Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtssprechung gebunden waren, das allerdings aus praktischen Gründen durch eine Übergangsregelung ergänzt wurde.
Mit der angesprochenen verfassungs- und familienrechtlichen Stellung der Frau in der frühen Phase der Bundesrepublik Deutschland möchte sich diese Arbeit befassen. Als zeitlicher Rahmen wurde der Zeitraum zwischen dem Kriegsende und dem Ende der Ära Adenauer gewählt, wobei der Schwerpunkt der Betrachtung jedoch eindeutig auf der Dekade zwischen den Verhandlungen zur Entstehung unseres Grundgesetzes 1948/49 und dem Abschluss der Debatte um die Familienrechtsreform 1958/59 liegen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Stand der Forschung
- Die Situation der Frau in der unmittelbaren Nachkriegszeit
- Gleichberechtigung und Grundgesetz
- Weimarer Reichsverfassung und BGB von 1900
- Der Verfassungskonvent von Hohenchiemsee
- Die Verhandlungen im Ausschuss für Grundsatzfragen
- Die Verhandlungen im Hauptausschuss
- Öffentlicher Protest und Einlenken der Union
- Der lange Weg zum Gleichberechtigungsgesetz
- Schlussbetrachtung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der verfassungs- und familienrechtlichen Situation der Frau in der frühen Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im Zeitraum zwischen dem Kriegsende und dem Ende der Ära Adenauer. Sie untersucht die Entstehung des Gleichberechtigungsartikels 3,2 im Grundgesetz und die Umsetzung dieses Verfassungsanspruchs in den ersten zehn Jahren der Bundesrepublik.
- Die Entstehung des Gleichberechtigungsartikels 3,2 im Grundgesetz
- Die Umsetzung des Gleichberechtigungsartikels in der Praxis
- Die Rolle der Regierung und Verwaltung in der Umsetzung des Gleichberechtigungsartikels
- Die Bedeutung des Gleichberechtigungsartikels für die heutige Zeit
- Die Herausforderungen der Gleichberechtigung in der frühen Bundesrepublik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz der Untersuchung der verfassungs- und familienrechtlichen Situation der Frau in der frühen Bundesrepublik. Sie stellt den zeitlichen Rahmen der Arbeit dar und benennt die beiden zentralen Themenkomplexe: die Entstehung des Gleichberechtigungsartikels 3,2 im Grundgesetz und die Umsetzung dieses Artikels in der Praxis.
Der zweite Abschnitt beleuchtet den Stand der Forschung zum Thema Gleichberechtigung in der frühen Bundesrepublik. Er zeigt auf, dass die Forschung lange Zeit die innenpolitischen Dimensionen der Ära Adenauer vernachlässigt hat, insbesondere die Frage nach dem rechtlichen Verhältnis der Geschlechter. Erst in den späten 1970er und 1980er Jahren, angestoßen von der Neuen Frauenbewegung, wurde die Stellung der Frau in der jüngeren deutschen Geschichte wissenschaftlich thematisiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Situation der Frau in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Es analysiert die demographischen Verschiebungen der Nachkriegszeit und die daraus resultierende Erschütterung des traditionellen Rollenverständnisses.
Das vierte Kapitel untersucht die Entstehung des Gleichberechtigungsartikels 3,2 im Grundgesetz. Es analysiert die Verhandlungen des Parlamentarischen Rates und die Kontroversen, die sich um die Formulierung des Artikels ergaben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das Grundgesetz, die Familienrechtsreform, die Situation der Frau in der Bundesrepublik Deutschland, die Nachkriegszeit, die Entstehung des Gleichberechtigungsartikels 3,2, die Umsetzung des Gleichberechtigungsartikels in der Praxis, die Rolle der Regierung und Verwaltung, die Herausforderungen der Gleichberechtigung, die feministische Forschung und die Geschichte der Frauenbewegung.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde die Gleichberechtigung im Grundgesetz verankert?
Der Artikel 3, Absatz 2 („Männer und Frauen sind gleichberechtigt“) wurde mit der Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 offiziell wirksam.
Warum war die Umsetzung des Artikels 3,2 so schwierig?
Obwohl die Verfassung die Gleichberechtigung garantierte, blieben viele diskriminierende Bestimmungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) bis zur Familienrechtsreform Ende der 50er Jahre in Kraft.
Was unterschied das Grundgesetz von der Weimarer Reichsverfassung?
Die Weimarer Verfassung gab Frauen zwar das Wahlrecht, ließ aber ihre zivilrechtliche Unterordnung im BGB unangetastet, während das Grundgesetz die Gleichstellung auf alle Rechtsbereiche erweiterte.
Welche Rolle spielte der öffentliche Protest 1948/49?
Massiver öffentlicher Protest von Frauenverbänden zwang die Abgeordneten des Parlamentarischen Rates dazu, die klare Formulierung zur Gleichberechtigung gegen Widerstände aufzunehmen.
Was war der Inhalt des Gleichberechtigungsgesetzes von 1958?
Es war der erste große Schritt zur Anpassung des Familienrechts an das Grundgesetz, auch wenn es noch Kompromisse (wie das Letztentscheidungsrecht des Mannes in bestimmten Fällen) enthielt.
- Citation du texte
- Florian Unzicker (Auteur), 2007, Der verwässerte Verfassungsanspruch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128954