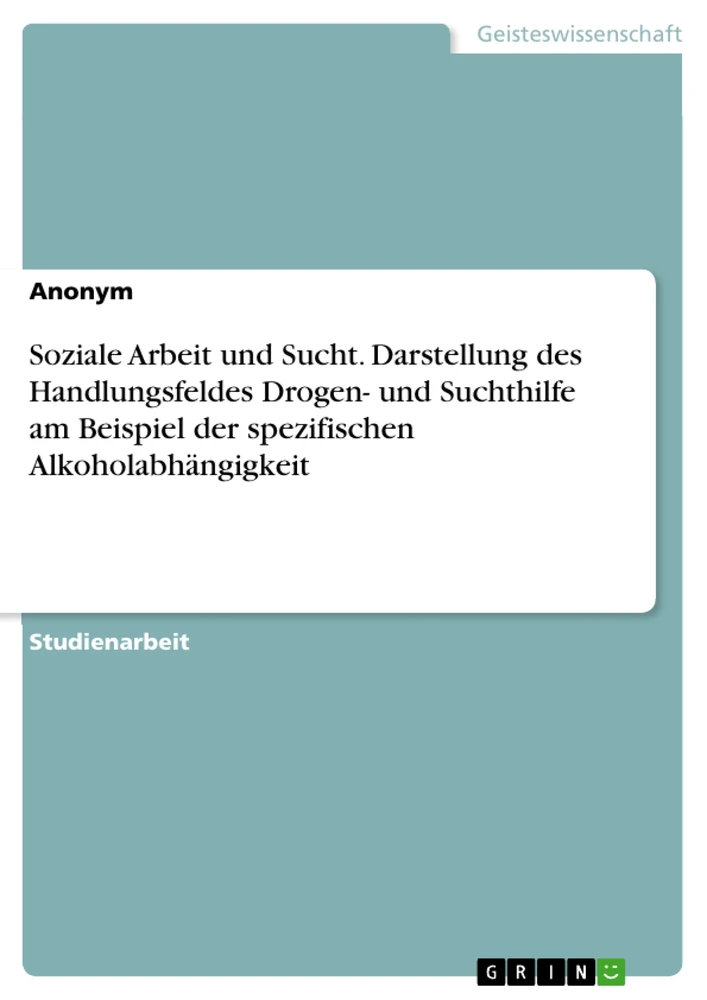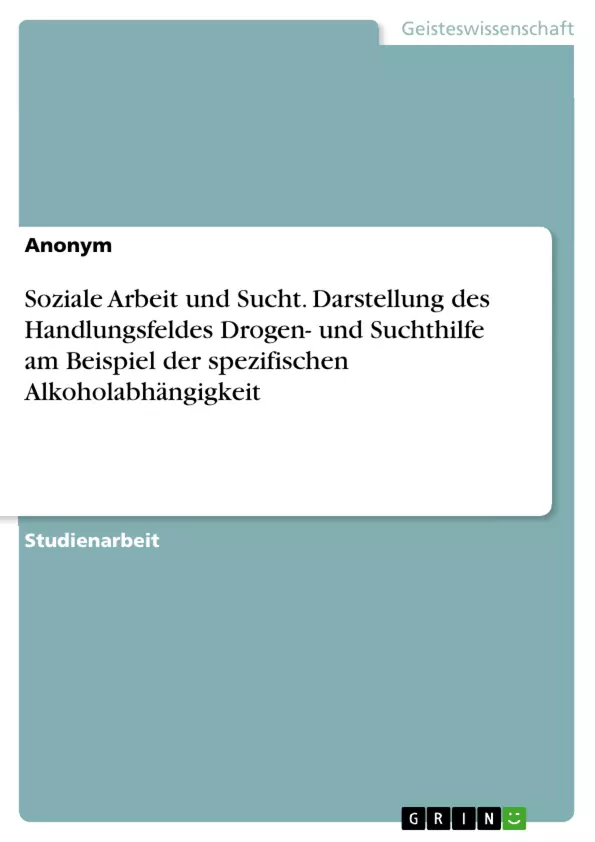Ziel dieser Arbeit ist es, einen ganzheitlichen Blick auf den Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft zu richten und folgender Fragestellung nachzugehen: Was ist die zentrale Rolle der Sozialen Arbeit im multidisziplinären Suchthilfesystem und welche gesellschaftspolitischen Änderungen sind erforderlich, um das Problemverhalten Alkohol zu bewältigen bzw. zu verändern?
Seit 1968 ist Sucht in Deutschland als Krankheit anerkannt. Durch die Verankerung im Diagnosemanual der International Classification of Diseases (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) können Behandlungsansprüche abgeleitet und durchgesetzt werden. Um einer Stigmatisierung und Ausgrenzung Betroffener entgegenzuwirken, hat die WHO in der Neufassung ICD-11 in 2019 den Begriff Sucht durch Abhängigkeit ersetzt, dennoch dominiert im multidisziplinären Suchthilfesystem die Vorstellung von einem klassischen Krankheitsbild, das vorrangig durch Ärzte und Psychologen behandelt wird. Die weitreichende Dimension der Alkoholabhängigkeit, die weit über Diagnose und Diagnostik hinausgeht, kann damit jedoch nicht erfasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Handlungsfeld Drogen- und Suchthilfe
- Alkoholabhängigkeit
- Trägerschaft, Einrichtungsstruktur und Professionsfeld
- Soziale Arbeit als Expertin der sozialen Dimension
- Soziale Arbeit als Hauptakteurin in der ambulanten Suchthilfe
- Angebote und Tätigkeitsschwerpunkte
- Kompetenzprofil von Fachkräften der Sozialen Arbeit
- Der gesellschaftspolitische Stellenwert von Alkohol als zentrale Herausforderung
- Das Ungleichgewicht von Verhaltensprävention und Verhältnisprävention
- Prävention im Spannungsfeld von Wirtschafts- und Gesundheitsinteressen
- Prävention im Spannungsfeld von Bevormundung und Selbstbestimmung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rolle der Sozialen Arbeit im multidisziplinären Suchthilfesystem und den gesellschaftspolitischen Herausforderungen im Kontext der Alkoholabhängigkeit. Sie analysiert die spezifischen Aufgaben und Kompetenzen der Sozialen Arbeit im Umgang mit der Alkoholabhängigkeit und beleuchtet die Spannungsfelder, die sich aus dem gesellschaftspolitischen Stellenwert des Alkohols ergeben.
- Die zentrale Rolle der Sozialen Arbeit im Suchthilfesystem
- Die Relevanz der Alkoholabhängigkeit als gesellschaftliches Problem
- Die Bedeutung der Prävention im Bereich des Alkoholkonsums
- Die Spannungsfelder zwischen Wirtschaftsinteressen, Gesundheitsinteressen und der individuellen Selbstbestimmung
- Die Herausforderungen der Suchtbehandlung und -prävention im Kontext der gesellschaftlichen Akzeptanz von Alkohol
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über die Problematik des Alkoholkonsums in Deutschland und stellt die Relevanz der Thematik heraus. Das zweite Kapitel definiert die Alkoholabhängigkeit und beschreibt die Struktur des Suchthilfesystems. Das dritte Kapitel fokussiert auf die spezifische Rolle und Expertise der Sozialen Arbeit im Umgang mit Alkoholabhängigkeit. Im vierten Kapitel werden Angebote und Tätigkeitsschwerpunkte der Sozialen Arbeit in der Suchthilfe präsentiert und die dafür notwendigen Kompetenzprofile der Fachkräfte beleuchtet. Der fünfte Kapitel befasst sich mit dem gesellschaftspolitischen Stellenwert von Alkohol und den Herausforderungen, die sich daraus für die Suchtbehandlung und -prävention ergeben.
Schlüsselwörter
Alkoholabhängigkeit, Suchtprävention, Verhältnisprävention, Suchthilfesystem, Soziale Arbeit, Kompetenzprofile, gesellschaftspolitischer Stellenwert, Alkoholkonsum, Stigmatisierung, Selbstbestimmung, Bevormundung.
Häufig gestellte Fragen
Ist Alkoholabhängigkeit in Deutschland offiziell als Krankheit anerkannt?
Ja, bereits seit 1968 ist Sucht in Deutschland als Krankheit anerkannt, was Betroffenen einen Anspruch auf Behandlung ermöglicht.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit in der Suchthilfe?
Die Soziale Arbeit gilt als Expertin für die soziale Dimension der Abhängigkeit und ist eine Hauptakteurin, insbesondere in der ambulanten Suchthilfe.
Was ist der Unterschied zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention?
Verhaltensprävention zielt auf das Individuum ab, während Verhältnisprävention die gesellschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen (z.B. Verfügbarkeit von Alkohol) verändern will.
Warum hat die WHO den Begriff "Sucht" durch "Abhängigkeit" ersetzt?
Die Neufassung der ICD-11 im Jahr 2019 nutzt den Begriff Abhängigkeit, um einer Stigmatisierung und Ausgrenzung Betroffener entgegenzuwirken.
Welche gesellschaftspolitischen Spannungsfelder gibt es beim Thema Alkohol?
Es besteht ein Konflikt zwischen Wirtschaftsinteressen (Alkoholindustrie), Gesundheitsinteressen und dem Recht auf individuelle Selbstbestimmung.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Soziale Arbeit und Sucht. Darstellung des Handlungsfeldes Drogen- und Suchthilfe am Beispiel der spezifischen Alkoholabhängigkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1290047