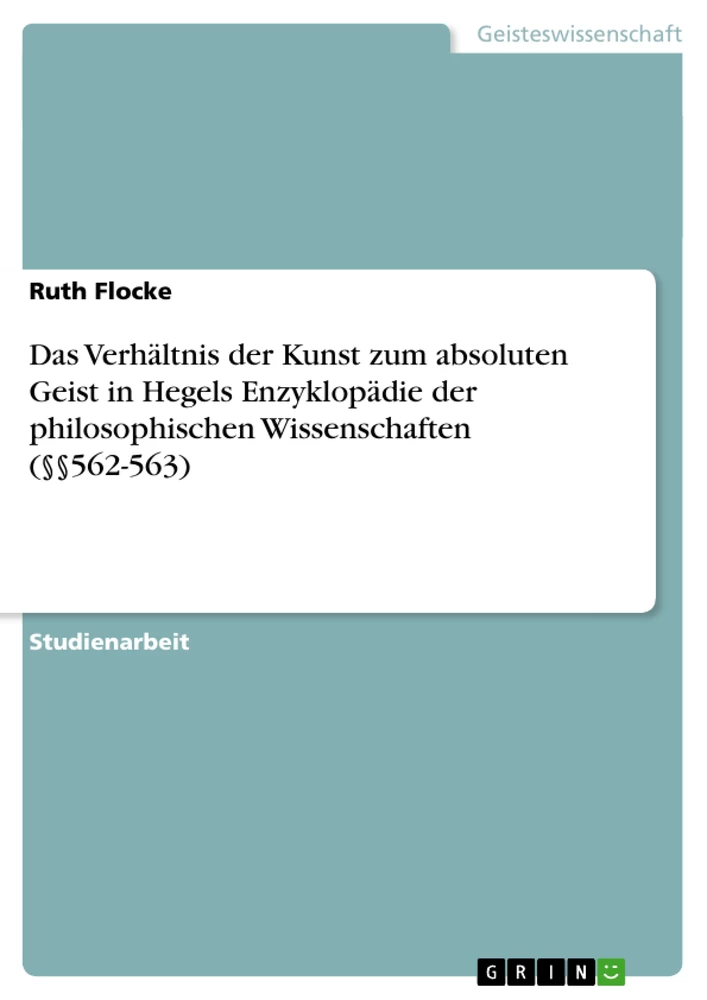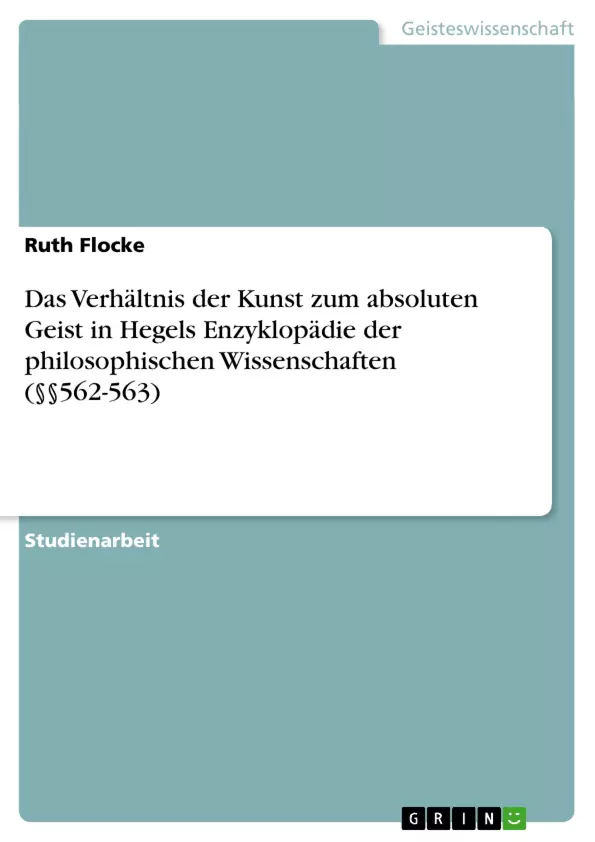In den Paragraphen §§556-563 legt Hegel in knapper Form die wesentlichen Gedanken seiner Philosophie der Kunst dar. Kunst sei dabei die erste Stufe auf dem Weg zu Selbsterkenntnis des Absoluten. Dabei führt er die geistesgeschichtliche Bedeutung der Kunst auf.
Kunst sei die Form, in der der absolute Geist sich selbst erfasse und zur Anschauung bringe. Hegel versteht die Kunst als Moment des absoluten Geistes. Der Sinn der Kunst sei, dass die Wahrheit in ihr ans Licht komme, jedoch könne die Art, in der die Kunst die Wahrheit zeige, durch die Gebundenheit der Kunst an bestimmte Gestaltungsweisen und den geschichtlichen Kontext, bloß eine unangebrachte sein, sie sei nur ein Anfang der in der Religion weitergeführt werden könne. Denn die unmittelbar schöne Gestalt der Kunst könne lediglich das Dasein des Göttlichen realisieren. So könne, nach Hegel, die Kunst das Absolute nur anschauen, nicht denken oder wissen. Kunst sei weder der angemessene Ausdruck für ihren Inhalt, noch vermöge sie die volle Wirklichkeit als Inhalt zu fassen. Die Kunst bleibe als greifbare Inhaltlichkeit geschichtlich und kulturell eingeschränkt, weil die schöne Gestalt, ihr Ideal, „nur das angeschaute bzw. vorgestellte Sein des absoluten Geistes“ sei (Hegels EPW, Seite 353). „Es ist die Absolutheit des absoluten Geistes und damit die vollendete Wahrheit, die eine vollendete Kunst verhindert und zwar dadurch verhindert, dass sie sich einer angemessenen Darstellung im sinnlichen Material entzieht.“ (Hegels Lehre vom absoluten Geist, Seite 206)
Inhaltsverzeichnis
- Gliederung
- Kunst in der EPW
- Exegese
- §562
- §563
- Quellen
- 1. Kunst in der EPW
- 2. Exegese
- §562
- §563
- 3. Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat analysiert Hegels Ausführungen zur Kunst im Kontext seiner Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, insbesondere die Paragraphen §§562-563. Es untersucht die Beziehung der Kunst zum absoluten Geist und die drei Kunstformen (symbolische, klassische und romantische Kunst) im Rahmen der Hegelschen Philosophie.
- Die Rolle der Kunst als erste Stufe auf dem Weg zur Selbsterkenntnis des Absoluten
- Die Beziehung der Kunstformen zum absoluten Geist
- Die Kritik an der Kunst als Ausdruck der Endlichkeit
- Die Überwindung der Kunst durch die Religion
- Die drei Kunstformen: symbolische, klassische und romantische Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Das Referat beginnt mit einer kurzen Einführung in Hegels Philosophie der Kunst, die in den Paragraphen §§556-563 der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften dargelegt wird. Hegel betrachtet die Kunst als das erste Moment des absoluten Geistes, in dem er sich selbst erfasst und zur Anschauung bringt. Die Kunst kann jedoch die Wahrheit nur anschauen, nicht denken oder wissen, da sie an bestimmte Gestaltungsweisen und den geschichtlichen Kontext gebunden ist. Die griechische Kunst, die Hegel als Ideal betrachtet, zeichnet sich durch die Angemessenheit von Idee und Gestaltung aus. Sie erreicht eine „gelungene Gestalt im Sinne einer adäquaten, harmonischen In-Eins-Bildung von Form und Inhalt" (Hegels EPW, Seite 353). Die Kritik an der Kunst kann auch als Kritik an der griechischen Religion verstanden werden, da die Kunst von religiösen Vorstellungen getragen wird. Hegel weist auf die Überwindungsbedürftigkeit der schönen Gestalt hin und zeigt, dass die wahre Idee nur in der Unendlichkeit der Gottmenschlichkeit zum Ausdruck kommt.
In §562 stellt Hegel die drei geistesgeschichtlichen Kunstformen (symbolische, klassische und romantische Kunst) in einen Zusammenhang mit dem absoluten Geist. Die klassische Kunst, die Hegel als Ideal betrachtet, erreicht die „gelungene Gestalt" durch die Angemessenheit von Idee und Gestaltung. Die symbolische Kunst ist hingegen unangemessen, da sie das Ideal noch nicht hervorbringen kann, während die romantische Kunst das Ideal überschreitet. Die Unangemessenheit der romantischen und der symbolischen Kunst ist völlig entgegengesetzt. Während die Symbolik im Erstreben des Ideals besteht, es aber noch nicht hervorbringen kann, überschreitet die Romantik das Ideal wieder, lässt das Ideal hinter sich, das die griechische bzw. klassische Kunst erreicht hatte.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Kunst, den absoluten Geist, die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Hegel, die drei Kunstformen (symbolische, klassische und romantische Kunst), die griechische Kunst, die Religion, die Endlichkeit, die Überwindung, die Gottmenschlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Kunst in Hegels Philosophie?
In Hegels Enzyklopädie ist die Kunst die erste Stufe des absoluten Geistes. Sie dient der Selbsterkenntnis des Absoluten, indem sie die Wahrheit zur Anschauung bringt.
Was sind die drei Kunstformen nach Hegel?
Hegel unterscheidet die symbolische Kunst (Suche nach dem Ideal), die klassische Kunst (adäquate In-Eins-Bildung von Form und Inhalt) und die romantische Kunst (Überschreitung des Ideals).
Warum kann die Kunst das Absolute laut Hegel nur "anschauen"?
Die Kunst ist an sinnliches Material und den geschichtlichen Kontext gebunden. Daher kann sie das Absolute nur bildhaft darstellen, aber nicht rein gedanklich fassen, wie es die Religion oder Philosophie tut.
Warum gilt die griechische Kunst für Hegel als Ideal?
In der klassischen griechischen Kunst findet Hegel die vollendete Harmonie zwischen der göttlichen Idee und der sinnlichen Gestaltung (Gottmenschlichkeit).
Wie wird die Kunst durch die Religion überwunden?
Da die sinnliche Form der Kunst für die vollendete Wahrheit des Geistes irgendwann unzureichend wird, setzt sich der Prozess der Selbsterkenntnis in der Religion fort, die über die bloße Anschauung hinausgeht.
- Quote paper
- Ruth Flocke (Author), 2009, Das Verhältnis der Kunst zum absoluten Geist in Hegels Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (§§562-563), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129005