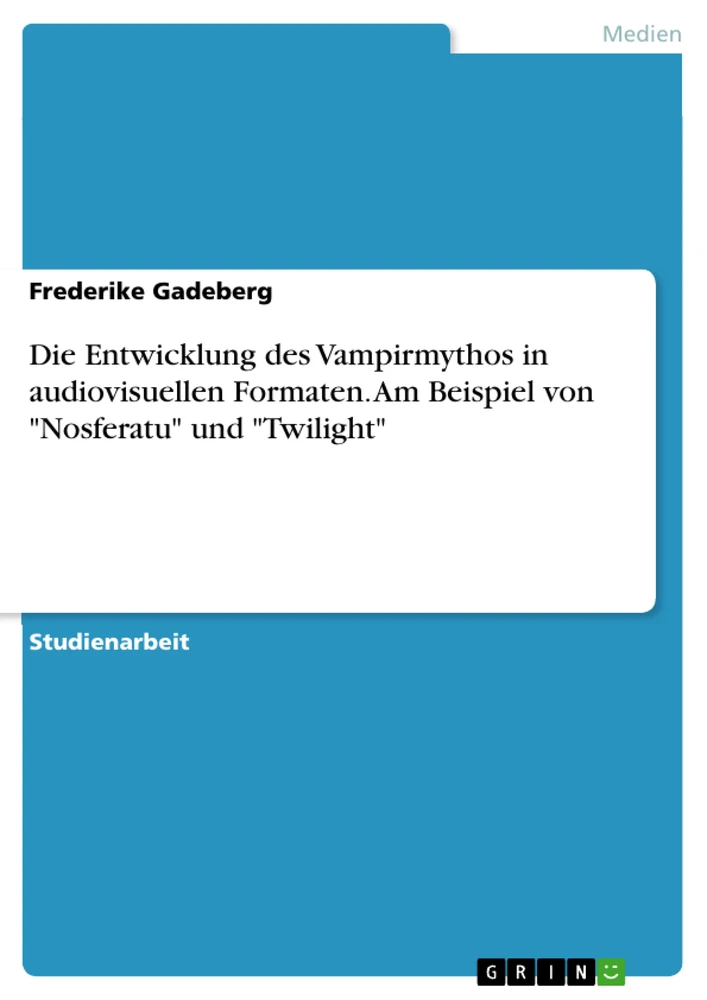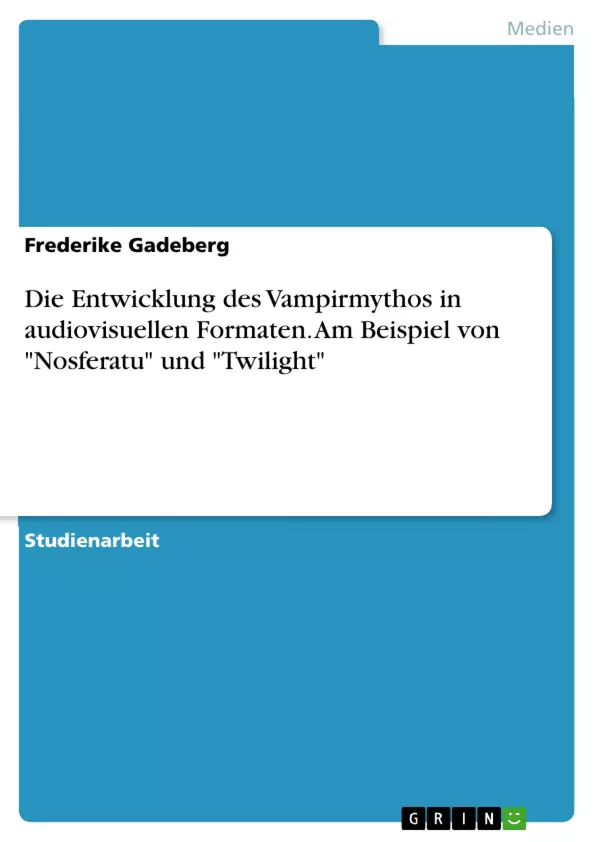Neben kulturwissenschaftlichen, gendertheoretischen oder beispielsweise rezeptionsanalytischen Fragestellungen ist Dreh- und Angelpunkt gegenwärtiger Verhandlungen mit dem Vampirismus die Analyse der Entwicklung eines Mythos. Die These lautet – Bram Stokers Dracula als Ausgangspunkt nehmend – dass sich der Mythos um die Vampirfigur gewandelt hat: Gilt die Figur des Vampirs in seinen Anfängen noch als bösartiges Monster, fungiert der Vampir in heutigen Mainstream-Produktionen als Identifikationsfigur.
Dieser Text möchte einen Beitrag zum Diskurs leisten, indem die von der Fachliteratur häufig aufgestellte These untersucht wird. Bei dieser Untersuchung bezieht sich die Arbeit auf zwei audiovisuelle Formate, "Nosferatu – eine Symphonie des Grauens" von 1922 und die knapp 90 Jahre später erschienene Roman-Verfilmung "Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen". Einleitend soll die Figur des "Vampirs" kurz definiert werden und noch einmal die aufgestellte These anhand von Sekundärliteratur erläutert und begründet werden. Daraufhin wird dargelegt, auf welche ausgewählten Momente sich die Analyse und der Vergleich beziehen. Nach der Durchführung beider Verfahren wird erneut ein Bogen zur These geschlagen, um die Ergebnisse im abschließenden Kapitel zusammenzufassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie und Methodik
- Analyse der Vampirdarstellung
- Primärwerk «Nosferatu»
- Primärwerk «Twilight»
- Gegenüberstellung
- Fazit und Reflexion
- Film- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Entwicklung des Vampirmythos in audiovisuellen Formaten. Die Arbeit analysiert, inwieweit sich die Figur des Vampirs vom Monster zur Identifikationsfigur entwickelt hat. Hierfür werden die beiden Filme "Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens" (1922) und "Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen" (2008) herangezogen.
- Entwicklung des Vampirmythos in audiovisuellen Formaten
- Transformation der Vampirfigur vom Monster zur Identifikationsfigur
- Analyse von "Nosferatu" und "Twilight" im Kontext des Vampirmythos
- Vergleich der Vampirdarstellungen in beiden Filmen
- Einbezug von kulturwissenschaftlichen, gendertheoretischen und rezeptionsanalytischen Aspekten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Vampirmythos in den Kontext der literarischen und audiovisuellen Kultur und erläutert die These, dass sich der Vampir vom bösartigen Monster zur Identifikationsfigur entwickelt hat. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen und methodischen Grundlagen der Arbeit, wobei insbesondere die Vielschichtigkeit des Vampirmotivs und seine stetige Entwicklung über die Jahrhunderte herausgestellt werden. Die Analyse der Primärwerke im Kapitel 3 fokussiert auf die ästhetische Darstellung der Vampire in "Nosferatu" und "Twilight", ihr Verhältnis zur menschlichen Gesellschaft, ihre Subjektivierung und die narrative Komplexität der jeweiligen Filme.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind der Vampirmythos, die Entwicklung der Vampirfigur, die Analyse von audiovisuellen Formaten, "Nosferatu", "Twilight", Kulturwissenschaft, Gendertheorie, Rezeptionsanalyse, Identifikationsfigur, Monster.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Figur des Vampirs im Film gewandelt?
Die Figur entwickelte sich vom bösartigen, monströsen Außenseiter (wie in Nosferatu 1922) hin zu einer romantisierten Identifikationsfigur für das Publikum (wie in Twilight 2008).
Was charakterisiert die Vampirdarstellung in "Nosferatu"?
In Murnaus Klassiker wird der Vampir als grauenvolles, tierhaftes Monster dargestellt, das Tod und Verderben bringt und rein als Bedrohung fungiert.
Warum gilt der Vampir in "Twilight" als Identifikationsfigur?
Durch die Subjektivierung und die Darstellung emotionaler Konflikte sowie einer moralischen Entwicklung wird der Vampir vermenschlicht und für ein modernes Mainstream-Publikum attraktiv.
Welche Rolle spielen Gendertheorie und Kulturwissenschaft bei der Analyse?
Diese Ansätze helfen zu verstehen, wie der Vampirmythos gesellschaftliche Ängste, Sehnsüchte und Rollenbilder der jeweiligen Entstehungszeit (1920er vs. 2000er) widerspiegelt.
Welche Bedeutung hat Bram Stokers "Dracula" für diese Entwicklung?
Stokers Roman dient als literarischer Ausgangspunkt, von dem aus sich die verschiedenen audiovisuellen Interpretationen und Transformationen des Mythos ableiten lassen.
- Citation du texte
- Frederike Gadeberg (Auteur), 2018, Die Entwicklung des Vampirmythos in audiovisuellen Formaten. Am Beispiel von "Nosferatu" und "Twilight", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1290053