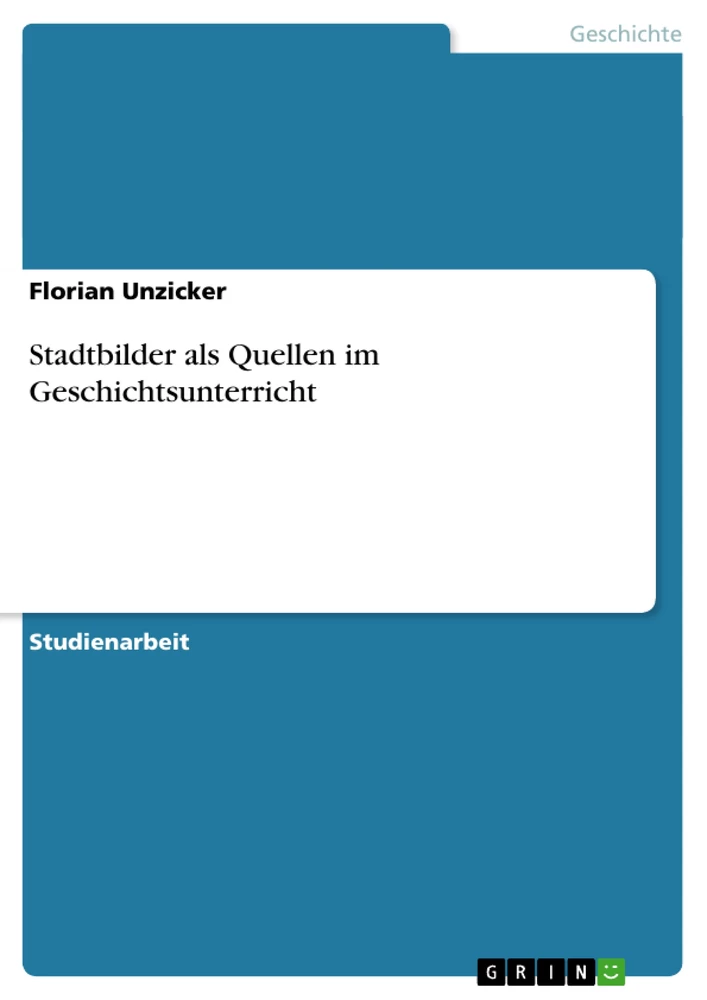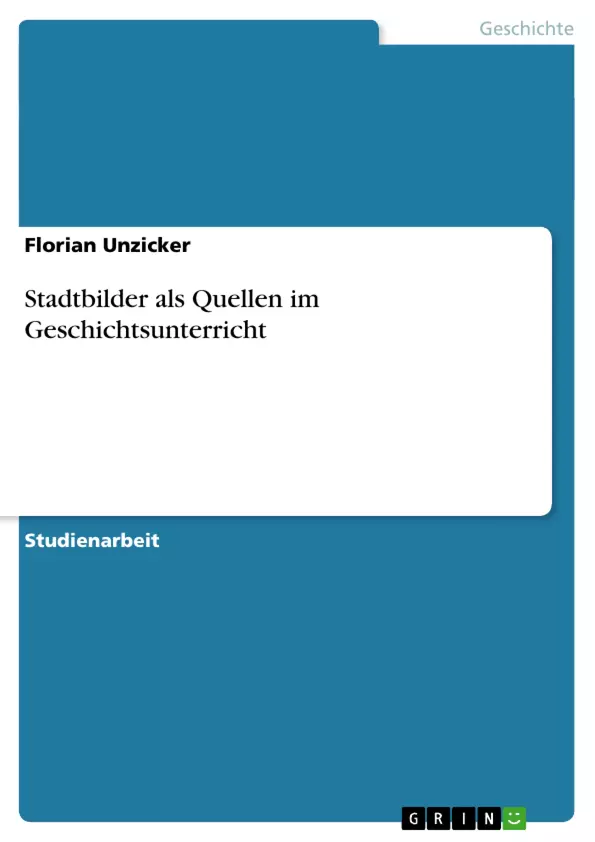Der Begriff Stadtbild ist definiert als der optische Eindruck einer Stadt beziehungsweise ihrer Teile. Bereits die frühesten orientalischen Kulturen haben Städte hervorgebracht, so finden sich auch seit jeher Abbildungen von Städten in der Kunst wieder.
In der Frühzeit meist mit symbolisch-allegorischem Gehalt aufgeladen, im Mittelalter in Abbildungen vielfach der Tradition des Himmlischen Jerusalem aus der Offenbarung des Johannes verhaftet, wird die Stadt seit dem Beginn der frühen Neuzeit zunehmend in ihren topographischen und architektonischen Eigenheiten abgebildet und spätestens seit der Vedutenmalerei des 17. und 18.Jahrhunderts zum eigenen künstlerischen Gegenstand.
In ihrer Geschichte verzeichnete die europäische Stadt zwei markante Entwicklungsschübe. Zum Einen ist dies die Stadtwerdung, die Entstehung der europäischen Stadtkultur des Mittelalters ab dem 11.Jahrhundert, an deren Ende die spätmittelalterliche Stadt als ein in sich selbst Genüge findender, politischer und sozialer „Mikrokosmos“ steht. Zum Anderen ist dies die Entstehung der modernen europäischen Großstadt im Zuge der Industriellen Revolution. Diese beiden Sachverhalte verdienen eine nähere Betrachtung im Geschichtsunterricht. Dabei ist die Beschäftigung mit dem Themenbereich Stadt für die SuS bedeutsam, da – die meisten von ihnen leben heute in Städten – sie Teil ihrer alltäglichen Lebenswelt ist und so treffen sie in den Stadtkernen, „sofern nicht Gründerzeit, Bombenkrieg und Wirtschaftswunder bzw. DDR-Sozialismus [...] allzu viel zerstört haben“, fast alltäglich auf bauliche Substanz des Mittelalters.
Aufgabe dieser Arbeit soll es sein, Einsatzmöglichkeiten von Stadtbildern als Quellen im Geschichtsunterricht aufzuzeigen, besonders dort, wo sie eindeutige Vorteile gegenüber schriftlichen Quellen bieten. Um hier einen möglichst breiten Überblick geben zu können, möchte ich, wie auch in meiner Präsentation geschehen, im Folgenden drei Beispiele für die Anwendung von Stadtbildern als Quellen im Geschichtsunterricht geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1.1. Einleitung
- 2. Mittelalterliche Stadtbilder
- 2.1. Allgemeines
- 2.2. Beispiel für die Anwendung im Unterricht
- 3. Im Zuge der Industriellen Revolution - Das Stadtbild wandelt sich rapide
- 3.1. Allgemeines
- 3.2. Beispiel für die Anwendung im Unterricht
- 4. „Ich und die Stadt“ - Großstadtmalerei des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts
- 4.1. Allgemeines
- 4.2. Beispiel für die Anwendung im Unterricht
- 5. Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Verwendung von Stadtbildern als Quellen im Geschichtsunterricht. Sie untersucht, wie Stadtbilder im Vergleich zu schriftlichen Quellen einzigartige Einblicke in die Geschichte bieten können. Die Arbeit konzentriert sich auf drei Beispiele aus verschiedenen Epochen, um die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Stadtbildern im Unterricht aufzuzeigen.
- Die Entwicklung des Stadtbildes im Mittelalter
- Der Wandel des Stadtbildes während der Industriellen Revolution
- Die Großstadtmalerei des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts
- Die Analyse von Stadtbildern als Quellen im Geschichtsunterricht
- Die Bedeutung von Stadtbildern für das Verständnis der städtischen Lebenswelt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Begriff des Stadtbildes vor und erläutert seine Bedeutung für die Geschichtsforschung. Sie hebt die beiden markanten Entwicklungsschübe der europäischen Stadt hervor: die Stadtwerdung im Mittelalter und die Entstehung der modernen Großstadt im Zuge der Industriellen Revolution. Die Arbeit argumentiert, dass die Beschäftigung mit dem Themenbereich Stadt für Schülerinnen und Schüler (SuS) von großer Relevanz ist, da sie Teil ihrer alltäglichen Lebenswelt ist.
Das Kapitel über mittelalterliche Stadtbilder analysiert die Besonderheiten der Darstellung von Städten in der mittelalterlichen Kunst. Es wird deutlich, dass die Stadt im Mittelalter nicht als eigenständiges Sujet betrachtet wurde, sondern als Hintergrund für religiöse Szenen diente. Dennoch bieten diese Bilder wertvolle Informationen über die städtische Lebenswelt dieser Zeit.
Das Kapitel über die Industrielle Revolution beleuchtet den rasanten Wandel des Stadtbildes im Zuge der Industrialisierung. Die Arbeit zeigt auf, wie Stadtbilder die Veränderungen in der Architektur, der Infrastruktur und der Lebensweise der Menschen widerspiegeln.
Das Kapitel über die Großstadtmalerei des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts untersucht die künstlerische Auseinandersetzung mit der modernen Großstadt. Es wird deutlich, wie Künstler die Großstadt als Ort der Anonymität, der sozialen Ungleichheit und der kulturellen Vielfalt darstellten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Stadtbilder, Geschichtsunterricht, Quellenanalyse, Mittelalter, Industrielle Revolution, Großstadtmalerei, städtische Lebenswelt, Architektur, Kunstgeschichte, Unterrichtsmethoden.
Häufig gestellte Fragen
Warum eignen sich Stadtbilder als Quellen für den Geschichtsunterricht?
Stadtbilder bieten visuelle Einblicke in die Architektur und Lebenswelt vergangener Epochen, die schriftliche Quellen oft nicht in dieser Unmittelbarkeit vermitteln können.
Wie veränderte sich das Stadtbild während der Industriellen Revolution?
Es kam zu einem rasanten Wandel durch neue Infrastrukturen, Fabriken und das Entstehen moderner Großstädte, was sich deutlich in der zeitgenössischen Malerei widerspiegelt.
Welche Bedeutung haben mittelalterliche Stadtbilder in der Kunst?
Im Mittelalter dienten Städte oft als symbolischer Hintergrund für religiöse Szenen (z.B. das Himmlische Jerusalem) und nicht als rein topographische Abbildungen.
Was thematisiert die Großstadtmalerei des späten 19. Jahrhunderts?
Künstler setzten sich mit der Anonymität, der sozialen Ungleichheit und der kulturellen Vielfalt der modernen Metropolen auseinander.
Welchen Alltagsbezug haben Schüler heute zum Thema Stadtgeschichte?
Da die meisten Schüler in Städten leben, begegnen sie im Alltag oft baulichen Überresten des Mittelalters oder der Gründerzeit, was das Thema greifbar macht.
- Quote paper
- Florian Unzicker (Author), 2006, Stadtbilder als Quellen im Geschichtsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129035