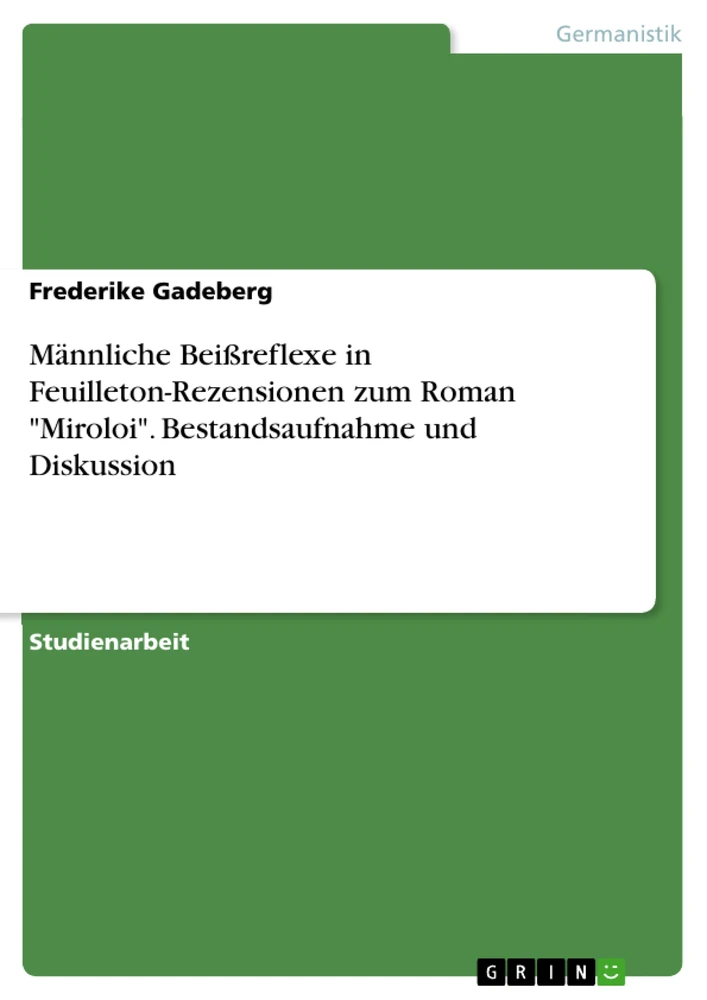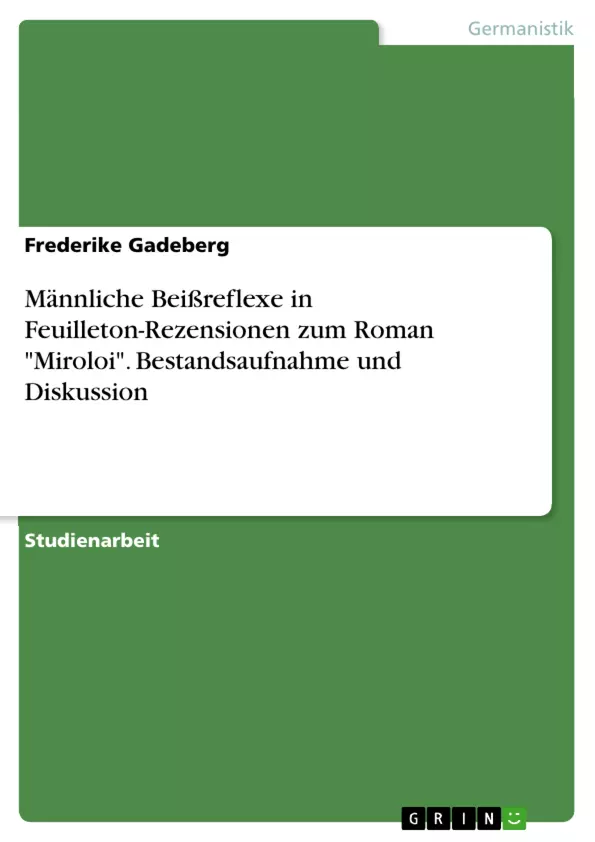Der Fokus dieser Arbeit liegt nicht auf dem literarischen Primärtext "Miroloi", sondern auf den Primärtexten der feuilletonistischen Rezeption überregionaler Tageszeitungen. Das Studium des Rezensionskorpus wirft Fragen auf: In den meisten Kritiken scheint es weniger um eine tatsächliche Buchbesprechung zu gehen, als vielmehr um eine Metadiskussion über die Krise der Literaturkritik und seiner Kriterien, um die Frage nach "Schönheit, Stil und Geschmack" von aktueller Literatur und den Verriss des "Trend-Thema[s] Feminismus". Zeitgleich tun sich in derselben Instanz Stimmen über "männliche Beißreflexe" auf.
Letzterer Kommentar stammt von der Journalistin Dana Buchzik. Sie behauptet, dass Bücher, in denen es um die Gewalt gegen Frauen und die Selbstermächtigung derer geht, eine Provokation für die "konservative Riege des deutschsprachigen Feuilletons" darstellen. Anlässlich Buchziks These zur "Miroloi"-Debatte liest diese Abhandlung ausgewählte Kritiken männlicher Rezensenten hinsichtlich ihrer "männliche[n] Beißreflexe". Werden in den Rezensionen tatsächlich Karen Köhler als Frau, "Miroloi" als Frauenliteratur oder Alina als Heldin angegriffen?
Diese Arbeit untersucht an einem existierenden Beispiel, was sich in ihm zeigt. Hierfür wird sich speziell auf polarisierende Beiträge der "Miroloi"-Debatte beschränkt. Zunächst wird der Roman mit Blick auf die Diskussion und seiner medialen Aufmachung kurz vorgestellt. Daraufhin folgt ein Abriss grundlegender Aspekte von Literaturkritik. Im nächsten Kapitel wird Buchziks Beitrag und ihre daraus resultierende These über "männliche Beißreflexe" erläutert und entfaltet. Auf dieser Grundlage werden im Hauptteil dieser Arbeit die Feuilleton-Beiträge von fünf Rezensenten hinsichtlich der Buchzik’schen These analysiert, um anschließend zu diskutieren, wie sich die Beiträge mit Buchziks These verhandeln lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhalt und Aufmachung Karen Köhlers Roman Miroloi
- Ein Abriss theoretischer Grundlagen der Literaturkritik
- Zur literaturkritischen Besprechung Karen Köhlers Miroloi
- Dana Buchzik über „,männliche Beißreflexe' - Eine These
- Analyse „,männlicher Beißreflexe“
- Carsten Otte: „Miroloi“ von Karen Köhler. Ich mach' mich dann mal weg
- Jan Drees: Debatte: Klagelied für die Literatur
- Moritz Baẞler: Neue Maßstäbe der Gegenwartsliteratur. Schönheit, Stil und Geschmack
- Burkhard Müller: Hier stellt sich jemand dumm
- Jan Küveler: Dieses Buch ist schlecht. Warum sagt es niemand?
- Diskussion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Rezeption des Romans „Miroloi“ von Karen Köhler. Ziel ist es, die im deutschsprachigen Feuilleton geführte Debatte um den Roman zu analysieren und die Rolle der „männlichen Beißreflexe“ in der Kritik zu beleuchten.
- Kritik an der Literaturkritik und ihren Kriterien
- Die Frage nach „Schönheit, Stil und Geschmack“ in der Gegenwartsliteratur
- Die Darstellung des „Trend-Themas Feminismus“ in der Literaturkritik
- Die Analyse von „männlichen Beißreflexen“ in Rezensionen zu „Miroloi“
- Die Rolle der Rhetorik in negativen Rezensionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Vorstellung des Romans „Miroloi“ und seiner medialen Aufmachung. Anschließend wird ein Überblick über theoretische Grundlagen der Literaturkritik gegeben. Im nächsten Kapitel wird die These von Dana Buchzik über „männliche Beißreflexe“ in der Miroloi-Debatte erläutert. Der Hauptteil der Arbeit analysiert dann ausgewählte Feuilletons von fünf männlichen Rezensenten hinsichtlich ihrer Rezeption von „Miroloi“ im Kontext der Buchzik'schen These. Die Analyse soll Aufschluss darüber geben, wie die Rezensenten mit der These Buchziks umgehen und welche Rolle ihre Rhetorik dabei spielt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Literaturkritik, Rezeption, „männliche Beißreflexe“, Feminismus, „Miroloi“, Karen Köhler, Romananalyse, Rhetorik, Medienaufmerksamkeit.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Debatte um den Roman „Miroloi“?
Die Debatte dreht sich weniger um den Inhalt des Buches von Karen Köhler als vielmehr um eine Metadiskussion über die Qualität der Literaturkritik und den Umgang mit feministischen Themen.
Was meint Dana Buchzik mit „männlichen Beißreflexen“?
Buchzik behauptet, dass männliche Rezensenten aggressiv auf Bücher reagieren, die weibliche Selbstermächtigung thematisieren, da sie diese als Provokation empfinden.
Welche Kritiker werden in der Arbeit analysiert?
Analysiert werden Beiträge von Rezensenten wie Carsten Otte, Jan Drees, Moritz Baßler, Burkhard Müller und Jan Küveler.
Wird der Feminismus im Feuilleton als „Trend-Thema“ abgewertet?
Die Arbeit untersucht, ob Kritiker den Erfolg von „Miroloi“ lediglich auf den aktuellen feministischen Zeitgeist zurückführen und damit den literarischen Wert des Werks schmälern.
Was sind die Kriterien für „gute“ Literatur in dieser Diskussion?
In der Debatte werden Begriffe wie „Schönheit, Stil und Geschmack“ gegen politische Relevanz und mediale Aufmachung abgewogen.
- Quote paper
- Frederike Gadeberg (Author), 2020, Männliche Beißreflexe in Feuilleton-Rezensionen zum Roman "Miroloi". Bestandsaufnahme und Diskussion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1290539