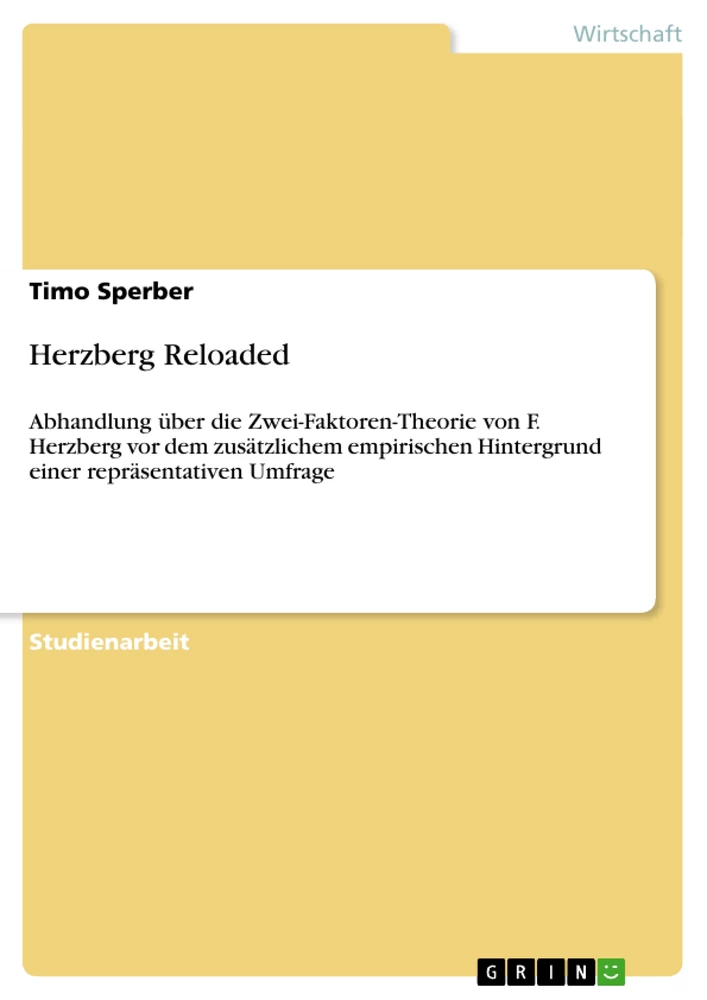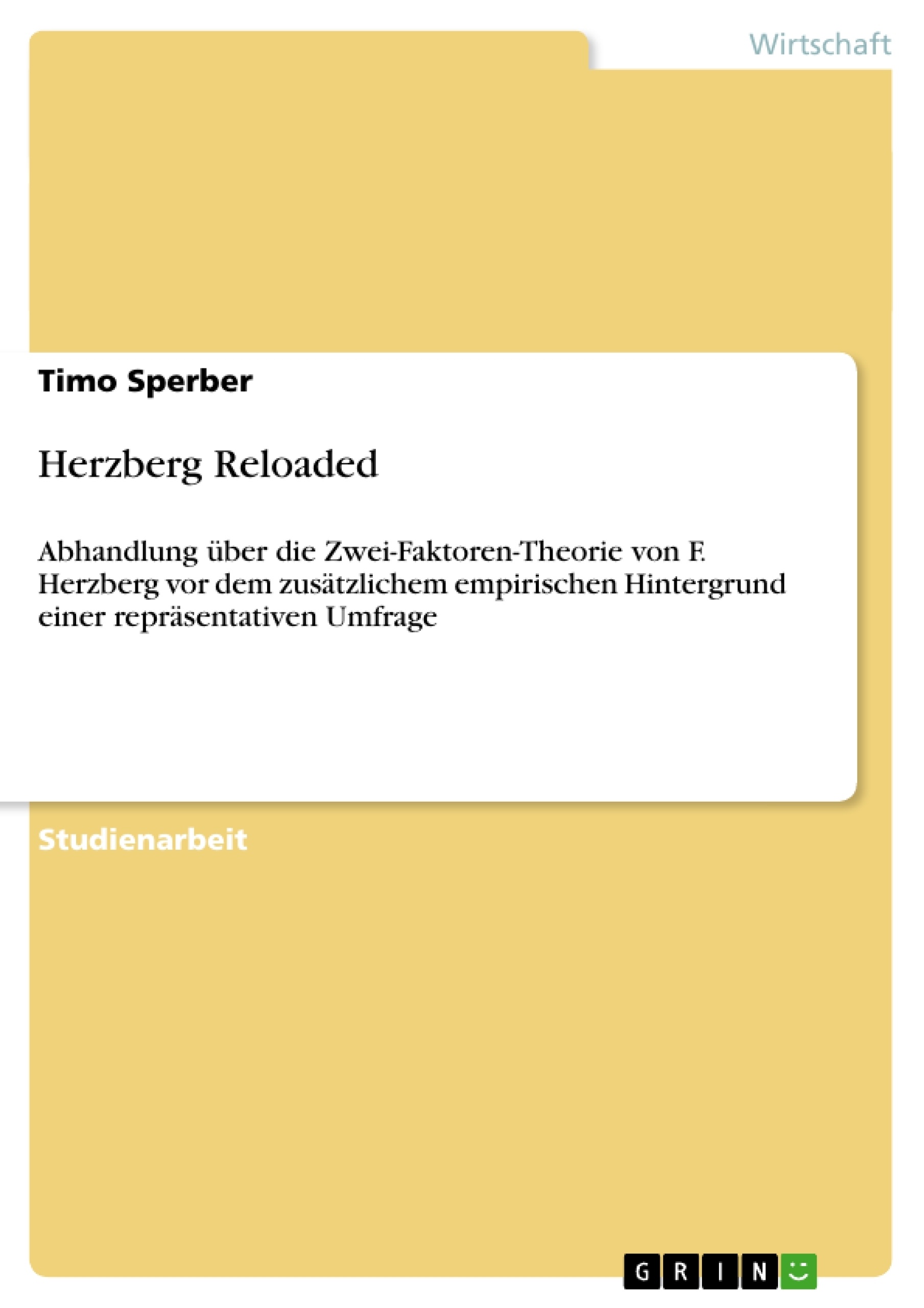Der heute so geläufige und alltägliche Ausdruck „MADE IN GERMANY“ war Anfang
des 19. Jahrhunderts eher ein Zeichen der Diskriminierung als ein Markenzeichen. Er
diente v. a. im angelsächsischen Raum als Schutz vor Produktimitationen.
Ende des zweiten Weltkrieges erlebte der Begriff abermals eine Renaissance, da
Produkte aus Deutschland besonders gekennzeichnet wurden.
Spätestens nach Einführung der sozialen Marktwirtschaft durch den damaligen
Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, ist nicht nur die wirtschaftliche Kraft von Angebot
und Nachfrage deutlich geworden. Auch das Label „MADE IN GERMANY“ konnte
sich immer wieder als sog. Exportweltmeister beweisen.
Die zunehmende Globalisierung macht allerdings auch vor diesem geschichtlichen
Hintergrund keinen Halt und kündigt bereits ein enormes Wirtschaftswachstum auf
Kosten der westeuropäischen Wirtschaft, in den sog. BRIC – Staaten1, an2.
Aber nicht nur die Globalisierung stellt die Volkswirtschaften vor eine Herausforderung,
sondern auch die zunehmende technologische Entwicklung, der demographische
Wandel mit einhergehenden Veränderungen der sozialen Werte und nicht zuletzt die
Veränderungen im Arbeitsmarktumfeld sind die größten Herausforderungen in diesem
sich fortsetzenden Strukturwande.
Im Mittelpunkt dieser Veränderungsprozesse steht der wichtigste Produktionsfaktor, der
Mensch, mit seiner Motivation und spezifischen Fähigkeiten. Aber wie reagiert der Mensch auf Veränderungen wie Globalisierung,
Konjunkturkrisen, Umstrukturierungen, Sparmaßnahmen und Verschlechterung des
Arbeitsklimas?
Eine durch das Bundesministerium für Arbeit in Auftrag gegebene Studie zur
Arbeitszufriedenheit spiegelt größtenteils ein Bild der Frustration wider und belegt
eindeutig einen besseren Firmenerfolg von 20-30% durch bessere
Mitarbeiterorientierung.
Der erste Blick erscheint positiv; etwa ¾ aller Befragten sind mit ihrer momentanen
Arbeitssituation zufrieden. Sieht man doch etwas genauer hin, so differenziert sich das
Bild etwas:
Im Vergleich zum Jahr 2001 ist die Zahl der völlig Zufriedenen um 10% auf 37%
gesunken. Eine Erhöhung des Arbeitsstresses geben im Gegensatz zum Jahre 2001 (48%) nun 60%
aller befragten Arbeitnehmer an und führen dies innerhalb der Studie zugleich als
erheblichen Unzufriedenheitsfaktor an. [...]
Inhaltsverzeichnis Seite
1 Einleitung
2 Inhalt und Aufmachung Karen Köhlers RomanMzro/oz
3 Ein Abriss theoretischer Grundlagen der Literaturkritik
4 Zur literaturkritischen Besprechung Karen Köhlers Miroloi
4.1 Dana Buchzik über „männliche Beißreflexe“ - Eine These
4.2 Analyse „männlicherBeißreflexe“
4.2.1 Carsten Otte: „Miroloi“ von Karen Köhler. Ich mach’ mich dann mal weg
4.2.2 Jan Drees: Debatte: Klagelied für die Literatur
4.2.3 Moritz Baßler: Neue Maßstäbe der Gegenwartsliteratur. Schönheit, Stil und Geschmack
4.2.4 Burkhard Müller: Hier stellt sichjemand dumm
4.2.5 Jan Küveler: Dieses Buch ist schlecht. Warum sagt es niemand?
4.3 Diskussion
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Karen Köhlers Roman Miroloi1 hat Ende des Jahres 2019 eine Debatte ausgelöst. Der Titel des Hanser Verlags wird in diversen Formaten besprochen: von Ama- zon-Rezensionen, über YouTube-Kanäle2 und Feuilleton-Artikel3, bis hin zu literaturspezifischen Portalen4. Die Rezensent*innen sind sich in der Bewertung und Einordnung des Miroloi ’sehen Romans uneinig - insbesondere die Beiträge namhafter Autorinnen im deutschen Feuilleton erzeugen hierbei große Aufmerksamkeit.
Der Fokus dieser Arbeit liegt daher nicht auf dem literarischen Primärtext Miroloi, sondern auf den Primärtexten der feuilletonistischen Rezeption überregionaler Tageszeitungen. Das Studium des Rezensionskorpus wirft Fragen auf: In den meisten Kritiken scheint es weniger um eine tatsächliche Buchbesprechung zu gehen, als vielmehr um eine Metadiskussion über die Krise der Literaturkritik und seiner Kriterien5, um die Frage nach „Schönheit, Stil und Geschmack”6 von aktueller Literatur und den Verriss des ,,Trend-Thema[s] Feminismus”7. Zeitgleich tun sich in derselben Instanz Stimmen über „männliche Beißreflexe”8 auf.
Letzterer Kommentar stammt von der Journalistin Dana Buchzik. Sie behauptet, dass Bücher, in denen es um die Gewalt gegen- und die Selbstermächtigung vow Frauen geht, eine Provokation für die „konservative Riege des deutschsprachigen Feuilletons”9 darstellen. Anlässlich Buchziks These zur Mzro/oz-Debatte liest diese Abhandlung ausgewählte Kritiken männlicher Rezensenten hinsichtlich ihrer ,,männliche[n] Beißreflexe”10 - Werden in den Rezensionen tatsächlich Karen Köhler als Frau, Miroloi als Frauenliteratur oder Alina11 als Heldin angegriffen?
Anstelle einer theoriebasierten Darstellung von Diskursen der Literaturkritik, analysiert diese Arbeit an einem existierenden Beispiel, was sich in ihm zeigt. Hierfür wird sich speziell auf polarisierende Beiträge der Mzro/oz-Debatte beschränkt - „durchschnittliche“, positive Rezensionen werden ausgeklammert. Somit lässt sich zudem danach fragen, aus welchen Gründen negativen Rezensionen mehr Raum gegeben wird und welche Rolle hierbei ihre Rhetorik spielt.
Die Arbeit setzt sich aus mehreren Kapiteln zusammen: Zunächst wird der Roman mit Blick auf die Diskussion und seiner medialen Aufmachung kurz vorgestellt. Daraufhin folgt ein Abriss grundlegender Aspekte von Literaturkritik. Im nächsten Kapitel wird Buchziks Beitrag und ihre daraus resultierende These über „männliche Beißreflexe” erläutert und entfaltet. Auf dieser Grundlage werden im Hauptteil dieser Arbeit die Feuilleton-Beiträge von fünf Rezensenten hinsichtlich der Buchzik’schen These analysiert, um anschließend zu diskutieren, wie sich die Beiträge mit Buchziks These verhandeln lassen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
2 Inhalt und Aufmachung Karen Köhlers Roman Miroloi
Miroloi wird im öffentlichen Diskurs als ein feministischer Roman verhandelt. Eine junge Frau wird in der Rolle der Ich-Erzählerin von ihren Inselmitbewohner*innen strukturell diskriminiert und befreit sich im Laufe der Geschichte sowohl innerlich als auch äußerlich. Das Leben und die Person der Ich-Erzählerin sind bestimmt durch den Aspekt ihres Geschlechts, ihrer Namenlosigkeit und dem Umstand, ein Findelkind zu sein. Die Insel unterliegt strengen religiösen und patriarchal-autoritären Regeln, wobei Frauen keine Rechte, jedoch zu Kehr- und Reproduktionsarbeit verpflichtet sind. Einige Personen im Roman unterstützen die Romanheldin, indem sie ihr beispielsweise lesen beibringen. Dieser Moment im Roman symbolisiert einen Wendepunkt: Von hier an beginnt die Ich-Erzählerin, das gesellschaftliche Konstrukt in Frage zu stellen, um schließlich einen Aufstand der Frauen im Dorf zu initiieren. Insgesamt ist Miroloi strophenartig verfasst und durch einen lautmalerischen und eklatanten Stil werden Situation, Gefühle und Haltung der Hauptfigur unterstrichen. Parallel zu den inhaltlichen Verläufen verändert sich auch die Sprache des Romans bzw. die „Stimme“ der Ich-Erzählerin.12
Der kurze Überblick Mirolois verdeutlicht dessen Dramatik und sprachlich raffinierte Untermalung. Karen Köhlers Roman wird vom Hanser Verlag ein umfangreicher und ausführlichen Internetauftritt zuteil gemacht.13 In einem Reiter verweist der Verlag auf Rezensionen zum Buch, die dort verlinkten Zitate aus Feuilletons oder digitalen Fernseh- oder Radioformaten sind durchweg positiv und anerkennend. Bis auf die Ausnahme von Dennis Scheck handelt es sich um Zitate und Artikel weiblicher Rezensentinnen.14
3 Ein Abriss theoretischer Grundlagen der Literaturkritik
„Weshalb beurteilen mehr oder weniger erwachsene Menschen mehr oder weniger erfundene Geschichten?”15 - danach fragt Stefan Neuhaus im Kontext seiner Überlegungen zur Literaturkritik. Literaturkritik und das, was sie leisten soll, werden in diesem Kapitel als theoretische Grundlage kurz abgehandelt.
Unterschiedliche Autorinnen wagen den Versuch, „Literaturkritik” defmitorisch einzuordnen. Hierbei wird zunächst häufig auf Herbert Jaumanns Lexikonartikel zurückgegriffen, der Literaturkritik als eine kommentierende und bewertende Instanz von ,,literarische[n] Textefn], Autoren und anderefn] Phänomene[n] der Literatur“16 erklärt. Eine solche „Instanz” könne sowohl „kommentierende, urteilende, denunzierende, werbende, [als auch] klassifizierend-orientierende”17 Aussagen treffen. Allerdings lassen sich nach Jaumann dennoch keine notwendigen Bedingungen an Literaturkritik stellen.
Ein weiterer Autor, Thomas Anz, ordnet der Literaturkritik sechs unterschiedliche Funktionen zu: (1) Eine informierende Orientierungsfunktion, (2) eine Selektionsfunktion, (3) eine didaktisch-vermittelnde Funktion, (4) eine didaktisch-sanktionie- rende Funktion für Literaturproduzierende, (5) eine reflexions- und kommunikations- stiumulierende Funktion und eine (6) Unterhaltungsfunktion.18 In ähnlicher Weise unternimmt Neuhaus eine Einteilung literaturkritischer Funktionen als (1) Orientie- rungs-, (2) Informations-, (2) Kritik- und Unterhaltungsfunktion. Im Kontext der Kritikfunktion identifiziert Neuhaus die Macht der Kritiken über ein Buch, denn bei dem Verriss eines Buches sparten sich Rezipient*innen in der Regel das eigene Lesen.
Außerdem eröffnet er den Aspekt der kritischen Selbstreflexion: Literaturkritiken bzw. deren Verfasserinnen sollten ihren eigenen Konstruktionscharakter aufzeigen. Hierzu gehörte es auch, mehrere mögliche Lesarten eines Textes miteinzubeziehen.19 Für diese Arbeit sind insbesondere die Funktionen der Selektion, der didaktischen Sanktion und der Unterhaltung bei Anz bzw. die Neuhaus’schen Funktionen der Kritik und Unterhaltung für die Untersuchung der Rezensionen einzubeziehen.
4 Zur literaturkritischen Besprechung Karen Köhlers Miroloi
4.1 Dana Buchzik über „männliche Beißreflexe“ - Eine These
Die freie Journalistin Dana Buchzik20 stellt eine Krise Deutscher Gegenwartsliteratur fest, indem sie danach fragt, wie in ihr gesprochen und geschrieben wird. Obwohl in Dt. Gegenwartsliteratur bzw. ihrer Kritik Idealismus postuliert werde, herrsche keine Gleichbehandlung zwischen weiblichen und männlichen Autorinnen.21 Als Beitrag zu der Miroloi' sehen Rezensions-Debatte handelt Buchzik eine These über „Männliche Beißreflexe” ab. Im Kontext deutscher Literaturkritik würden insgesamt viele Bücher positiv besprochen werden, außer es handle sich um Gewalt gegen- und Ermächtigung von Frauen. Auch der emanzipatorische Roman Miroloi behandelt eben Genanntes, und Buchzik beobachtet, wie insbesondere männliche Rezensenten den Roman in den Feuilletons zerreißen. In mehreren Absätzen entkräftet Buchzik die Argumentation der Mzro/oz-Kritik anderer Autoren. Außerdem bezieht sie sich auf eine aussagekräftige Studie22, mithilfe derer sie aufzeigt, dass ein ungleiches Verhältnis zwischen der Präsenz von Frauen und Männern im Literaturbetrieb herrsche und männliche Akteure eine höhere Sichtbarkeitbesäßen.23
Nichtsdestotrotz, schließt sie, scheint das Thema Feminismus „für die konservative Riege des deutschsprachigen Feuilletons jedoch eine Provokation darzustellen”24. Buchzik geht also davon aus, dass die negative Kritik an Miroloi weniger auf der Romanbetrachtung als vielmehr auf dem inhaltlich „feministischen” Thema gründet. Hierdurch fühlten sich männliche Leser bzw. Rezensenten angegriffen, weswegen sie das Buch dann negativ besprachen bzw. „heiß bis erbittert diskutierten]”25. Diesen Effekt nennt Buchzik „männliche Beißreflexe”.
Diese Abhandlung verhandelt Buchziks Überlegungen als These, um auf ihrer Grundlage die Rezensionen ausgewählter männlicher Rezensenten zu untersuchen.
4.2 Analyse „männlicher Beißreflexe“
Insgesamt existiert ein großer Rezensionskorpus zum Köhler’schen Roman. Eine Bestandsaufnahme aller Rezensionen oder die Referenzen auf der Internetseite des Han- ser Verlags zeigen, dass der Roman durchaus auch positiv rezensiert wird - sowohl von weiblichen als auch männlichen Rezensent*innen.
In diesem Kapitel werden die Rezensionen Carsten Ottes (Tagesspiegel)26, Jan Drees’ (Deutschlandfunk)27, Moritz Baßler (Taz)28, Burkhard Müller (Zeit)29 und Jan Küve- ler (Welt)30 untersucht. Die zu untersuchenden Rezensionen markieren alle einen Verriss Mirolois, so lässt sich die Auswahl dieser fünf Artikel begründen. Die Artikel werden hinsichtlich der Buchzik’schen These über „männliche Beißreflexe” betrachtet. Das Augenmerk liegt somit auf der Argumentation der Autoren und ob es sich bei dem Gegenstand ihrer Rezension tatsächlich um den Roman handelt. Oder aber, wie Buchzik behauptet, die eigentliche Kritik dem Thema Feminismus gilt.
Die Texte aller fünf Autoren markieren eine „öffentliche Kommunikation über Literatur”31, sie finden sich online und sind in der Regel ohne Paywall aufrufbar.
4.2.1 Carsten Otte: „Miroloi“ von Karen Köhler. Ich mach’ mich dann mal weg.
Am 17.08.2019 veröffentlicht der Tagesspiegel Carsten Ottes Buchkritik mit dem Titel ^Miroloi von Karen Köhler. Ich mach’ mich dann mal weg”32. Sein Artikel beginnt mit einer einleitenden Inhaltsangabe des Romans, wobei sich Otte auf die problematische Situation der Romanheldin und ihren Schutz durch den Betvater bezieht, „der in einer seltsam fremden, patriarchal organisierten Dorfgemeinschaft Kraft seines Amtes Respekt genießt”33. Die überspitzte Syntax Ottes erweckt hier bereits zu Beginn den Eindruck, als erschiene ihm eine patriarchal organisierte Gemeinschaft seltsam fremd. Weiter fasst er die Insel als einen Schauplatz zusammen, der „vergangen scheint”34. Außerdem „soll [der Roman] ein Klagelied sein”35. Seine distanzierte Zusammenfassung zeigt Ottes zweifelnde Einstellung gegenüber dem Roman, außerdem spricht er Miroloi gleichzeitig seine Glaubwürdigkeit ab. Verstärkt wird dieser Eindruck durch seinen Titel: „Ich mach mich dann mal weg”36 37 - dieses Zitat aus MiroloT kennzeichnet Otte nicht als ein Zitat, wodurch es doppeldeutig aufgeladen wird: Einerseits als ein Zitat aus dem Roman, andererseits als eine tatsächliche Aussage Ottes, sich bei der Lektüre Mirolois „weg zu machen”. Bereits diese ersten zwei einleitenden Absätze der Rezension, die sich lediglich auf eine „neutrale“ Angabe des Inhalts beziehen (sollten), verdeutlichen die despektierliche Haltung Ottes zum Roman.
Otte skizziert Miroloi auf der Grundlage Köhlers bisherigen Werkes als „auf den ersten Blick”38 „ambitioniert”39 erscheinende „Anlage”40. Diese „Ambitionen” gingen für ihn jedoch nicht auf, denn die einzelnen Szenen ließen sich nur selten ins Gesamtkonzept einfügen. Für diesen abstrakten Punkt werden von Otte keine Beispiele herangezogen. Darüber hinaus liest sich daraus eine scharfe Kritik an der Autorin persönlich, indem er zumindest ihre „Bemühung“ würdigt.
Otte stellt fest, das Zentrale des Romans sei „das rabiat-reaktionäre Geschlechterver- hältnis innerhalb einer religiösen Gemeinschaft”41. Demnach ließen sich alle Handlungsstränge auf dieses Zentrum münzen. Er kommentiert seine inhaltlichen Beispiele mit dem Adverb „selbstverständlich [eine Todessünde]”42 oder beschreibt die Na- mensgebung des Romans als „Höhepunkt der frevelhaften Emanzipation”43. Der ironische Ton seiner Ausführungen erzeugen den Eindruck eines abschätzigen Blickes auf den Roman und einer despektierlichen Haltung.
Nachdem Otte Ähnlichkeiten zwischen den fiktiven Khorabel-Hütern und realen IS- oder Inquisitions-Vertretern aufdeckt, wird Köhlers Roman im darauffolgenden Untertitel als „arg simpel”44 denunziert - im Zusammenhang wirkt dies widersprüchlich. Außerdem scheint Otte die Differenzierung zwischen der Autorin Karen Köhler und der Romanheldin Alina nicht sonderlich genau zu nehmen, wenn er im Untertitel namentlich über Köhler schreibt, im dazugehörigen Absatz aber mit dem Personalpronomen „sie” eigentlich Alina meint.45 Diese Widersprüchlichkeit ließe sich zwar einerseits als bewusste Rhetorik lesen, genauso lässt sich Otte an dieser Stelle jedoch Fahrlässigkeit und Ungenauigkeit unterstellen, wodurch seine Ausführungen an Überzeugungskraft verlieren.
[...]
1 Köhler, K.: Miroloi. München: Carl Hanser Verlag 2019.
2 Vgl. bspw. Bücherwunder: [Buchtipp] Karen Köhler: Miroloi (#dbpl9). YouTube 2019, unter: htt- ps://www.youtube.com/watch?v=mOKmRYlK_lc (Zugriff 09.05.2020).
3 Auf einige Beispiele wird in dieser Arbeit eingegangen.
4 https://www.perlentaucher.de/buch/karen-koehler/miroloi.html (Zurgriff: 09.05.2020).
5 Hobräck, M.: Kriterienkrise. Roman „Miroloi” von Karen Köhler soll Symptom einer immer schlechteren Literatur sein, ist aber für den Buchpreis nominiert, der Freitag. Die Wochenzeitung 2019, unter: https://www.freitag.de/autoren/marlen-hobrack/kriterienkrise (Zugriff: 09.05.2020).
6 Baßler, M.: Neue Maßstäbe der Gegenwartsliteratur. Schönheit, Stil und Geschmack, taz 2019, unter: https://taz.de/Neue-Massstaebe-der-Gegenwartsliteratur/l5615852/ (Zugriff: 09.05.2020).
7 Drees, J.: Karen Köhler: „Miroloi”. Klagelied für die Literatur. Deutschlandfunk 2019, unter: https ://www.deutschlandfunk.de/karen-koehler-miroloi-klagelied-fner-die-literatur.700.de.html? dram:article_id=456679 (Zugriff: 09.05.2020).
8 Buchzik, D.: Dystopien, Parabeln und männliche Bei[ß]reflexe. Goethe Institut 2019, unter: https://www.goethe.de/ins/tr/de/kul/sup/lit/fra/21705726.html (Zugriff: 09.05.2020).
9 Buchzik2019.
10 Buchzik2019.
11 NamederRomanheldin.
12 Vgl. Köhler 2019.
13 Internetauftritt Miroloi, unter: https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/miroloi/978-3-446- 26171-6/ (Zugriff: 09.05.2020).
14 Vgl. ebd.
15 Neuhaus, S.: Literaturkritik: Eine Einführung, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2004, S. 167.
16 Jaumann, H.: Literaturkritik. In: Fricke, H. (Hrsg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung, Band 2, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2000, S. 463.
17 Ebd., S. 463.
18 Anz, T.: Theorien und Analysen zur Literaturkritik und zur Wertung. In: Anz, T/Baasner, R.: Literaturkritik. Geschichte - Theorie - Praxis, 2. Aufl. München: C. H. Beck 2007, S. 195 f.
19 Neuhaus 2004, S. 168.
20 Perlentaucher-Autorin Dana Buchzik, unter: https://www.perlentaucher.de/ptautor/dana- buchzik.html (Zugriff 07.05.20209.
21 Buchzik2019.
22 Clark/Collado/Seidel/George/Henze/Reimers: Zur Sichtbarkeit von Frauen in Medien und im Literaturbetrieb, Universität Rostock 2018, unter: http://www.xn--frauenzhlen- r8a.de/media/Pilotstudie_Sichtbarkeit_von_Frauen_in_Medien.pdf (Zugriff 09.05.2020).
23 Vgl. Buchzik2019.
24 Buchzik2019.
25 Buchzik2019.
26 Otte, C.: „Miroloi“ von Karen Köhler. Ich mach' mich dann mal weg. Der Tagesspiegel 2019, unter: https://www.tagesspiegel.de/kultur/miroloi-von-karen-koehler-ich-mach-mich-dann-mal- wegZ24914810.html (Zugriff: 09.05.2020).
27 Drees 2019.
28 Baßler2019.
29 Müller, B: „Miroloi“. Hier stellt sich jemand dumm. Zeit online 2019, unter: https://www.zeit.de/2019/35/miroloi-karen-koehler-patriarchat-feminismus-roman (Zugriff: 11.05.2020).
30 Küveler, J.: Dieses Buch ist schlecht. Warum sagt es niemand? Welt 2019, unter: https://ww- w.welt.de/kultur/literarischewelt/articlel99182467/Karen-Koehlers-Miroloi-Die-Simulati- on-von-Feminismus.html (Zugriff: 11.05.2020).
31 Hohendahl, zit. nachNeuhaus 2004, S. 29.
32 Otte2019.
33 Otte2019.
34 Ebd.
35 Ebd.
36 Ebd.
37 Vgl. Köhler 2019.
38 Otte2019.
39 Ebd.
40 Ebd.
41 Ebd.
42 Ebd.
43 Otte2019.
44 Ebd.
45 Vgl. ebd.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Debatte um Karen Köhlers Roman "Miroloi"?
Die Arbeit analysiert die feuilletonistische Rezeption des Romans, insbesondere die Kontroverse zwischen negativen Kritiken männlicher Rezensenten und dem Vorwurf "männlicher Beißreflexe".
Was versteht Dana Buchzik unter "männlichen Beißreflexen"?
Die These besagt, dass konservative männliche Rezensenten aggressiv auf Literatur reagieren, die Themen wie weibliche Selbstermächtigung und Gewalt gegen Frauen behandelt.
Welche Funktionen hat die Literaturkritik laut dieser Arbeit?
Literaturkritik dient der Information, Selektion, didaktischen Sanktion für Autoren sowie der Unterhaltung und Stimulation von Kommunikation.
Ist "Miroloi" ein feministischer Roman?
Ja, der Roman wird im öffentlichen Diskurs so verhandelt, da er von einer jungen Frau erzählt, die sich aus einem patriarchal-autoritären System befreit.
Welche Kritiker werden in der Analyse untersucht?
Die Arbeit untersucht Rezensionen von Carsten Otte, Jan Drees, Moritz Baßler, Burkhard Müller und Jan Küveler.
- Citation du texte
- Timo Sperber (Auteur), 2007, Herzberg Reloaded, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129053