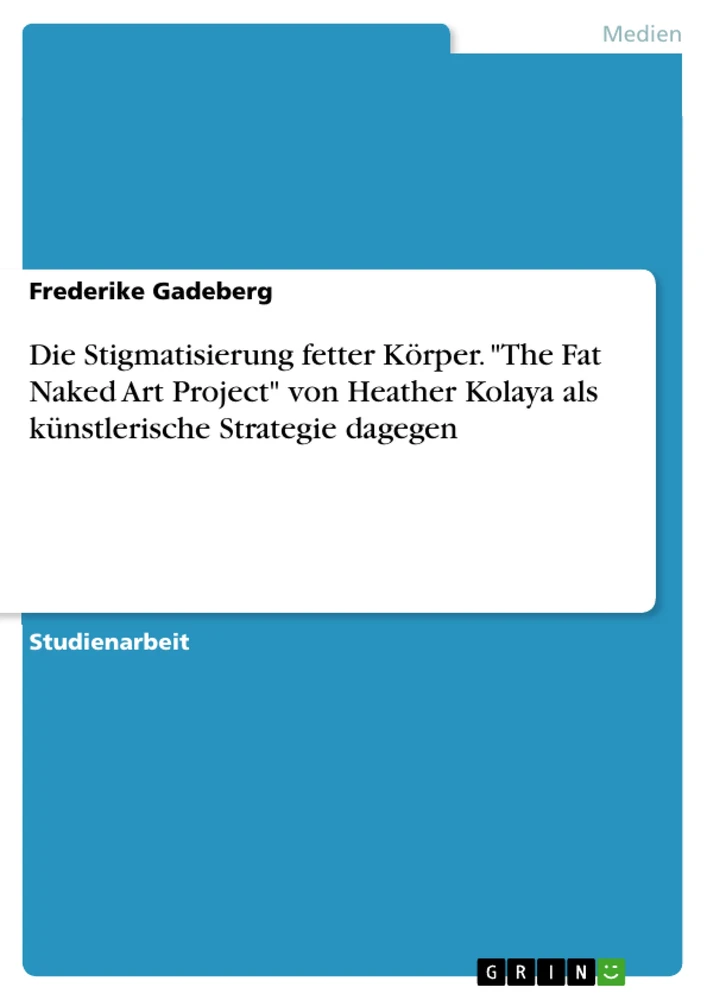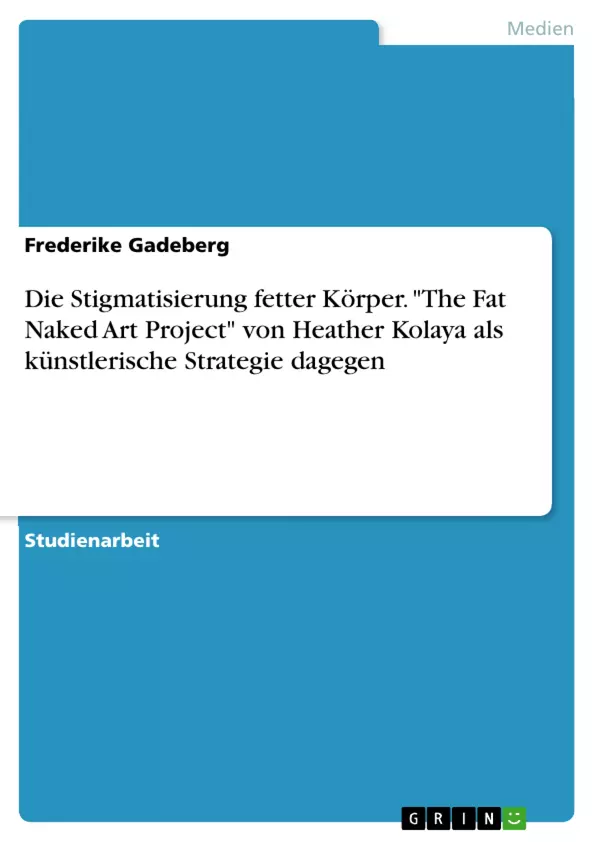Wie lässt sich künstlerisch mit dem gesellschaftlichen Diskurs um fette Körper umgehen? Diese Arbeit möchte einen Beitrag zum Dialog leisten, indem die künstlerische Position der amerikanischen Fotografin Heather Kolaya vorgestellt wird. Darüber hinaus soll die Frage diskutiert werden, inwiefern eine solche künstlerische Arbeit oder fotografisches Projekt zu fetter Kunst gezählt werden oder aktivistische Züge aufweisen kann.
Das erste Kapitel beinhaltet einen kurzen Abriss des aktuellen Stands der Fat-Studies in Deutschland. Näher werden hierbei die Texte zur "Dickleibigkeit in Kunst und Medien" von Kulicova und Rosenke behandelt, um diese als Grundlage für eine Analyse des Fotoprojekts "Fat Naked Art Project" zu nutzen und um die Debatte fetter Kunst herum zu verorten. Abschließend werden die Ergebnisse in einem Fazit zusammengefasst und auf ausblickende Aspekte hingewiesen.
"Activism is the key to changing the world for the better" – begibt man sich gezielt auf die Suche nach Fat-Positivity, stößt man auf einige Projekte und Aktionen, deren Ziel es ist, die Message eines positiven Körperbildes auf aktivistische Weise zu vermitteln und zu verbreiten. Der wissenschaftliche Diskurs um Fat-Studies allerdings ist ein mehrdimensionaler – es geht nicht nur um die bloße Vermittlung eines positiven Körperbildes, sondern um soziologische Fragen nach gesellschaftlichen Normen, Schönheitsidealen, intersektionaler Gleichberechtigung und weiterem. Werden Körperpolitiken zunächst vorrangig im amerikanischen und englischsprachigen Raum behandelt und bestimmt – begleitet durch Publikationen von beispielsweise Charlotte Cooper – sind die Fat-Studies mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Der erste Sammelband zu der Thematik – "Fat Studies in Deutschland – Hohes Körpergewicht zwischen Diskriminierung und Anerkennung" – hat den Anspruch, sich auf verschiedene Weise kritisch mit der Stigmatisierung fetter Körper und Menschen in Deutschland zu beschäftigen. Vorrangig finden sich die Thematiken in den Gender/Queer- und Disability-Studies – es soll also weniger um gesundheitliche "Risiken" gehen, als viel mehr zu erforschen, warum Fettleibigkeit ein scheinbar gesellschaftliches Problem darstellt und wie gegen die Diskriminierung von fetten Menschen angegangen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Fat Studies in Deutschland
- 2.1. Themen und Motive allgemein
- 2.2. Fatness in Kunst und Medien
- 3. „The Fat Naked Art Project“ (Heather Kolaya)
- 3.1. Entstehung und Motive
- 3.2. Beschreibung ausgewählter Bilder
- 3.3. Bezug zu 2.2 Fatness in Kunst und Medien
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die künstlerische Strategie von Heather Kolayas „The Fat Naked Art Project“ im Kontext der Fat Studies in Deutschland. Sie analysiert, inwieweit dieses Projekt als künstlerischer Beitrag gegen die Stigmatisierung fetter Körper fungiert und aktivistische Züge aufweist. Die Arbeit beleuchtet den wissenschaftlichen Diskurs um Fat Studies, insbesondere die Thematisierung von Fettleibigkeit in Kunst und Medien.
- Stigmatisierung fetter Körper in Gesellschaft und Medien
- Fat Studies in Deutschland und deren Relevanz
- Künstlerische Strategien zur Entmarginalisierung fetter Körper
- Analyse von Heather Kolayas „The Fat Naked Art Project“
- Der Begriff „fette Kunst“ und seine politische Dimension
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Fat Studies und des „Fat Naked Art Projects“ von Heather Kolaya ein. Sie beschreibt den aktivistischen Ansatz von Fat Positivity und den wissenschaftlichen Diskurs um Fat Studies in Deutschland, der sich nicht nur auf positive Körperbilder beschränkt, sondern auch soziologische Fragen nach gesellschaftlichen Normen und Diskriminierung thematisiert. Die Arbeit positioniert sich als Beitrag zum Dialog über den Umgang mit dem gesellschaftlichen Diskurs um fette Körper und die Frage, inwiefern künstlerische Arbeiten zu fetter Kunst gezählt werden können und aktivistische Züge aufweisen.
2. Fat Studies in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet den Stand der Fat Studies in Deutschland, basierend auf dem Sammelband „Fat Studies in Deutschland“. Es analysiert die gesellschaftliche Konstruktion von Fettleibigkeit als soziales Problem und die damit verbundene Diskriminierung. Es werden die ambivalenten Umstände beleuchtet, die Fettleibigkeit als individuelles Problem individualisieren, ohne den zeitlichen Kontext von Ernährung und Leben zu berücksichtigen. Das Kapitel betont die Diskriminierung und das Mobbing, das Menschen mit fetten Körpern erfahren, mit Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und soziale Isolation.
3. „The Fat Naked Art Project“ (Heather Kolaya): Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Analyse des künstlerischen Projekts „The Fat Naked Art Project“ von Heather Kolaya. Es untersucht die Entstehung und Motive des Projekts sowie ausgewählte Bilder. Der Bezug zu den in Kapitel 2 diskutierten Themen der „Fatness in Kunst und Medien“ wird hergestellt, um die künstlerische Strategie Kolayas im Kontext der Fat Studies zu verorten und deren Beitrag zur Entmarginalisierung fetter Körper zu beleuchten. Die Analyse untersucht, ob und wie das Projekt als „fette Kunst“ im Sinne einer politisch engagierten Kunst verstanden werden kann und wie es die gesellschaftliche Debatte beeinflusst.
Schlüsselwörter
Fat Studies, Fettleibigkeit, Körperstigma, Körperpolitik, Diskriminierung, „The Fat Naked Art Project“, Heather Kolaya, fette Kunst, aktivistische Kunst, Medienrepräsentation, Schönheitsideale, intersektionaler Ansatz.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Analyse von Heather Kolayas „The Fat Naked Art Project“ im Kontext der Fat Studies in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das künstlerische Projekt „The Fat Naked Art Project“ von Heather Kolaya im Kontext der Fat Studies in Deutschland. Sie untersucht die künstlerische Strategie des Projekts, seinen aktivistischen Charakter und seinen Beitrag zur Entmarginalisierung fetter Körper. Die Arbeit beleuchtet dabei den wissenschaftlichen Diskurs um Fat Studies und die Thematisierung von Fettleibigkeit in Kunst und Medien.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die Arbeit behandelt die Stigmatisierung fetter Körper, Fat Studies in Deutschland, künstlerische Strategien zur Entmarginalisierung fetter Körper, eine detaillierte Analyse von Heather Kolayas „The Fat Naked Art Project“, den Begriff „fette Kunst“ und seine politische Dimension, sowie die Medienrepräsentation von Fettleibigkeit und gesellschaftliche Schönheitsideale. Ein intersektionaler Ansatz wird ebenfalls berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Fat Studies in Deutschland, ein Kapitel zur Analyse von „The Fat Naked Art Project“, und ein Fazit. Das Kapitel zu Fat Studies in Deutschland beleuchtet den gesellschaftlichen Diskurs um Fettleibigkeit, Diskriminierung und die damit verbundenen sozialen und psychischen Auswirkungen. Die Analyse von Kolayas Projekt konzentriert sich auf die Entstehung, die Motive und ausgewählte Bilder, sowie deren Bezug zu den vorher diskutierten Themen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Analysemethode, die sich auf die Untersuchung von Kolayas „The Fat Naked Art Project“ konzentriert. Sie bezieht den wissenschaftlichen Diskurs der Fat Studies in Deutschland mit ein, um das Projekt in einen breiteren Kontext einzuordnen und dessen Bedeutung zu bewerten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind nicht explizit im Inhaltsverzeichnis zusammengefasst, sondern werden im Fazit des vollständigen Dokuments dargestellt. Der Ausblick deutet aber darauf hin, dass die Arbeit die künstlerische Strategie Kolayas als Beitrag zur Entmarginalisierung fetter Körper bewerten und deren Bedeutung im Kontext der Fat Studies diskutieren wird.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Fat Studies, Fettleibigkeit, Körperstigma, Körperpolitik, Diskriminierung, „The Fat Naked Art Project“, Heather Kolaya, fette Kunst, aktivistische Kunst, Medienrepräsentation, Schönheitsideale, intersektionaler Ansatz.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Zielgruppe umfasst Wissenschaftler*innen, Studierende und Interessierte im Bereich Fat Studies, Kunstgeschichte, Gender Studies und Soziologie. Die Arbeit ist für alle relevant, die sich mit der Repräsentation fetter Körper in Kunst und Medien und der gesellschaftlichen Stigmatisierung auseinandersetzen.
- Arbeit zitieren
- Frederike Gadeberg (Autor:in), 2018, Die Stigmatisierung fetter Körper. "The Fat Naked Art Project" von Heather Kolaya als künstlerische Strategie dagegen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1290541