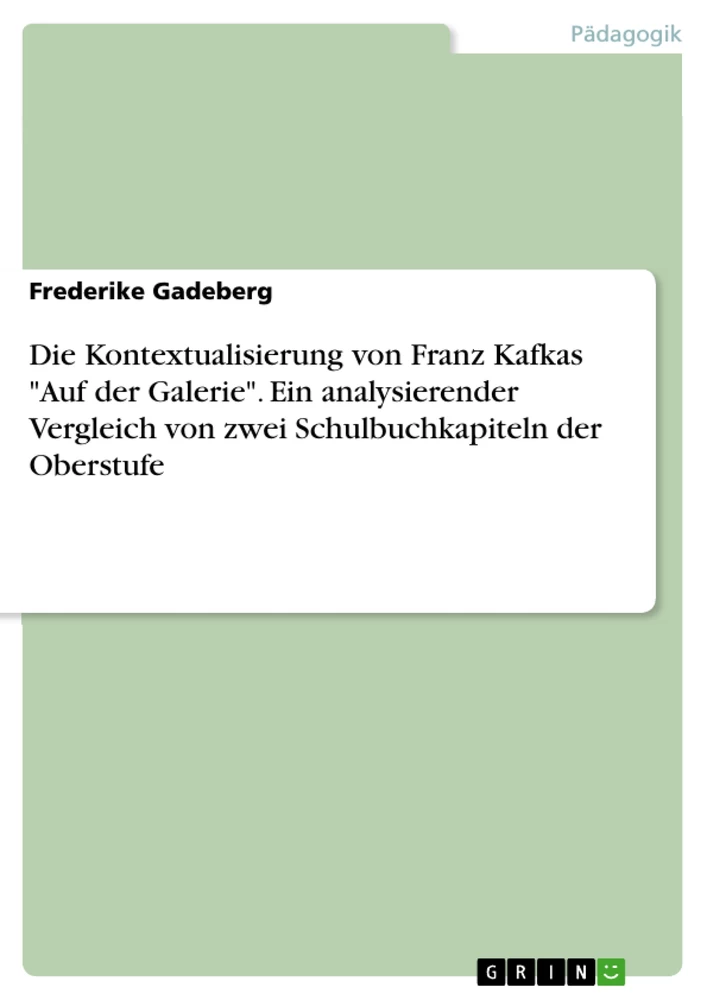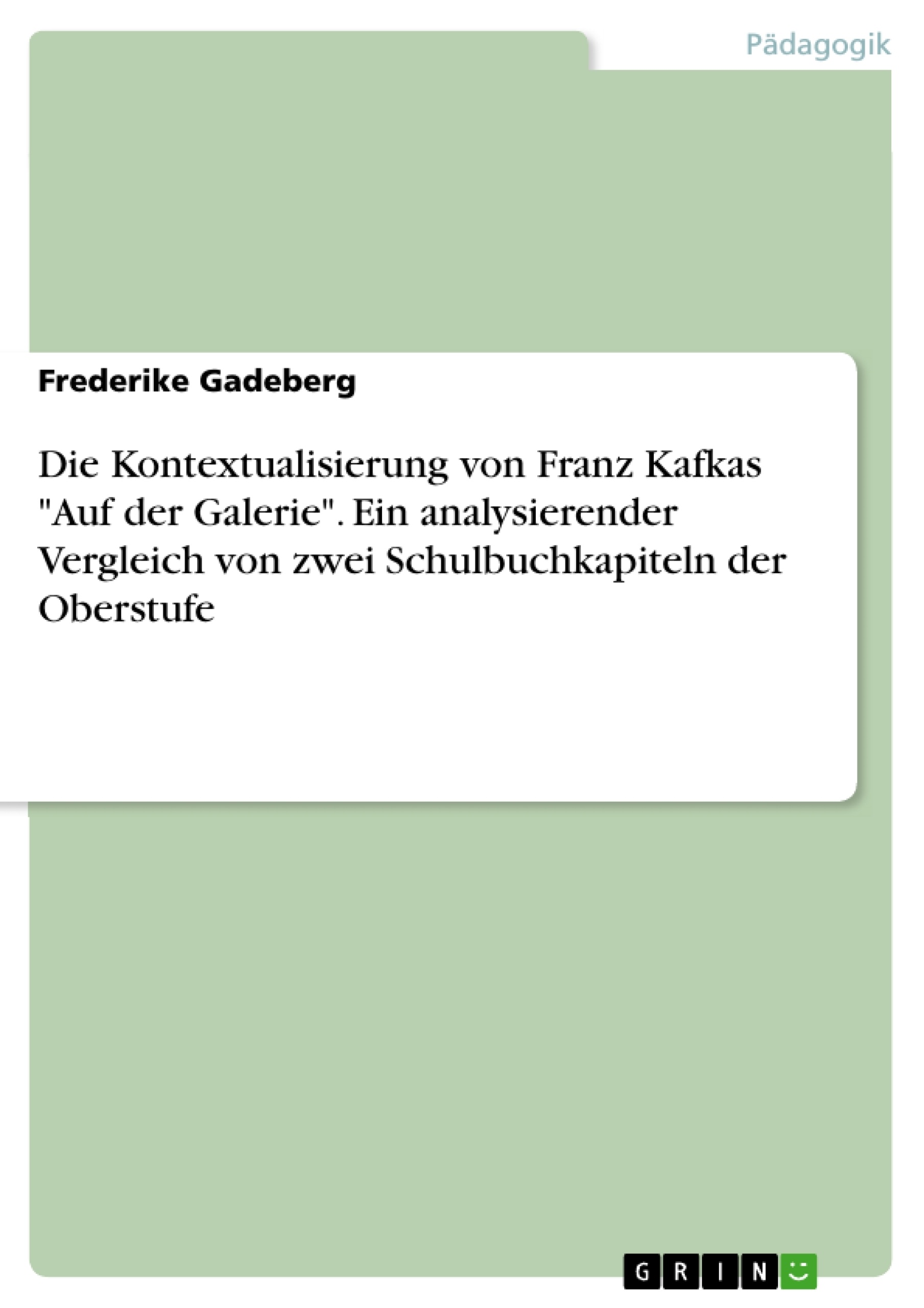Um einen Beitrag zum didaktischen Diskurs zu leisten, beschäftigt sich diese Arbeit unter Bezugnahme des Kerncurriculums mit der Kontextualisierung desselben Textes in zwei unterschiedlichen Schulbüchern der Oberstufe. Hierbei soll es weniger um die Qualität des verwendeten Wissens innerhalb des Literaturunterrichts gehen, als vielmehr die vielseitigen Möglichkeiten und damit den Einfluss, bzw. genauer die Gefahr und das Potenzial von Kontextualisierung aufzuzeigen. Als exemplarisches Beispiel wird mit zwei Schulbuchkapiteln gearbeitet, die beide die zum Schulkanon gehörende Kafka’sche Parabel „Auf der Galerie“ behandeln und jeweils auf ihre Weise präsentieren. Wie und unter welchem Einbezug von Kontextwissen wird die Parabel präsentiert und welchen Einfluss hat dies auf das Verstehen des Textes?
"Kontextualisierung ist notwendige Bedingung der Interpretation" – mit dieser These Zabkas soll die vorliegende Arbeit eingeleitet werden. Das Verstehen und Interpretieren literarischer Texte stellt einen wesentlichen Bereich im Literaturunterricht der Schule dar. Schülerinnen und Schülern sollen ein autonomes Textverständnis entwickeln, das durch nahe Textargumentation Plausibilität und Kohärenz aufweist. Denn ein konstitutives Merkmal literarischer Texte ist ihre Mehrdeutigkeit – so lassen sich Texte aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven betrachten, was die Grundlage bietet für eine vielseitige Interpretation. Die verschiedenen Verständnismöglichkeiten ergeben sich häufig aus mehreren, auf den Text angewendeten Kontexten bzw. optimalerweise deren Zusammenführung. Mit seiner Betonung der Notwendigkeit von Kontexten trifft Zabka also einen wunden Punkt im literaturdidaktischen Diskurs von Kontextwissen, in welchem sich gegenwärtig unter anderem mit der Frage nach der Korrelation zwischen literarästhetischem Verstehen und domänenspezifischem Vorwissen auseinandergesetzt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie und Methode
- Kontextualisierung u. die Arten v. Kontextwissen nach Zabka u. Spinner
- Theorie zum Lesebuch
- Analysierender Vergleich
- Franz Kafka: Auf der Galerie
- Betrachtung der Schulbuchkapitel
- Cornelsen: Themen, Texte und Strukturen
- Schöningh: Deutsch in der Oberstufe
- Vergleich
- Diskussion und Auswertung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Kontextualisierung eines literarischen Textes in zwei verschiedenen Schulbüchern der Oberstufe. Sie untersucht den Einfluss von Kontextwissen auf das Textverständnis und analysiert die verschiedenen Möglichkeiten und Gefahren, die mit der Kontextualisierung verbunden sind.
- Kontextualisierung als wesentlicher Bestandteil der Textinterpretation
- Arten von Kontextwissen und ihre Anwendung im Literaturunterricht
- Der Einfluss von Kontextwissen auf die Interpretation literarischer Texte
- Gefahren und Potenziale der Kontextualisierung
- Vergleich zweier Schulbuchkapitel zur Kontextualisierung von Franz Kafkas „Auf der Galerie“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Kontextualisierung ein und erläutert die These Zabkas, dass die Kontextualisierung eine notwendige Bedingung der Interpretation ist. Es werden außerdem die verschiedenen Arten von Kontextwissen nach Zabka und Spinner vorgestellt, die als theoretisches und methodisches Grundgerüst für die Analyse dienen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Theorie des Lesebuchs, um auf die Analyse der Schulbuchkapitel vorzubereiten. Es werden die verschiedenen Arten von Kontextwissen und ihre potenziellen Auswirkungen auf das Textverständnis im Detail erläutert.
Das dritte Kapitel analysiert die beiden Schulbuchkapitel isoliert voneinander und untersucht die Einbettung der Parabel „Auf der Galerie“ in den jeweiligen Kontext. Es wird die Art und Weise der Kontextualisierung und die Auswahl des Fachwissens in den beiden Kapiteln analysiert.
Das vierte Kapitel vergleicht die beiden Schulbuchkapitel hinsichtlich ihrer Kontextualisierung und zeigt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf. Anhand der Ergebnisse wird die vielseitige Facette der Kontextualisierung und deren Einfluss auf das Textverständnis diskutiert.
Schlüsselwörter
Kontextualisierung, Kontextwissen, Textinterpretation, Literaturunterricht, Schulbuch, Franz Kafka, „Auf der Galerie“, Parabel, Gattungswissen, Textanalysewissen, literaturgeschichtliches Wissen, Autorenwissen, intertextuelles Wissen.
- Quote paper
- Frederike Gadeberg (Author), 2018, Die Kontextualisierung von Franz Kafkas "Auf der Galerie". Ein analysierender Vergleich von zwei Schulbuchkapiteln der Oberstufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1290549