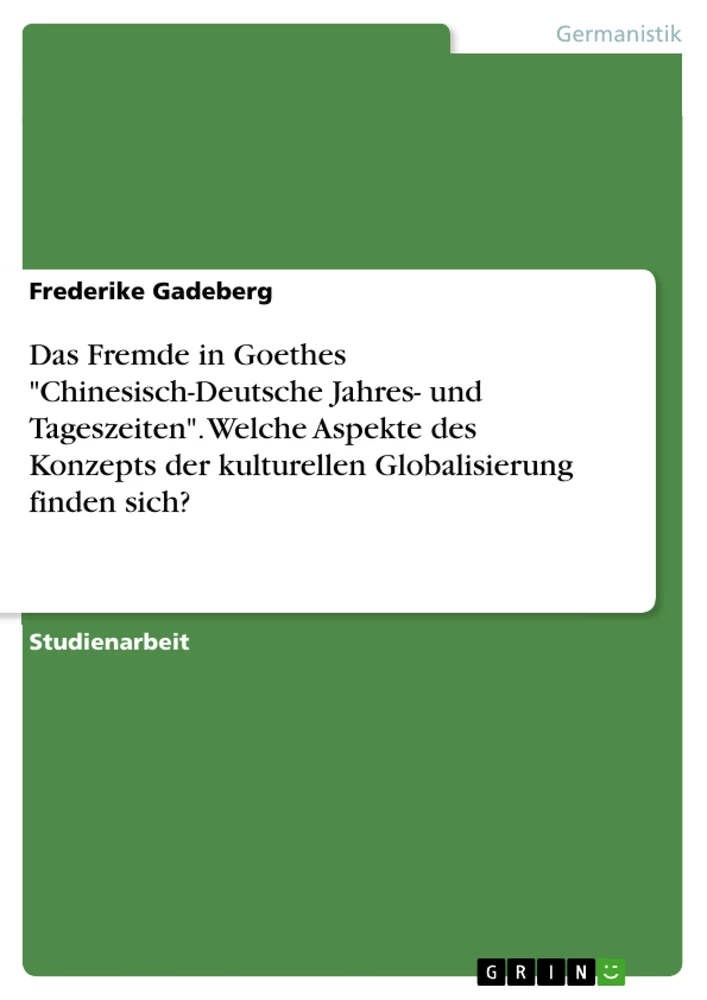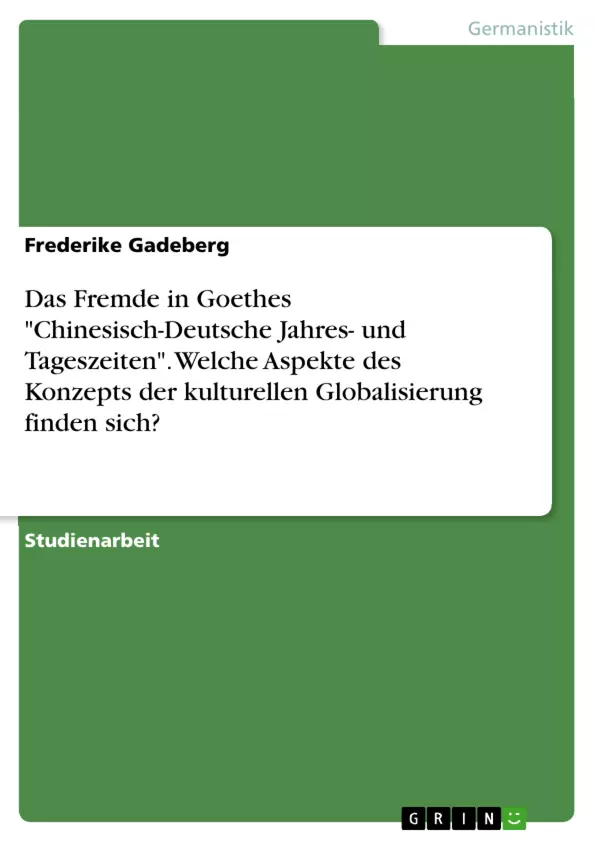Diese Arbeit behandelt das Thema Weltliteratur, heute bekannt als kulturelle Globalisierung. Im Vordergrund stehen die Dichtung "Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten" von Johann Wolfgang von Goethe und seine nie verschriftlichten theoretischen Überlegungen zur Thematik von Weltliteratur. Am Ende der Arbeit soll die Frage beantwortet werden, ob sich der Gedichtzyklus in das goethesche Konzept von Weltliteratur und später kultureller Globalisierung eingliedern lässt. Außerdem soll untersucht werden, inwieweit sich das Fremde im Gedichtzyklus überhaupt widerspiegelt. Darüber hinaus widmet sich das letzte Kapitel der Gegenwärtigkeit dieser Thematik und weshalb das Konzept heute aktueller ist denn je.
Zu Beginn beschäftige ich mich mit der kulturellen Globalisierung allgemein. Hier wird unter anderem der Begriff Kultur differenziert und in Zusammenhang mit Globalisierung gesetzt. In diesem Kontext fließen auch Überlegungen Herders und Goethes mit ein, um anschließend einen Bogen zur Weltliteratur zu spannen. Daraufhin folgt die Auseinandersetzung mit dem Gedichtzyklus "Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten, bei der besonders auf die Thematik des Fremden eingegangen werden soll. Zuletzt soll ein aktueller Bezug hergestellt werden und die Arbeit schließt mit einem Fazit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Die kulturelle Globalisierung und das Konzept der Weltliteratur
- Die Aspekte kultureller Globalisierung
- Das Konzept der Weltliteratur
- Der Gedichtzyklus „Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten“
- Goethes Quellen
- Eine Analyse
- Zusammenhang von Weltliteratur und „Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten“
- Die Gegenwärtigkeit des Konzepts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Goethes Gedichtzyklus „Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten“ (1827) im Kontext der kulturellen Globalisierung und des Konzepts der Weltliteratur. Sie untersucht, ob sich der Gedichtzyklus in Goethes Konzept von Weltliteratur und später kultureller Globalisierung eingliedern lässt und wie sich das Fremde im Gedichtzyklus widerspiegelt. Darüber hinaus wird die aktuelle Relevanz dieser Thematik beleuchtet.
- Das Konzept der Weltliteratur im 19. Jahrhundert
- Kulturelle Globalisierung im 21. Jahrhundert
- Die Darstellung des „Fremden“ in Goethes Werk
- Die Bedeutung des Gedichtzyklus „Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten“
- Die Aktualität des Konzepts der Weltliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der kulturellen Globalisierung ein und stellt Goethes Gedichtzyklus „Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten“ im Kontext dieser Entwicklung vor. Das zweite Kapitel beleuchtet die Aspekte der kulturellen Globalisierung und das Konzept der Weltliteratur. Es werden unter anderem die Definitionen von Kultur und Globalisierung diskutiert sowie Goethes und Herders Ansichten zu diesen Themen beleuchtet. Das dritte Kapitel analysiert Goethes Gedichtzyklus „Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten“ und untersucht, inwieweit sich das Fremde darin widerspiegelt. Es werden Goethes Quellen und die Entstehung des Gedichtzyklus beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen kulturelle Globalisierung, Weltliteratur, Fremdheit, Interkulturalität und dem Gedichtzyklus „Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten“ von Johann Wolfgang von Goethe. Im Fokus steht die Analyse von Goethes Ansichten zur Weltliteratur und deren Verbindung zu seinem Werk.
Häufig gestellte Fragen
Was verstand Goethe unter dem Begriff „Weltliteratur“?
Goethe sah Weltliteratur als einen internationalen Austausch von Ideen und literarischen Werken, der über nationale Grenzen hinausgeht.
Worum geht es im Gedichtzyklus „Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten“?
In diesem Spätwerk verbindet Goethe chinesische Motive mit deutschen Naturbeobachtungen und schafft so ein interkulturelles Kunstwerk.
Wie spiegelt sich das „Fremde“ in Goethes Dichtung wider?
Das Fremde wird nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung und Spiegel des Eigenen dargestellt, was dem Konzept der kulturellen Globalisierung entspricht.
Ist Goethes Konzept der Weltliteratur heute noch aktuell?
Ja, in Zeiten der Globalisierung ist der interkulturelle Dialog, wie Goethe ihn forderte, aktueller denn je für das Verständnis zwischen Kulturen.
Welche Quellen nutzte Goethe für seine chinesischen Motive?
Goethe stützte sich auf Reiseberichte und Übersetzungen chinesischer Romane und Lyrik, die im frühen 19. Jahrhundert in Europa verfügbar wurden.
- Citation du texte
- Frederike Gadeberg (Auteur), 2017, Das Fremde in Goethes "Chinesisch-Deutsche Jahres- und Tageszeiten". Welche Aspekte des Konzepts der kulturellen Globalisierung finden sich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1290550