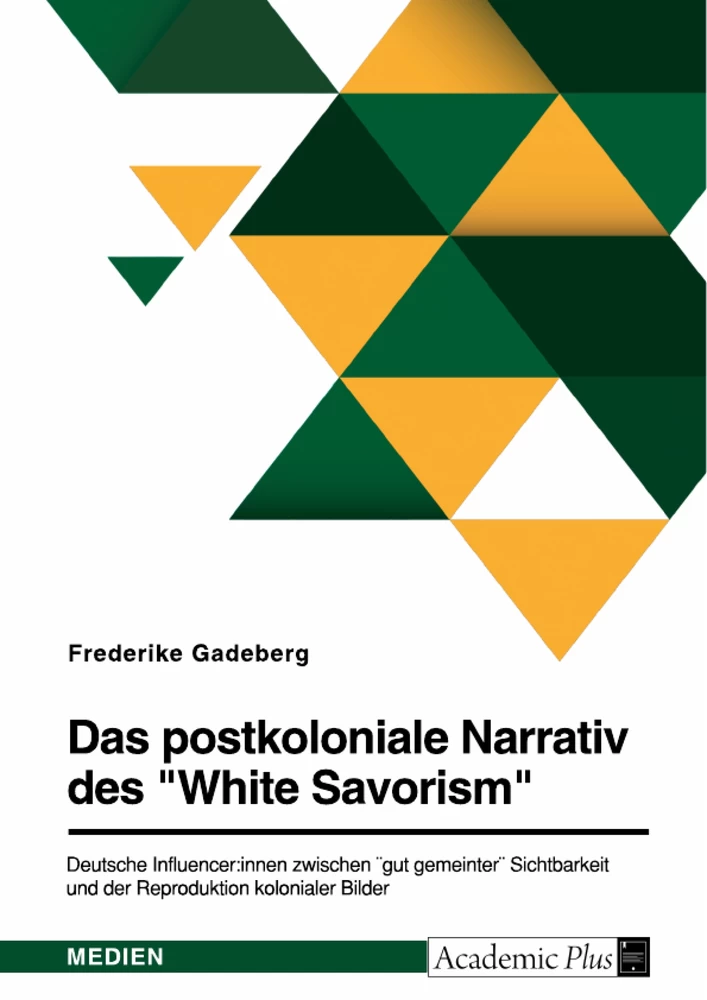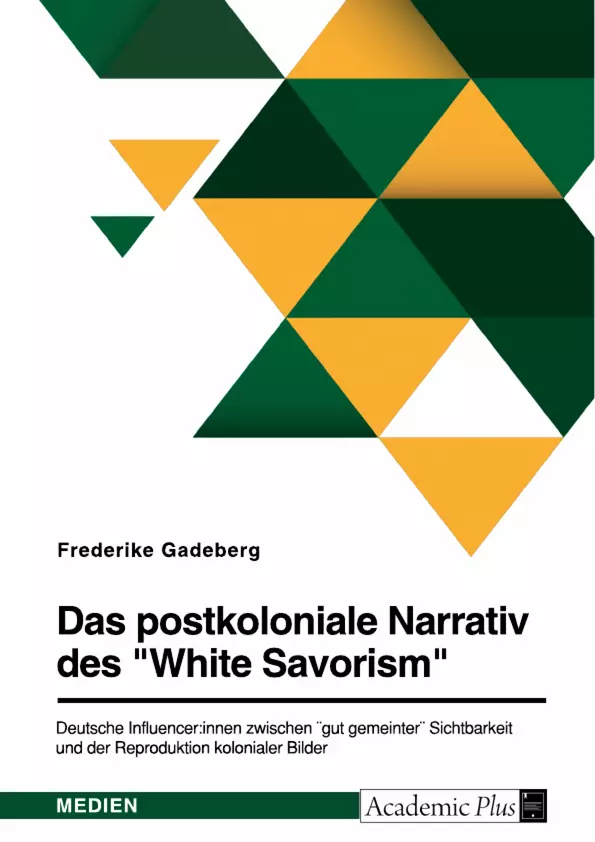Es zeigt sich, dass "White Saviorism" als postkoloniale Praxis vielerorts eine Debatte auslöst und sich dennoch eher im Bereich eines "Urban Dictionaries" verzeichnet. Vor diesem Hintergrund drängt sich die Frage auf, inwiefern sich die initiierten Begegnungen durch die Influencer:innen tatsächlich als Narrative von "White Saviorism" lesen lassen. Ausgehend von dem vorwissenschaftlichen Diskurs will diese Arbeit die polarisierenden an die Influencer:innen gerichtete Anschuldigungen mit akademischem Anspruch verhandeln – Wie verhält sich die These unter der Betrachtung wissenschaftlicher Maßstäbe?
In Anlehnung an Sand (2019) befindet sich im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit somit eine umfangreiche, jedoch qualitative Auswahl multimodaler Medientexte von Instagram-Auftritten der deutschen, weiß sozialisierten Influencer:innen Carmushka, Haticeschmidt und Fimbim. Hierbei eröffnen sich unterschiedliche Forschungsperspektiven: Da sich diese Arbeit im medienwissenschaftlichen Feld visueller Kultur verortet, liegt der Fokus der Betrachtung an der Grenze von "gut gemeinter" Sichtbarkeit und der Reproduktion kolonialer Bilder. Die Instagram-Performances werden als spezifische Fälle potenzieller Erscheinungsformen eines allgemeinen "White Saviorism"-Narrativs interpretiert und diskutiert. Als interdisziplinärer Gegenstand stellen die Medientexte die methodische Herangehensweise dieser Arbeit vor einige Herausforderungen: Das Thema erfordert einen dekonstruktiven Blick, so wie er in repräsentationskritischen Ansätzen zur Agenda gehört. Anstatt also eine einzige schematische Methodik abzuwickeln, verpflichtet sich die vorliegende Arbeit pluralistischen Untersuchungsmodi.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konzept statt Methode
- Theoretische Rahmung
- Denkweisen und Akteur:innen im post_kolonialen Diskurs
- Kolonialismus und neuere Anwendungsformen
- Rassismus als Maskierung und Weißsein als Demaskierung
- >White Saviorism<< - Eine Haltung weiß Sozialisierter?
- Instagram und seine Influencer:innen
- Zum medialen Dispositiv
- Influencer:innen, Medienschaffende, Content Creators?
- Medienwissenschaftliche Betrachtung
- Postkoloniale Medientheorie
- White Saviorism als Narrativ
- Instagram-Accounts als transmediale Erzählungen
- Drei Instagram-Erzählungen über das „Andere“ – Eine Analyse
- @carmushka - content creator & entrepreneur & mum
- Wie unglaublich perfekt kann ein Mensch sein?
- Das White Savior-Potenzial der Erzählung
- @haticeschmidt - Ihr Leben ist kein Zufall
- Wir waren die Gäste
- Das White Savior-Potenzial der Erzählung
- @fimbim „Zwischen Öko-Vorbild und enervierendem Neoliberalismus“
- Beton mischen syrienstyle
- Das White Savior-Potenzial der Erzählung
- Diskussion
- Ein eindrucksvoller weißer Individualismus
- Follower:innen als Mitgestalter:innen – Die Zustimmung des Publikums
- Vorgefundene Asymmetrien - Das „Andere“ im Gegensatz zum „Eigenen“
- Der Einfluss des Dispositivs
- Die Merkmale von Narzissmus und Männlichkeit
- Sichtbare Unsichtbarkeiten? Zum White Saviorism-Repräsentationsmodus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Darstellung von "White Saviorism" auf Instagram anhand von drei Influencer:innen-Accounts. Ziel ist es, die medialen Inszenierungen und ihre postkolonialen Implikationen zu analysieren und die Rolle der Follower:innen zu beleuchten.
- Analyse von "White Saviorism" als Narrativ auf Instagram
- Untersuchung der medialen Repräsentation von "Globaler Süden" und "Globaler Norden"
- Bedeutung von Instagram als transmediales Erzählmedium
- Rolle der Follower:innen in der Konstruktion und Rezeption des Narrativs
- Kritik an postkolonialen Machtstrukturen in den medialen Darstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert den Forschungsgegenstand: die Kritik an "White Saviorism" auf Instagram, veranschaulicht durch die Accounts von @Carmushka, @Haticeschmidt und @Fimbim. Sie führt den Begriff "White Saviorism" ein, beschreibt die Kritik von Fabienne Sand an der Inszenierung von Hilfeleistungen und zeigt den Zusammenhang zu postkolonialen Machtstrukturen auf. Die Einleitung verortet die Arbeit im Kontext aktueller antirassistischer Diskurse und benennt die methodische Herangehensweise.
Konzept statt Methode: Dieses Kapitel wird hier nicht zusammengefasst, da es sich vermutlich um methodische Überlegungen handelt.
Theoretische Rahmung: Dieses Kapitel bietet eine theoretische Grundlage für die Analyse. Es diskutiert Denkweisen und Akteure im postkolonialen Diskurs, beleuchtet koloniale und neokoloniale Machtstrukturen und den Begriff "White Saviorism", sowie die Rolle von Instagram und seinen Influencer:innen als mediales Dispositiv. Es werden konzeptionelle Grundlagen gelegt, die für die Analyse der Instagram-Accounts essentiell sind.
Medienwissenschaftliche Betrachtung: Dieses Kapitel befasst sich mit der medienwissenschaftlichen Perspektive auf das Thema. Es integriert postkoloniale Medientheorie und analysiert "White Saviorism" als Narrativ im Kontext von Instagram-Accounts als transmediale Erzählungen, und legt den Fokus auf die theoretische Einordnung der Phänomene.
Drei Instagram-Erzählungen über das „Andere“ – Eine Analyse: Dieses Kapitel analysiert drei ausgewählte Instagram-Accounts (@carmushka, @haticeschmidt, @fimbim) hinsichtlich ihrer Darstellung von Hilfeleistungen und Engagement im "Globalen Süden". Es untersucht die jeweiligen Narrative, die Inszenierung der Influencer:innen und die Reaktionen der Follower:innen. Die einzelnen Unterkapitel analysieren die Accounts detailliert und bewerten das "White Savior"-Potenzial in jeder Erzählung.
Diskussion: Dieses Kapitel wird hier nicht zusammengefasst, da es wahrscheinlich Schlussfolgerungen und Interpretationen der Ergebnisse enthält, welche im Rahmen einer Vorschau nicht gezeigt werden sollen.
Schlüsselwörter
White Saviorism, Instagram, Influencer:innen, Postkolonialismus, Medienanalyse, transmediales Erzählen, Globaler Süden, Globaler Norden, Rassismus, Machtstrukturen, mediale Repräsentation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von "White Saviorism" auf Instagram
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Darstellung von "White Saviorism" auf Instagram anhand von drei Influencer:innen-Accounts (@carmushka, @haticeschmidt, @fimbim). Im Fokus steht die Untersuchung der medialen Inszenierungen, ihrer postkolonialen Implikationen und die Rolle der Follower:innen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, "White Saviorism" als Narrativ auf Instagram zu analysieren, die mediale Repräsentation des "Globalen Südens" und "Globalen Nordens" zu untersuchen, die Bedeutung von Instagram als transmediales Erzählmedium zu beleuchten, die Rolle der Follower:innen in der Konstruktion und Rezeption des Narrativs zu ergründen und postkoloniale Machtstrukturen in den medialen Darstellungen zu kritisieren.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf postkoloniale Medientheorie und untersucht "White Saviorism" als Narrativ. Sie analysiert Instagram-Accounts als transmediale Erzählungen und betrachtet Instagram als mediales Dispositiv. Die theoretische Rahmung umfasst Denkweisen und Akteure im postkolonialen Diskurs, koloniale und neokoloniale Machtstrukturen und den Begriff "White Saviorism" selbst.
Welche Accounts werden analysiert und warum?
Die Analyse konzentriert sich auf drei Instagram-Accounts: @carmushka, @haticeschmidt und @fimbim. Die Auswahl dieser Accounts erfolgte aufgrund ihrer Relevanz für die Thematik des "White Saviorism" und ihrer exemplarischen Darstellung unterschiedlicher Aspekte dieses Narrativs. Die Accounts werden hinsichtlich ihrer Darstellung von Hilfeleistungen und Engagement im "Globalen Süden" untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Methodik ("Konzept statt Methode"), eine theoretische Rahmung, eine medienwissenschaftliche Betrachtung, eine detaillierte Analyse der drei ausgewählten Instagram-Accounts und eine abschließende Diskussion. Die Einleitung führt in die Thematik ein, während die Kapitel zur Methodik und Diskussion im vorliegenden Preview nicht im Detail zusammengefasst werden.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind White Saviorism, Instagram, Influencer:innen, Postkolonialismus, Medienanalyse, transmediales Erzählen, Globaler Süden, Globaler Norden, Rassismus, Machtstrukturen und mediale Repräsentation.
Welche Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Im Preview werden die Ergebnisse der einzelnen Kapiteln nur teilweise präsentiert. Die ausführliche Analyse der drei Instagram Accounts und die abschließende Diskussion werden erst in der vollständigen Arbeit vorgestellt. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet jedoch einen Einblick in die Struktur der Argumentation und die wichtigsten Forschungsfragen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler:innen, Studierende und Interessierte relevant, die sich mit Postkolonialismus, Medienwissenschaft, Instagram-Kultur und kritischen Analysen von Machtstrukturen auseinandersetzen. Der Fokus auf "White Saviorism" macht die Arbeit besonders relevant für die antirassistische Diskussion und die kritische Auseinandersetzung mit medialen Repräsentationen.
- Citar trabajo
- Frederike Gadeberg (Autor), 2021, Das postkoloniale Narrativ des "White Savorism". Deutsche Influencer:innen zwischen "gut gemeinter" Sichtbarkeit und der Reproduktion kolonialer Bilder, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1290552