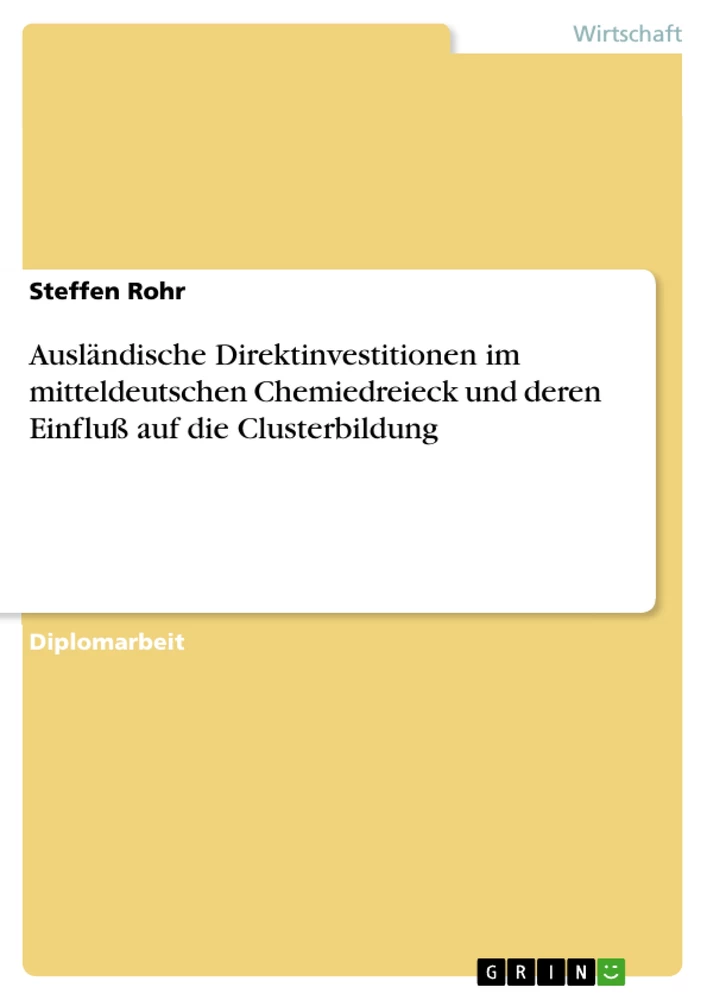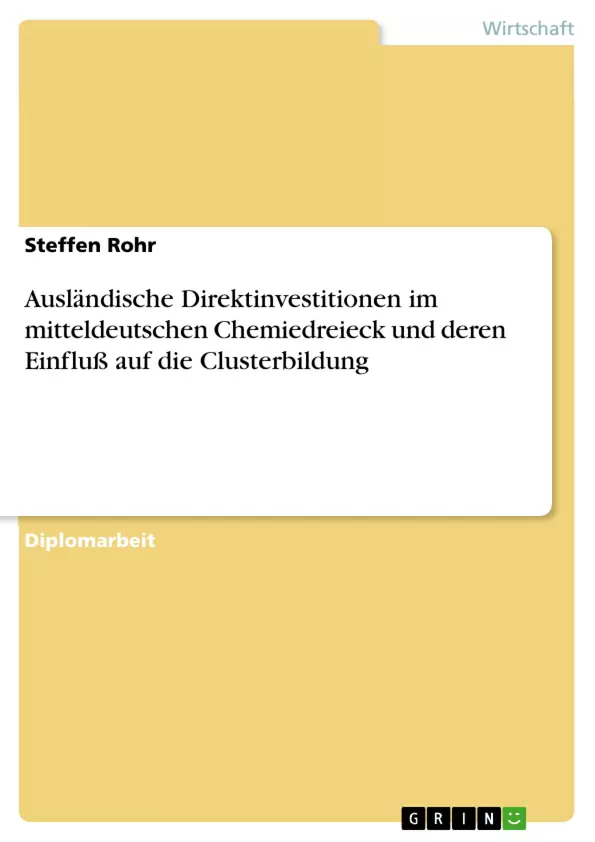Problemstellung und Ziel der Arbeit
Nach dem Zusammenbruch der DDR, nicht zuletzt verursacht durch den maroden wirtschaftlichen Zustand, kam es zu grundlegenden strukturellen Umbrüchen in allen Teilen der Gesellschaft. Die Transformation des wirtschaftlichen Systems von der Planwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt und sucht in der Geschichte ihresgleichen. Die DDR-Volkswirtschaft wurde in kürzester Zeit weltwirtschaftlichen Bedingungen unterworfen, dem die anachronistischen Strukturen im Osten Deutschlands1 nicht standhalten konnten. Mit Hilfe der Treuhandanstalt sollte eine wirtschaftliche Umstrukturierung gelingen, die eine sich selbsttragende und wettbewerbsfähige Ökonomie hervorbringen mußte. Unter dem Motto „schnelle Privatisierung, entschlossene Sanierung, behutsame Stillegung“ sollte der ostdeutsche Produktionsapparat zu internationalem Standard geführt werden. Die politische Realität setzte dabei hauptsächlich auf die Erzielung ökonomischer Erträge durch den Verkauf von Unternehmen. Diese einzelbetriebliche Sicht ging dabei nicht konform mit einer strukturpolitischen Orientierung. Als Resultat folgte die weitgehende Zerschlagung der industriellen Kerne in Ostdeutschland.
Nach mehr als zehn Jahren ist der Transformationsprozeß, zumindest ordnungspolitisch, weitgehend abgeschlossen. Der Lebensstandard hat sich dadurch für die meisten Ostdeutschen insgesamt verbessert. Dennoch sind die fünf neuen Bundesländer von der Leistungskraft der westdeutschen Wirtschaft weit entfernt. Die „blühenden Landschaften“ konzentrieren sich nur auf einige wenige regionale Wachstumspole und das Bruttoinlandsprodukt als entscheidender Regionalindikator, hinkt dem westdeutschen weiter hinterher. Im Jahre 2001 lag das BIP im Osten bei 61 Prozent des Westniveaus und erreichte zu 75 Prozent den EU-Durchschnitt. Die enorme Produktionslücke resultiert aus der zu geringen ostdeutschen Wertschöpfung. Die ostdeutsche Nachfrage liegt über 40 Prozent höher als die ostdeutsche Produktion und wird zu einem großen Teil über Transferzahlungen aus dem Westen künstlich am Leben gehalten. Es mangelt vorwiegend an großen und innovativen Unternehmen, die sowohl Arbeitsplätze als auch regionale Wettbewerbsfähigkeit durch technologischen Fortschritt schaffen und die viel zu geringe Exportquote anheben. Die Arbeitslosenquote von ca. 18 Prozent stellt das Schlüsselproblem Ostdeutschlands dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit
- 1.2 Aufbau und Vorgehensweise
- 2. Grundlagen
- 2.1 Ausländische Direktinvestitionen
- 2.1.1 Arbeitsdefinition der ausländischen Direktinvestition
- 2.1.2 Die weltweite Entwicklung ausländischer Direktinvestitionen
- 2.1.3 Deutschland im Wettbewerb um ausländische Direktinvestitionen
- 2.2 Das mitteldeutsche Chemiedreieck
- 2.2.1 Regionale- und branchenspezifische Abgrenzung des mitteldeutschen Chemiedreiecks
- 2.2.2 Meilensteine der Entwicklung dieses industriellen Kernes
- 2.3 Cluster als Bestandteil wettbewerbsfähiger Standorte
- 2.3.1 Allgemeine Fragen zur Definition von Clustern
- 2.3.2 Beispiele von Clustern im globalen Standortwettbewerb
- 2.3.3 Clusterpolitik als integrierte Strategie regionaler Wirtschaftspolitik
- 3. Erklärungsansätze internationaler Investitionstätigkeit und der Clusterbildung
- 3.1 Ausgewählte Theorien zur Erklärung von ausländischen Direktinvestitionen
- 3.1.1 Die Theorie des monopolistischen Wettbewerbsvorteils
- 3.1.2 Internalisierungtheorie nach Buckley und Casson
- 3.1.3 Die Theorie des oligopolistischen Parallelverhaltens
- 3.1.4 Eklektische Theorie der internationalen Produktion von Dunning
- 3.1.5 Weitere Erklärungsansätze
- 3.1.6 Fazit dieser Betrachtung
- 3.2 Ansätze der internationalen Standorttheorie
- 3.2.1 Der Ansatz von Sabathil
- 3.2.2 Der Ansatz von Goette
- 3.2.3 Der Ansatz von Tesch
- 3.3 Empirische einzelwirtschaftliche Motivforschung ausländischer Direktinvestitionen
- 3.3.1 Absatzorientierung
- 3.3.2 Kosten- und Effizienzorientierung
- 3.3.3 Strategische Orientierung
- 3.3.4 Orientierung an staatlichen Rahmenbedingungen
- 3.4 Ableitung von Vermutungen für die Untersuchung im mitteldeutschen Chemiedreieck
- 3.5 Ansätze zur Erklärung von Clustern
- 3.5.1 Die kalifornische Schule der Wirtschaftsgeographie
- 3.5.2 Der Nachweis anhand der Wertschöpfungskette
- 3.5.2.1 Der Ansatz von Porter
- 3.5.2.2 Der Ansatz von Rehfeld
- 4. Internationales Investitionskapital im mitteldeutschen Chemiedreieck und dessen Einfluß auf die Clusterbildung - eine exemplarische Fallstudie -
- 4.1 Zur Besonderheit des mitteldeutschen Chemiedreiecks als Untersuchungsobjekt
- 4.2 Vorgehensweise und Bestandteile der Untersuchung
- 4.2.1 Zum Design der statistischen Erhebung
- 4.2.2 Die Struktur der einbezogenen Unternehmen
- 4.3 Analyse der ausländischen Direktinvestitionen
- 4.3.1 Der Investitionsprozeß
- 4.3.2 Ergebnisse der Investitionen
- 4.3.3 Motive ausländischer Investoren
- 4.3.4 Das mitteldeutsche Chemiedreieck als Standort der chemischen Industrie
- 4.3.4.1 Evaluierung der Standortqualität
- 4.3.4.2 Zukunftsorientierte Engpässe des Standortes
- 4.3.5 Bewertung der EU-Osterweiterung
- 4.3.6 Transformation der Untersuchungsergebnisse auf die theoretischen Ansätze
- 4.4 Interdependenzen zwischen ausländischen Direktinvestitionen und der Clusterbildung im mitteldeutschen Chemiedreieck
- 4.4.1 Beurteilung des mitteldeutschen Chemiedreiecks als Cluster
- 4.4.1.1 Clusterumfeld nach dem "Porter'schen Diamanten"
- 4.4.1.2 Nachweis anhand der Wertschöpfungskette
- 4.4.2 Entstehungsvariablen der Clusterbildung
- 4.4.3 Positive Externalität des Clusters auf ausländische Direktinvestitionen
- 4.4.3.1 Kostenvorteile
- 4.4.3.2 Technologie Spillovers
- 4.4.4 Fazit der Clusterbetrachtungen
- 4.5 Strategiekonzept zur Prosperierung des mitteldeutschen Chemiedreiecks
- 4.5.1 Clusterpolitik zur Verbesserung der Netzwerkstruktur
- 4.5.1.1 Clustermanagement als organisatorischer Kern
- 4.5.1.2 Definition von strategischen Aufgabenfeldern
- 4.5.2 Sicherung der Standortqualität
- 4.5.3 Einzelwirtschaftlicher Verantwortungsbereich
- Analyse der Theorie ausländischer Direktinvestitionen und Clusterbildung
- Empirische Untersuchung der Investitionen im mitteldeutschen Chemiedreieck
- Beurteilung des Chemiedreiecks als Cluster nach dem Porter'schen Diamanten
- Bewertung der Auswirkungen der EU-Osterweiterung
- Entwicklung eines Strategiekonzepts zur Prosperierung des Chemiedreiecks
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen ausländischer Direktinvestitionen im mitteldeutschen Chemiedreieck auf die Clusterbildung. Ziel ist es, die theoretischen Erklärungsansätze für ausländische Direktinvestitionen und Clusterbildung zu beleuchten und mit empirischen Ergebnissen zu vergleichen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Investitionsmotiven, -prozessen und -ergebnissen sowie auf die Identifizierung von Interdependenzen zwischen Direktinvestitionen und Clusterentwicklung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit dar. Kapitel 2 behandelt die Grundlagen ausländischer Direktinvestitionen, des mitteldeutschen Chemiedreiecks und der Clusterbildung. Kapitel 3 erörtert verschiedene Theorien zur Erklärung von Direktinvestitionen und Clusterbildung. Die empirische Untersuchung in Kapitel 4 analysiert ausländische Direktinvestitionen im Chemiedreieck und untersucht deren Einfluss auf die Clusterbildung. Das Kapitel beinhaltet zudem eine Beurteilung des Chemiedreiecks als Cluster und die Entwicklung eines Strategiekonzepts zur Prosperierung der Region. Die Arbeit schliesst mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse ab.
Schlüsselwörter
Ausländische Direktinvestitionen, mitteldeutsches Chemiedreieck, Clusterbildung, Standortfaktoren, Investitionsmotive, Clusterpolitik, Porter'scher Diamant, EU-Osterweiterung
Häufig gestellte Fragen zum mitteldeutschen Chemiedreieck
Was ist das Ziel der Clusterbildung im Chemiedreieck?
Ziel ist die Schaffung eines wettbewerbsfähigen Netzwerks aus Unternehmen, Forschung und Dienstleistern, um technologischen Fortschritt und regionale Wertschöpfung zu fördern.
Welchen Einfluss haben ausländische Direktinvestitionen (ADI)?
ADI bringen Kapital, Know-how und internationale Märkte in die Region. Sie sind entscheidend für die Sanierung und Modernisierung der ehemals maroden DDR-Industrie.
Was besagt der „Porter’sche Diamant“ in diesem Kontext?
Dieses Modell von Michael Porter wird genutzt, um die Standortqualität des Chemiedreiecks anhand von Faktoren wie Nachfragebedingungen und verwandten Branchen zu evaluieren.
Wie wirkte sich die Treuhandanstalt auf die Region aus?
Die Treuhand forcierte die Privatisierung. Dies führte einerseits zur Zerschlagung alter Strukturen, legte aber auch den Grundstein für neue, internationale Investitionen.
Was sind die größten Probleme Ostdeutschlands nach der Wende?
Zu den Hauptproblemen gehören die hohe Arbeitslosigkeit, eine zu geringe Eigenproduktion im Vergleich zur Nachfrage und der Mangel an innovativen Großunternehmen.
- Arbeit zitieren
- Steffen Rohr (Autor:in), 2003, Ausländische Direktinvestitionen im mitteldeutschen Chemiedreieck und deren Einfluß auf die Clusterbildung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12908