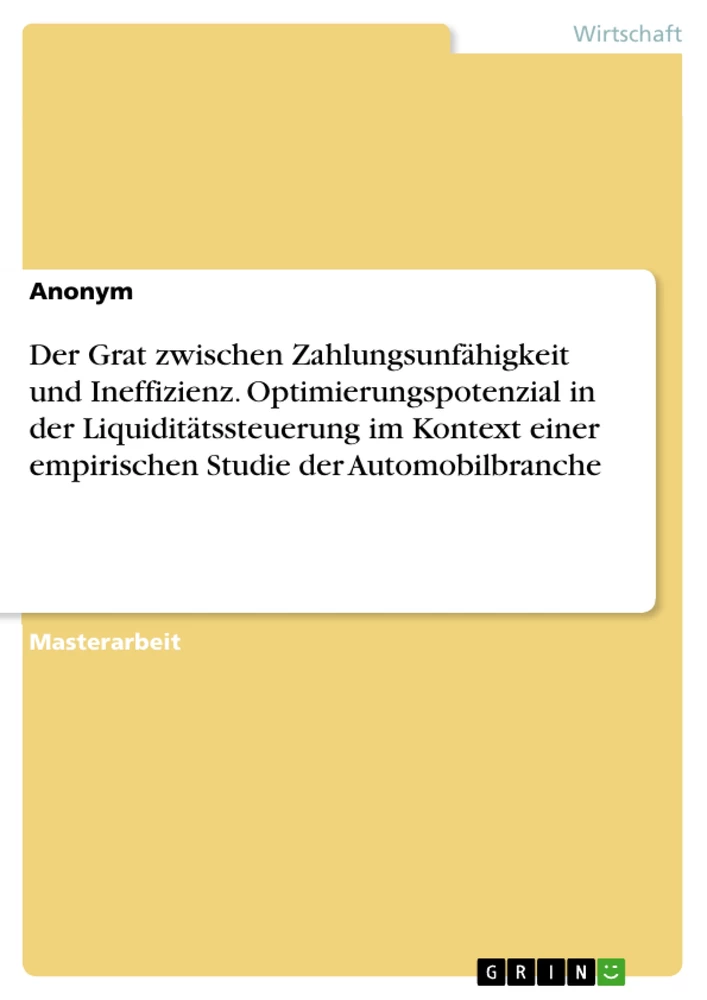In der vorliegenden Arbeit soll das Thema Liquidität und deren Steuerung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit fokussiert werden. Die Verbesserung der Liquiditätssteuerung und damit die Generierung einer höheren Rentabilität, das heißt einer Steigerung des wirtschaftlichen Erfolgs, sind zwar vorrangige Intention dieser Arbeit. Nicht unwesentlich ist allerdings auch, dass durch die Verschärfung der Eigenkapitalrichtlinien (Basel III) die Banken verstärkt auf cashorientierte Kennzahlen im externen Reporting achten. Auch wenn Begriffe wie Supply Chain Finance oder Working Capital Management zunehmend in der Praxis thematisiert werden, sehen sich Unternehmen häufig mit der Problematik konfrontiert, dass nur wenige praxisrelevante Lösungsansätze bezüglich des richtigen Maßes an liquiden Mitteln bestehen. Das Ziel dieser Arbeit soll demnach sein, durch eine empirische Analyse ausgewählter Automobilkonzerne die Notwendigkeit einer Optimierung der Liquiditätsbestände zunächst aufzuzeigen, um darauf aufbauend eine risikoadjustierte, kennzahlengestützte Liquiditätssteuerung abzuleiten.
Die Existenz jedes Unternehmens bedingt die Fähigkeit, fällige Zahlungsverpflichtungen jederzeit uneingeschränkt erfüllen zu können. Sollte das Unternehmen dazu nicht in der Lage sein, muss es aufgrund seiner Zahlungsunfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 InsO die Insolvenz anmelden. Das wichtigste Instrumentarium zur Sicherung des langfristigen Bestandes eines Unternehmens ist daher ein permanentes Liquiditätsmanagement. Die Liquiditätssteuerung sollte allerdings nicht nur das Ziel verfolgen, die bloße Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, sondern auch unnötig hohe Liquiditätsreserven vermeiden, um Rentabilitätspotenziale heben zu können. Da sich die deutsche Wirtschaft trotz geopolitischer Flüchtlings- und anhaltender Eurokrise durch eine robuste Konjunktur, steigende Exportquoten und sinkende Arbeitslosigkeit auszeichnet, wurde die Allokation der Liquiditätsbestände unter Rentabilitätsgesichtspunkten in den letzten Jahren vernachlässigt. Doch angesichts vieler noch nicht bzw. nur unzureichend gelöster volkswirtschaftlicher und finanzwirtschaftlicher Probleme bleibt abzuwarten, wie lange Deutschland als Gewinner der Krise hervorgeht. Aber auch ohne eine mögliche Verschlechterung der Konjunktur haben sich die Herausforderungen am Markt durch sich ständig verändernde ökonomische Rahmenbedingungen verschärft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretische Grundlagen zur Liquidität, deren Messung und Bewertung
- 2.1 Definition von Liquidität und deren Träger
- 2.2 Die Messung und Bewertung von Liquidität
- 2.3 Die Bedeutung von Liquidität im Rahmen der Unternehmenssteuerung
- 3. Empirische Studie zur Angemessenheit von liquiden Mitteln im Unternehmen anhand einer Auswertung von Liquiditätskennzahlen der Automobilbranche
- 3.1 Ausgangssituation
- 3.2 Material und Methoden
- 3.3 Vorstellung der Unternehmen
- 3.4 Vorstellung der Liquiditätskennzahlen
- 3.4.1 Liquiditätsgrade
- 3.4.2 Working Capital
- 3.4.3 Cashflow (CF)
- 3.5 Ergebnisse
- 3.5.1 Der Kassenbestand
- 3.5.2 Die Liquiditätsgrade
- 3.5.3 Das Working Capital
- 3.5.4 Der Cashflow
- 3.5.5 Umsatz und Umsatzwachstum
- 3.6 Zusammenfassende Interpretation und Bewertung der Ergebnisse
- 4. Mögliche Einsparungspotentiale von Opportunitätskosten mithilfe alternativer Kennzahlensysteme zur optimalen Ausrichtung der Liquiditätsbestände
- 4.1 Die Ausrichtung der Liquiditätsgrade an den Sollwerten der Literatur
- 4.1.1 Liquiditätsgrad I ± 25%
- 4.1.2 Liquiditätsgrad II ± 100%
- 4.1.3 Liquiditätsgrad III ± 150%
- 4.2 Die Ausrichtung des Liquiditätsbestandes am C2C-Zyklus
- 4.2.1 Ausrichtung des Liquiditätsgrades I an der Working Capital Ratio
- 4.2.2 Ausrichtung des Liquiditätsgrades III an der Working Capital Ratio
- 4.3 Projektion der Parameter aus 2008 auf die Jahre 2009-2014
- 4.3.1 Konstantes Verhältnis von Kassenbestand zu Bilanzsumme
- 4.3.2 Konstantes Verhältnis von Kassenbestand zu Umsatzerlöse
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterthesis befasst sich mit der Optimierung des Liquiditätsbestands im Kontext einer empirischen Studie der Automobilbranche. Die Arbeit untersucht, inwieweit Unternehmen in der Automobilbranche ihren Liquiditätsbestand effizient steuern können, um unnötige Opportunitätskosten zu vermeiden.
- Analyse der Liquiditätskennzahlen in der Automobilbranche
- Untersuchung von Einsparungspotenzialen durch optimierte Liquiditätsverwaltung
- Entwicklung alternativer Kennzahlensysteme zur optimalen Ausrichtung des Liquiditätsbestandes
- Bedeutung von Liquidität für die Unternehmenssteuerung
- Bewertung der Angemessenheit von liquiden Mitteln in Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Dieses Kapitel stellt die Problemstellung der Arbeit vor und erläutert die Forschungsziele.
- Es beschreibt den Aufbau der Arbeit und die verwendeten Methoden.
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen zur Liquidität
- Dieses Kapitel definiert den Begriff der Liquidität und beleuchtet deren Träger.
- Es erläutert verschiedene Mess- und Bewertungsmethoden für Liquidität.
- Es verdeutlicht die Bedeutung von Liquidität für die Unternehmenssteuerung.
- Kapitel 3: Empirische Studie zur Angemessenheit von liquiden Mitteln
- Dieses Kapitel beschreibt die empirische Studie, die zur Untersuchung der Liquidität in der Automobilbranche durchgeführt wurde.
- Es stellt die Daten und Methoden der Studie vor sowie die untersuchten Unternehmen.
- Es präsentiert die Ergebnisse der Analyse verschiedener Liquiditätskennzahlen, wie Liquiditätsgrade, Working Capital und Cashflow.
- Kapitel 4: Mögliche Einsparungspotentiale
- Dieses Kapitel untersucht alternative Kennzahlensysteme zur optimalen Ausrichtung der Liquiditätsbestände.
- Es analysiert verschiedene Szenarien, um mögliche Einsparungspotentiale von Opportunitätskosten zu ermitteln.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel der Studie zur Liquiditätssteuerung in der Automobilbranche?
Das Ziel der Arbeit ist es, durch eine empirische Analyse von Automobilkonzernen die Notwendigkeit einer Optimierung der Liquiditätsbestände aufzuzeigen und eine risikoadjustierte, kennzahlengestützte Steuerung abzuleiten.
Warum ist die Liquiditätssteuerung für Unternehmen heute so wichtig?
Neben der Sicherung der Zahlungsfähigkeit achten Banken aufgrund verschärfter Eigenkapitalrichtlinien (Basel III) verstärkt auf cashorientierte Kennzahlen. Zudem hilft eine optimierte Steuerung, unnötig hohe Reserven zu vermeiden und die Rentabilität zu steigern.
Welche Kennzahlen werden in der empirischen Studie untersucht?
Die Studie analysiert verschiedene Liquiditätsgrade (I, II und III), das Working Capital sowie den Cashflow der ausgewählten Automobilunternehmen.
Was versteht man unter dem "Grat zwischen Zahlungsunfähigkeit und Ineffizienz"?
Unternehmen müssen genug Liquidität vorhalten, um nicht insolvent zu werden (§ 17 InsO), aber zu hohe Reserven führen zu Ineffizienz, da dieses Kapital nicht rentabel investiert wird (Opportunitätskosten).
Welche Rolle spielt der Cash-to-Cash-Zyklus (C2C) in der Arbeit?
Der C2C-Zyklus wird als alternatives Steuerungsinstrument herangezogen, um die Liquiditätsgrade optimal an der Working Capital Ratio auszurichten und Einsparungspotenziale zu identifizieren.
Welche externen Faktoren erschweren die Liquiditätsplanung laut Abstract?
Geopolitische Krisen (wie die Flüchtlingskrise), die Eurokrise und sich ständig verändernde ökonomische Rahmenbedingungen fordern ein permanentes und dynamisches Liquiditätsmanagement.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Der Grat zwischen Zahlungsunfähigkeit und Ineffizienz. Optimierungspotenzial in der Liquiditätssteuerung im Kontext einer empirischen Studie der Automobilbranche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1290840