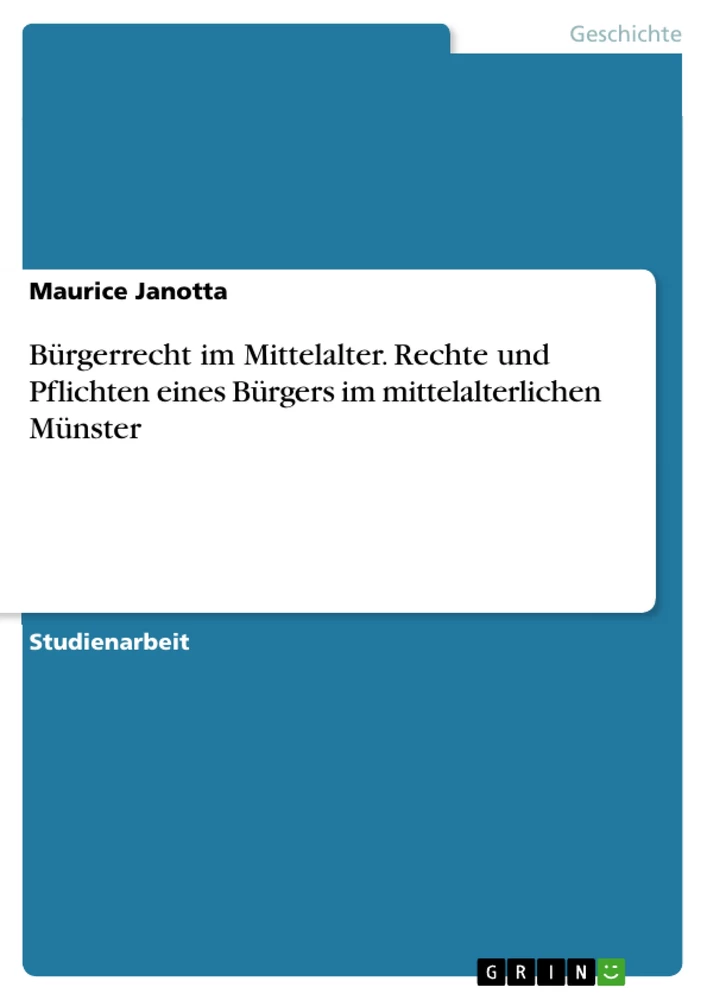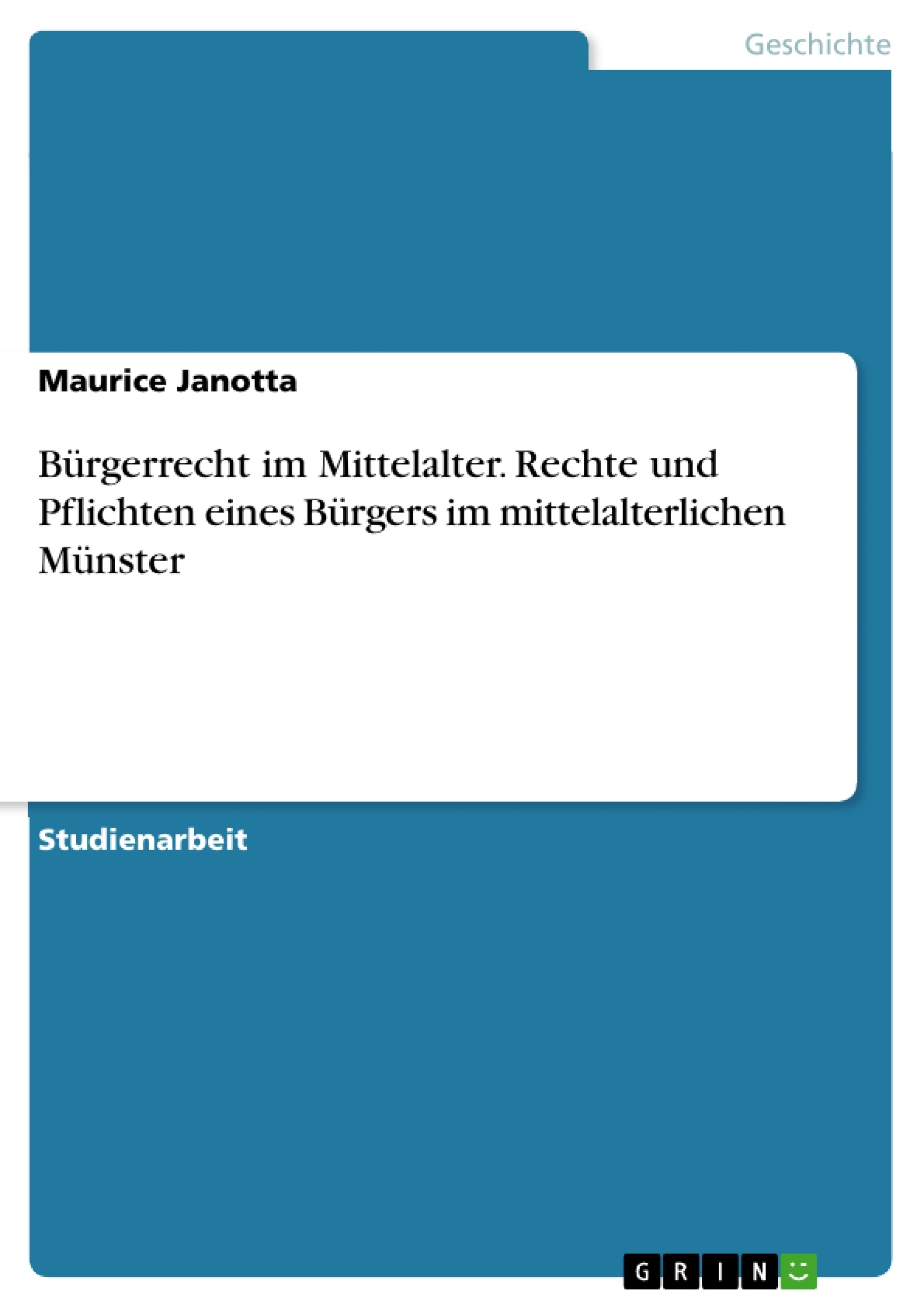Die Arbeit stellt eine Untersuchung zu den Bürgerrechten in der mittelalterlichen deutschen Stadt dar. Beispielhaft wird dabei die Stadt Münster herangezogen. Neben der beruflichen Tätigkeit unterschied sich das Leben eines Städters vor allem in rechtlichen Fragen von dem eines auf dem Land lebenden Bauern. Freies Erbrecht, Befreiung von Zoll sowie von Abgaben und eine eigene Gerichtsbarkeit waren einige der Privilegien, die sich Menschen durch ihre Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Bürger (communitas civiim) erhofften. Außerdem war die Möglichkeit zur politischen Mitbestimmung und somit die aktive Gestaltung der Rechtsgrundlagen in einer Stadt von zentraler Bedeutung.
Wer aber tatsächlich direkt von diesen Privilegien profitieren konnte, definierte das Bürgerrecht. Denn es war nicht wie heute, dass die Zugehörigkeit als Bürger zu einer Stadt durch einen einfachen behördlichen Gang im Sinne einer An- bzw. Ummeldung getan wäre. Vielmehr mussten zahlreiche Voraussetzungen erfüllt werden, um die Vollbürgerschaft zu erlangen, welche zudem einerseits von Stadt zu Stadt und andererseits von Zeit zu Zeit verschieden waren.
Ziel dieser Arbeit ist es, dieses Bürgerrecht durch diese Forschungsfragen einmal genauer zu definieren: Wer konnte das Bürgerrecht erlangen und welche Voraussetzungen musste er dabei erfüllen? Welche Rechte und Privilegien kamen einem Stadtbewohner bei der Erlangung des (vollen) Bürgerrechts zuteil und welche Pflichten erlegte er sich auf? Was führte gegebenenfalls zu einem Verlust des Bürgerrechtes?
Der untersuchte Zeitraum erstreckt sich dabei von dem Ende des Hochmittelalters bis zum fortgeschrittenen Spätmittelalter, in dem die kommunale Bewegung bereits einige Ergebnisse erzielte und eventuell reglementierende Bischöfe und Stadtherren ihre vorherrschaftliche Stellung in den Städten oft stark eingebüßt hatten oder gar ganz vertrieben wurden. Genauer soll er hier um den Zeitraum etwa ab dem Jahr 1200 gehen, als in vielen Städten ein bürgerlich-städtischer Rat und damit mehr oder weniger eine gewisse Selbstverwaltung durch die Bürger aufkam.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Literatur, Quellen und Forschungsstand
- 2. Begriffsklärung Bürger und Bürgerrecht
- 2.1. Gemeinschaft der Bürger; communitas civium
- 2.2. Bürgerrecht
- 3. Münster im Mittelalter
- 3.1. Das an Bielefeld verliehene Stadtrecht
- 3.1.1. Rechte und Privilegien des Bürgers
- 3.1.2. Pflichten des Bürgers
- 3.1.3. Kontextualisierung
- 3.2. Bürgerrecht in der späteren Stadtgeschichte
- 3.2.1. Rechte und Privilegien des Bürgers
- 3.2.2. Pflichten des Bürgers und Ausschluss aus der Bürgerschaft
- 5. Quellenverzeichnis
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Bürgerrecht in der mittelalterlichen Stadt, exemplarisch anhand der Stadt Münster. Die zentralen Fragestellungen befassen sich mit den Voraussetzungen für den Erwerb des Bürgerrechts, den damit verbundenen Rechten und Pflichten sowie den Gründen für einen möglichen Verlust des Bürgerrechts. Der Fokus liegt auf dem Zeitraum ab ca. 1200, als städtische Selbstverwaltung an Bedeutung gewann.
- Definition von Bürger und Bürgerrecht im Mittelalter
- Rechte und Privilegien der Bürger in Münster
- Pflichten und mögliche Sanktionen für Bürger
- Entwicklung des Bürgerrechts in Münster im Spätmittelalter
- Vergleich des münsterschen Bürgerrechts mit anderen Städten (implizit durch den Kontext)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Bürgerrecht im mittelalterlichen Deutschland ein und benennt Münster als Fallbeispiel. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Voraussetzungen, Rechten, Pflichten und dem möglichen Verlust des Bürgerrechts. Der Fokus liegt auf dem Zeitraum ab etwa 1200, einer Phase, in der die kommunale Bewegung bereits Fortschritte erzielt hatte. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz und die verwendeten Quellen.
1.1. Literatur, Quellen und Forschungsstand: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Forschungsstand zum Thema mittelalterliches Stadtleben und Bürgerrecht. Es erwähnt wichtige Werke wie Isenmanns "Die deutsche Stadt im Mittelalter" und Kroeschells "Deutsche Rechtsgeschichte", hebt aber auch die enorme Fülle an Literatur hervor. Besondere Beachtung findet die Arbeit von Engel und Jacob, "Städtisches Leben im Mittelalter," sowie Schulte's "Die Verfassungsgeschichte Münsters" als spezifische Quelle für Münster. Die Auswahl des Quellenmaterials wird begründet.
2. Begriffsklärung Bürger und Bürgerrecht: Dieses Kapitel widmet sich der Klärung der Begriffe „Bürger“ und „Bürgerrecht“. Es differenziert zwischen den verschiedenen Gruppen von Menschen, die in einer mittelalterlichen Stadt lebten, und untersucht, wer das volle Bürgerrecht erlangen konnte. Es beleuchtet mögliche rechtliche Abstufungen und den Ausschluss bestimmter Gruppen von der Bürgerschaft. Dieses Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der spezifischen Situation in Münster.
3. Münster im Mittelalter: Dieses Kapitel behandelt die Stadt Münster im Mittelalter. Nach einer kurzen Charakterisierung der Bischofsstadt wird deren Bürgerrecht im Detail untersucht, wobei verschiedene Urkunden herangezogen werden, um die Entwicklung des Bürgerrechts über die Zeit zu beleuchten und zu präzisieren. Es werden sowohl Rechte und Privilegien als auch Pflichten und der Ausschluss aus der Bürgerschaft thematisiert. Die Rolle des Stadtrechts und die Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung in Münster werden in diesem Kapitel eingehend analysiert.
Schlüsselwörter
Bürgerrecht, Mittelalter, Münster, Stadtgeschichte, communitas civium, Rechte, Pflichten, Stadtrecht, kommunale Selbstverwaltung, Rechtliche Abstufungen, Quellenforschung, Rechtsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bürgerrecht im mittelalterlichen Münster
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht das Bürgerrecht in der mittelalterlichen Stadt Münster. Sie analysiert die Voraussetzungen für den Erwerb des Bürgerrechts, die damit verbundenen Rechte und Pflichten sowie die Gründe für einen möglichen Verlust des Bürgerrechts. Der Fokus liegt auf der Zeit ab ca. 1200, als städtische Selbstverwaltung an Bedeutung gewann.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition von Bürger und Bürgerrecht im Mittelalter, Rechte und Privilegien der Bürger in Münster, Pflichten und mögliche Sanktionen für Bürger, Entwicklung des Bürgerrechts in Münster im Spätmittelalter und einen impliziten Vergleich des münsterschen Bürgerrechts mit anderen Städten durch Kontextualisierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in das Thema und die Forschungsfrage. Kapitel 1.1 (Literatur, Quellen und Forschungsstand): Überblick über den Forschungsstand und die verwendeten Quellen. Kapitel 2 (Begriffsklärung Bürger und Bürgerrecht): Klärung der zentralen Begriffe. Kapitel 3 (Münster im Mittelalter): Detaillierte Untersuchung des Bürgerrechts in Münster, inklusive Rechte, Pflichten und Ausschluss aus der Bürgerschaft. Kapitel 3 ist untergliedert in 3.1 (Das an Bielefeld verliehene Stadtrecht) mit Unterkapiteln zu Rechten und Privilegien, Pflichten und Kontextualisierung und 3.2 (Bürgerrecht in der späteren Stadtgeschichte) mit Unterkapiteln zu Rechten und Privilegien sowie Pflichten und Ausschluss aus der Bürgerschaft. Kapitel 5 (Quellenverzeichnis) und Kapitel 6 (Literaturverzeichnis) runden die Arbeit ab.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Quellen, darunter wichtige Werke zur deutschen Stadt im Mittelalter (z.B. Isenmann, Kroeschell) und spezifische Quellen zur Geschichte Münsters (z.B. Engel und Jacob, Schulte). Das Kapitel 1.1 gibt einen detaillierten Überblick über den verwendeten Quellenbestand.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Bürgerrecht, Mittelalter, Münster, Stadtgeschichte, communitas civium, Rechte, Pflichten, Stadtrecht, kommunale Selbstverwaltung, Rechtliche Abstufungen, Quellenforschung, Rechtsgeschichte.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz, der sich auf die Analyse von Quellen und Literatur stützt, um das Bürgerrecht in Münster zu rekonstruieren und zu analysieren.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler und Studierende, die sich mit dem Thema mittelalterliches Bürgerrecht, Stadtgeschichte und Rechtsgeschichte auseinandersetzen.
Wo finde ich das vollständige Inhaltsverzeichnis?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis findet sich am Anfang des Dokuments und beinhaltet alle Kapitel und Unterkapitel.
- Quote paper
- Maurice Janotta (Author), 2022, Bürgerrecht im Mittelalter. Rechte und Pflichten eines Bürgers im mittelalterlichen Münster, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1291430