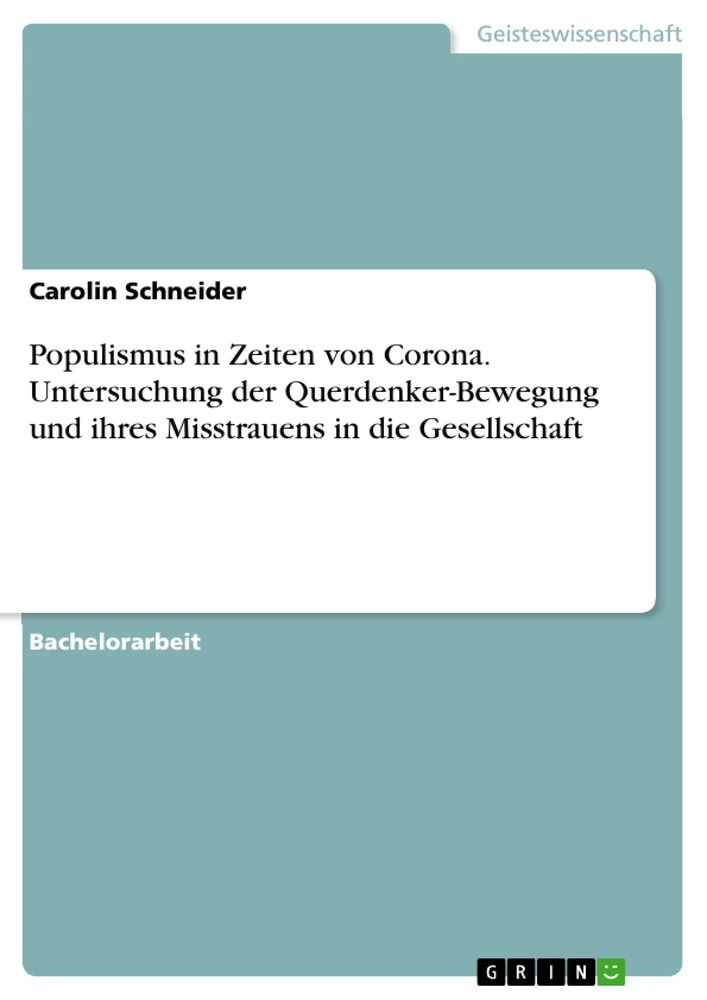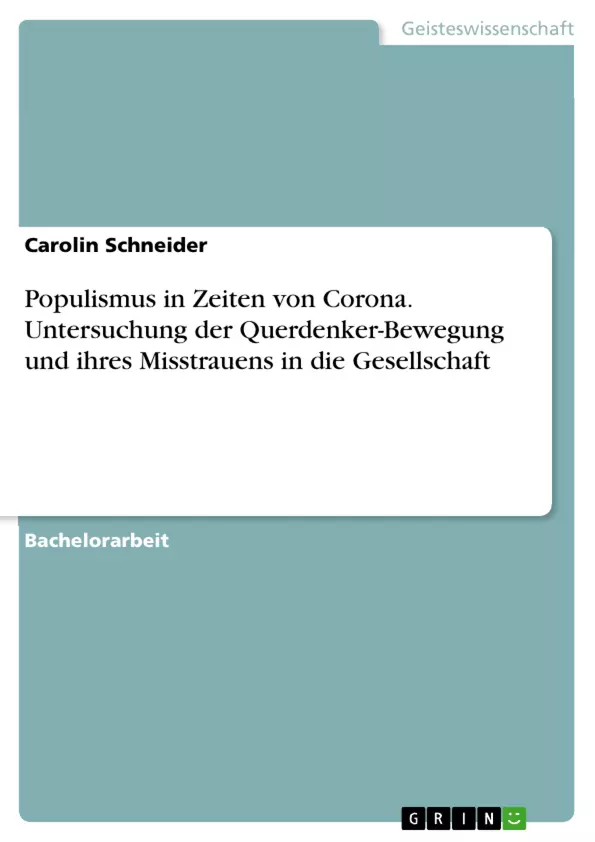Diese wissenschaftliche Arbeit dient der Untersuchung der Querdenker*innen-Bewegung, ihrer Strukturen, Aktionen sowie ihres generellen Misstrauens in die Gesellschaft. Aber eben nicht nur, wie sich solche populistischen Organisationen erschließen, sondern warum insbesondere das Phänomen der Querdenken-Bewegung einen solchen heterogenen Zuspruch gewinnt. Das Ergebnis zeigt auf, inwiefern solche populistischen Zusammenschlüsse eine Gefahr für die Demokratie und das friedliche Zusammenleben aller darstellen. Die Arbeit fokussiert sich auf den Zeitraum seit dem ersten Auftreten des Virus bis einschließlich Januar 2022.
Die seit Anfang 2020 weltweit präsente Corona-Pandemie veränderte unsere aller Alltag. Neben dem Gesundheitsrisiko einer Infektion schränkt sie seither viele Lebensbereiche ein. Medizinische oder FFP-2 Maskenpflicht in vielen öffentlichen Räumen, immer wieder aufkommende Kontaktbeschränkungen, Balance zwischen Homeoffice und teilweise lückenhafter Kinderbetreuung, Absage von zahlreichen Großveranstaltungen, Reiseeinschränkungen und vieles mehr. Inmitten dieser, durch eine globale Pandemie angegriffenen Gesellschaft wächst fast unbemerkt ein weiteres Problem heran: Die Querdenker*innen-Bewegung organisierte sich bemerkenswert rapide und verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Bundesrepublik.
Die Mitglieder der Bewegung sehen sich durch die Infektionsschutzmaßnahmen der Bundesregierung in der Nutzung ihrer Grundrechte eingeschränkt. Die Debatten rund um Maskenpflicht und um die Schutzimpfungen erhöhen die Angriffsfläche der Politik. Diese Schwachstellen nutzen die Querdenker*innen aus, um die von ihnen geglaubte „Wahrheit“ ans Licht zu bringen. Sie formulieren ihre Forderungen offen auf Demonstrationen und Kundgebungen, zusätzlich nutzen sie auch aktiv soziale Medien wie den Instant-Messaging Dienst Telegram, um dort ihre eigenen Theorien und Meinung preiszugeben und um sich zu mobilisieren. Sowohl Politiker*innen als auch Verfassungsschützer*innen und unabhängige Journalist*innen sehen die Querdenker*innen-Bewegung als akute Demokratiegefährdung. Auch gilt es zu bedenken, was nach Ende der Pandemie mit dieser Bewegung passieren wird. Hier befürchtet der Verfassungsschutz, dass die verbreiteten Verschwörungstheorien nicht verschwinden werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Chronik der Pandemie
- 3. QUERDENKEN als populistische Protestbewegung
- 4. Entstehung der Querdenker-Bewegung
- 4.1 Organisation der Gruppe und ihre Kommunikationskanäle
- 4.2 Wandel der Protestformen
- 4.3 Betrachtung des Gesellschaftsmodelles des SINUS-Institutes (SINUS-Milieus)
- 5. Soziodemografische Einordnung und das politische Profil der Querdenker*innen
- 5.1 Verschwörungsmentalität
- 5.2 Misstrauen in politische Institutionen und Kritik an den etablierten Medien
- 6. Fazit
- 7. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Querdenker-Bewegung im Kontext der Corona-Pandemie und analysiert ihr Misstrauen gegenüber der Gesellschaft und staatlichen Institutionen. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Bewegung, ihre Organisationsstrukturen und Kommunikationswege sowie ihr soziodemografisches Profil. Ein zentrales Ziel ist es, das Phänomen des heterogenen Zuspruchs an die Bewegung zu erklären und deren potenzielle Gefahr für die Demokratie zu bewerten.
- Entstehung und Entwicklung der Querdenker-Bewegung
- Organisationsstrukturen und Kommunikationsstrategien der Bewegung
- Soziodemografisches Profil der Querdenker*innen und ihre politischen Einstellungen
- Das Misstrauen der Querdenker*innen gegenüber staatlichen Institutionen und Medien
- Die potenzielle Gefahr der Querdenker-Bewegung für die Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und beschreibt den Kontext der Corona-Pandemie und das Aufkommen der Querdenker-Bewegung. Sie hebt die Bedeutung der Untersuchung der Bewegung und ihres Misstrauens in die Gesellschaft hervor und skizziert die Forschungsfragen der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Analyse der Strukturen, Aktionen und des allgemeinen Misstrauens der Bewegung, sowie auf der Frage, warum die Bewegung so heterogenen Zuspruch erfährt und welche Gefahr sie für die Demokratie darstellt. Der betrachtete Zeitraum umfasst die Zeit vom ersten Auftreten des Virus bis Januar 2022.
2. Chronik der Pandemie: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Verlauf der Corona-Pandemie, von den ersten Berichten über den Ausbruch in Wuhan bis zu den Entwicklungen in Deutschland und Europa. Es beinhaltet relevante Ereignisse, Entscheidungen und Daten, die als Grundlage für die spätere Analyse der Querdenker-Bewegung dienen. Es zeichnet den Verlauf der Pandemie nach und beleuchtet die Reaktionen der Politik und die öffentliche Wahrnehmung. Der Fokus liegt auf der Schaffung einer deskriptiven Grundlage der Ereignisse und auf der Hervorhebung von Aspekten, die für die spätere Analyse relevant sind, beispielsweise die Debatte um die Impfpflicht.
3. QUERDENKEN als populistische Protestbewegung: Dieses Kapitel analysiert die Querdenker-Bewegung als populistische Protestbewegung. Es beleuchtet die zentralen Merkmale der Bewegung, ihre Strategien und ihr narratives Vorgehen. Es wird die Rolle von sozialen Medien und die Verbreitung von Verschwörungstheorien untersucht, sowie die Einordnung der Bewegung in den Kontext anderer populistischer Bewegungen. Das Kapitel wird sich mit der Kommunikation und Mobilisierung der Bewegung auseinandersetzen und das Phänomen des heterogenen Zuspruchs analysieren. Die Bedeutung und Wirkung der Protestformen werden ebenfalls beleuchtet.
4. Entstehung der Querdenker-Bewegung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entstehung und Entwicklung der Querdenker-Bewegung. Es untersucht die organisatorischen Strukturen und Kommunikationskanäle der Bewegung sowie den Wandel ihrer Protestformen. Die Analyse der sozialen und politischen Milieus, welche die Bewegung prägen und aus denen sie ihren Zuspruch rekrutiert, wird im Kontext des SINUS-Institutes untersucht. Die Kapitelteil untersuchen die Entwicklung und Veränderung von Organisationsstrukturen und Strategien, welche die Querdenker-Bewegung für ihre Mobilisierung einsetzt.
5. Soziodemografische Einordnung und das politische Profil der Querdenker*innen: Dieses Kapitel untersucht die soziodemografische Zusammensetzung und das politische Profil der Mitglieder der Querdenker-Bewegung. Es analysiert die Verbreitung von Verschwörungstheorien innerhalb der Bewegung und das Misstrauen gegenüber politischen Institutionen und etablierten Medien. Das Kapitel wird die Hintergründe der Teilnehmenden untersuchen, um zu verstehen, welche Faktoren zur Beteiligung beitragen und wie sich die Bewegung in die bestehende Gesellschaft einordnet. Die Analyse der Verschwörungsmentalität und des Misstrauens gegenüber etablierten Institutionen ist zentral.
Schlüsselwörter
Querdenker-Bewegung, Corona-Pandemie, Populismus, Verschwörungstheorien, Misstrauen, Gesellschaft, Demokratie, soziale Medien, Protest, politische Institutionen, Soziodemografie, SINUS-Milieus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: "Die Querdenker-Bewegung im Kontext der Corona-Pandemie"
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Querdenker-Bewegung während der Corona-Pandemie. Der Fokus liegt auf der Analyse ihres Misstrauens gegenüber der Gesellschaft und staatlichen Institutionen, ihrer Entstehung, Entwicklung, Organisationsstrukturen, Kommunikationswege und ihres soziodemografischen Profils. Ein zentrales Ziel ist es, den heterogenen Zuspruch an die Bewegung zu erklären und deren potenzielle Gefahr für die Demokratie zu bewerten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Entwicklung der Querdenker-Bewegung, ihre Organisationsstrukturen und Kommunikationsstrategien, das soziodemografische Profil ihrer Anhänger*innen und deren politische Einstellungen, ihr Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und Medien sowie die potenzielle Gefahr der Bewegung für die Demokratie. Die Arbeit analysiert auch die Bewegung als populistische Protestbewegung und untersucht die Rolle von sozialen Medien und die Verbreitung von Verschwörungstheorien.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Chronik der Pandemie, Querdenken als populistische Protestbewegung, Entstehung der Querdenker-Bewegung (inkl. Organisation, Kommunikationskanäle, Wandel der Protestformen und Betrachtung der SINUS-Milieus), Soziodemografische Einordnung und das politische Profil der Querdenker*innen (inkl. Verschwörungsmentalität und Misstrauen in Institutionen/Medien), Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit einem Aspekt der Querdenker-Bewegung.
Welchen Zeitraum betrachtet die Arbeit?
Der betrachtete Zeitraum umfasst die Zeit vom ersten Auftreten des Virus bis Januar 2022.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Analyse, die auf der Auswertung von öffentlich verfügbaren Informationen, Berichten und Studien basiert. Die Analyse der SINUS-Milieus bietet zusätzliche Einblicke in die soziodemografische Zusammensetzung der Bewegung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Querdenker-Bewegung, Corona-Pandemie, Populismus, Verschwörungstheorien, Misstrauen, Gesellschaft, Demokratie, soziale Medien, Protest, politische Institutionen, Soziodemografie, SINUS-Milieus.
Was ist das zentrale Ergebnis der Arbeit?
(Diese Frage kann erst nach Lesen des vollständigen Textes beantwortet werden. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet jedoch Einblicke in die Ergebnisse der einzelnen Kapitel.)
Welche Bedeutung hat die Arbeit?
Die Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Querdenker-Bewegung und ihrer Bedeutung für die Gesellschaft und die Demokratie. Sie analysiert ein relevantes Phänomen der jüngeren Geschichte und bietet Erkenntnisse zu den Ursachen und Folgen solcher Bewegungen.
- Quote paper
- Carolin Schneider (Author), 2022, Populismus in Zeiten von Corona. Untersuchung der Querdenker-Bewegung und ihres Misstrauens in die Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1291551