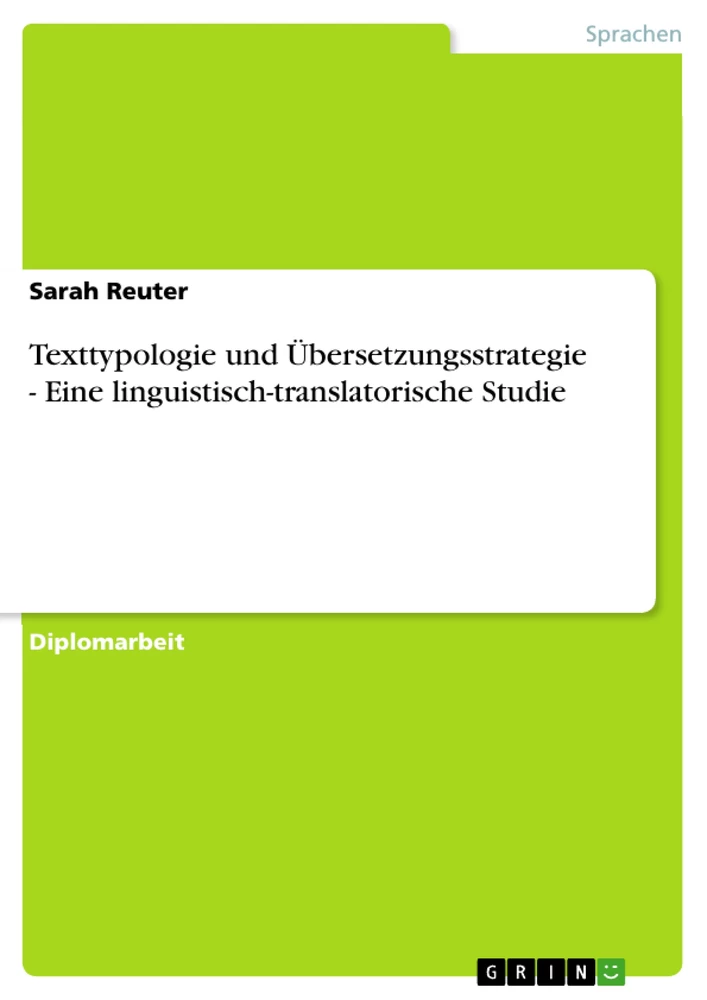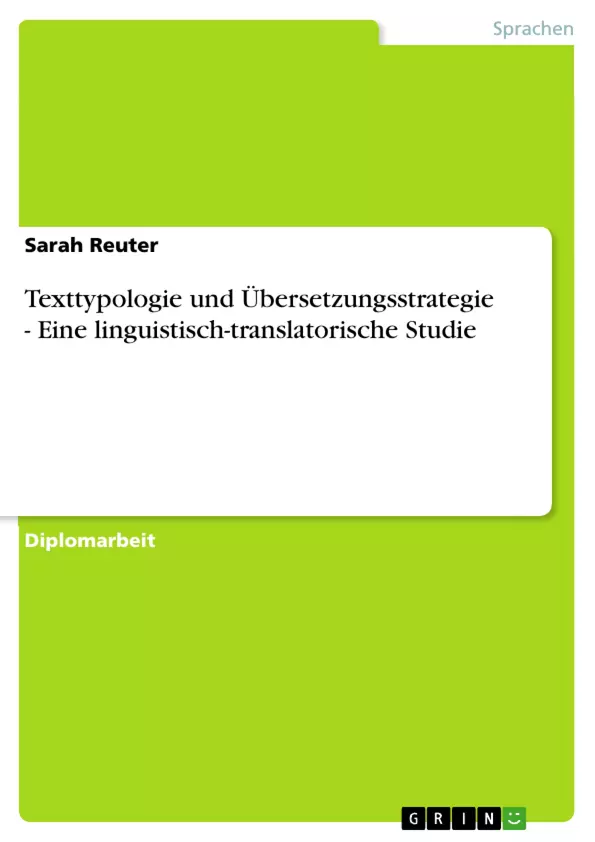Wo eine Ansammlung von Dingen vorhanden ist, ergibt sich oft auch das Bedürfnis, diese Dinge zu klassifizieren, das heißt Gruppen mit jeweils bestimmten gemeinsamen Eigenschaften zu bilden. Bei der Feststellung von Gemeinsamkeiten treten zugleich auch Unterschiede zwischen einzelnen Elementen einer Gruppe deutlicher hervor. Es kann also die Verallgemeinerung bzw. das Zusammenfügen von einzelnen Elementen zu einer Serie durchaus Mittel zur Bewußtmachung der Vielfalt sein.
Bemerkenswerterweise sind in diesen Tagen (28. September 2001 bis 6. Januar 2002) die Effekte der Serie Thema einer Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle. Sie trägt den Titel „Monets Vermächtnis. Serie – Ordnung und Obsession“. Der Impressionist Monet wandte das Prinzip der Serie bei vielen seiner Werke an. Unter anderem schuf er eine Reihe von Bildern mit Heuschobern, zu denen beispielsweise die Gemälde Heuschober bei Sonnenuntergang, Heuschober, Sommerende am Morgen und Heuschober, Sommerende am Abend gehören. Dargestellt wird jeweils ein ähnliches Motiv, das durch veränderte Lichtverhältnisse vollkommen unterschiedlich wirkt. Durch die Einheitlichkeit des Motivs wird die Aufmerksamkeit des Betrachters auf bestimmte feine Unterschiede gelenkt. Diese Art der Darstellung ermöglicht eine neue Sichtweise des vermeintlich Bekannten. Ungeachtet der Verschiedenheiten ordnet jedoch der Betrachter die wahrgenommenen Objekte einer einheitlichen Klasse zu. Eine solche Klassifizierung dient – gebunden an die ihr zugrundeliegende Interpretation der Wirklichkeit – zugleich auch als Verständnishilfe für das Erkennen von Zusammenhängen innerhalb einer gegebenen Menge von Elementen.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Abgrenzung des Themas
- 2 Kriterien zur übersetzungsbezogenen Analyse von Textsortenmodellen
- 2.1 Vorbemerkungen
- 2.2 Mindestanforderungen an Modelle im allgemeinen
- 2.3 Mindestanforderungen an wissenschaftliche Modelle
- 2.4 Der Übersetzer
- 2.5 Mindestanforderungen an übersetzungsbezogene Textsortenmodelle
- 3 Textsortenmodelle und übersetzungsbezogene Analyse
- 3.1 Das Modell von Katharina Reiss
- 3.1.0 Grundlagen zum Verständnis des Reiss'schen Modells: Das Kommunikationsmodell von Karl Bühler
- 3.1.1 Vorbemerkungen
- 3.1.2 Sprachwissenschaftlicher Zugang
- 3.1.3 Kommunikationstheoretischer Zugang
- 3.1.4 Die übersetzungsrelevante Texttypologie
- 3.1.5 Texttyp und Übersetzungsmethode
- 3.1.6 Übersetzungsbezogene Analyse des Reiss'schen Modells
- 3.2 Das Modell von Egon Werlich
- 3.2.1 Texte
- 3.2.2 Textgruppen
- 3.2.3 Texttypen
- 3.2.4 Textformen
- 3.2.5 Textformvarianten und Kompositionsmuster
- 3.2.6 Textexemplare
- 3.2.7 Übersetzungsbezogene Analyse des Werlichschen Modells
- 3.3 Das Modell von Georges Mounin
- 3.3.1 Die religiöse Übersetzung
- 3.3.2 Die literarische Übersetzung
- 3.3.3 Die lyrische Übersetzung
- 3.3.4 Die Kinderbuch-Übersetzung
- 3.3.5 Die Bühnenübersetzung
- 3.3.6 Die Filmübersetzung
- 3.3.7 Die technische Übersetzung
- 3.3.8 Übersetzungsbezogene Analyse des Mouninschen Modells
- 3.4 Das Modell von Albrecht Neubert
- 3.4.1 Komponenten der sprachlichen Kommunikation
- 3.4.2 Beziehungen zwischen den einzelnen Komponenten
- 3.4.3 Pragmatik und Übersetzung
- 3.4.4 Übersetzungstypen
- 3.4.5 Übersetzbarkeit
- 3.4.6 Übersetzungsbezogene Analyse des Neubertschen Modells
- 4 Abgrenzung der Erklärungskraft der einzelnen Ansätze
- 4.1 Eindimensionalität von Typologien
- 4.2 Kontext und Zweck der Übersetzung
- 5 Übersetzungsstrategische Ansätze als Alternative zur Orientierung an Texttypologien
- Kriterien zur übersetzungsbezogenen Analyse von Textsortenmodellen
- Anwendung verschiedener Textsortenmodelle auf die Übersetzungspraxis
- Abgrenzung der Erklärungskraft der einzelnen Ansätze
- Übersetzungsstrategische Ansätze als Alternative zur Orientierung an Texttypologien
- Bedeutung von Kontext und Zweck für die Übersetzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der linguistischen Analyse von Texttypologien und deren Relevanz für die Übersetzungspraxis. Das Ziel ist es, die Eignung verschiedener Textsortenmodelle für die Übersetzung zu bewerten und ihre Stärken und Schwächen aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung
Die Einleitung erläutert die Bedeutung von Klassifikationssystemen im Allgemeinen und stellt die Relevanz von Texttypologien in der Linguistik dar. Dabei werden auch die unterschiedlichen Ansätze und Ziele der Textklassifizierung aufgezeigt.
1 Abgrenzung des Themas
Dieses Kapitel grenzt das Thema der Arbeit ein und legt den Fokus auf die Bedeutung von Texttypologien für die Übersetzungspraxis. Es werden die Unterschiede zwischen textlinguistischen und übersetzungsbezogenen Texttypologien beleuchtet.
2 Kriterien zur übersetzungsbezogenen Analyse von Textsortenmodellen
Das Kapitel präsentiert die wichtigsten Kriterien, die für die Beurteilung der Eignung von Texttypologien für die Übersetzung relevant sind. Dabei werden die Anforderungen an Modelle im Allgemeinen, an wissenschaftliche Modelle, an den Übersetzer selbst und schließlich an übersetzungsbezogene Textsortenmodelle betrachtet.
3 Textsortenmodelle und übersetzungsbezogene Analyse
In diesem Kapitel werden verschiedene Textsortenmodelle vorgestellt und hinsichtlich ihrer Eignung für die Übersetzungspraxis analysiert. Dazu werden die Modelle von Katharina Reiss, Egon Werlich, Georges Mounin und Albrecht Neubert im Detail betrachtet. Es werden die Grundlagen der jeweiligen Modelle, ihre Anwendbarkeit auf die Übersetzung und ihre Stärken und Schwächen diskutiert.
4 Abgrenzung der Erklärungskraft der einzelnen Ansätze
Dieses Kapitel analysiert die Grenzen der Erklärungsleistung der verschiedenen Textsortenmodelle. Es werden die Probleme der Eindimensionalität von Typologien und die Bedeutung von Kontext und Zweck für die Übersetzung herausgestellt.
5 Übersetzungsstrategische Ansätze als Alternative zur Orientierung an Texttypologien
In diesem Kapitel werden alternative Ansätze zur Orientierung an Texttypologien in der Übersetzungspraxis vorgestellt. Es werden verschiedene Übersetzungsstrategien diskutiert, die von der Texttypologie unabhängig sind.
Schlüsselwörter
Texttypologie, Übersetzung, Textsortenmodelle, Kommunikationsmodell, Sprachwissenschaft, Textlinguistik, Pragmatik, Übersetzungsstrategie, Kontext, Zweck.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Texttypologien für Übersetzer wichtig?
Texttypologien helfen Übersetzern, die Funktion eines Textes zu bestimmen und daraus die passende Übersetzungsstrategie abzuleiten.
Was ist das Besondere am Modell von Katharina Reiss?
Reiss unterscheidet Texte nach ihrer Funktion (informativ, expressiv, operativ) und verknüpft diese direkt mit spezifischen Übersetzungsmethoden.
Welche Rolle spielt die Pragmatik beim Übersetzen?
Die Pragmatik berücksichtigt den Kontext und die Absicht des Sprechers, was entscheidend für die Wirkung der Übersetzung in der Zielsprache ist.
Gibt es Grenzen für Textsortenmodelle?
Ja, viele Modelle sind eindimensional. Die Arbeit zeigt auf, dass auch der Zweck (Skopos) und der Kontext der Übersetzung oft wichtiger sind als die reine Textsorte.
Was versteht Egon Werlich unter Texttypen?
Werlich klassifiziert Texte nach kognitiven Kategorien wie Beschreibung, Erzählung, Exposition, Argumentation und Instruktion.
Welche Alternativen gibt es zur Orientierung an Texttypologien?
Übersetzungsstrategische Ansätze, die sich stärker am Zielpublikum und der beabsichtigten Wirkung orientieren, bieten oft flexiblere Lösungen.
- Quote paper
- Sarah Reuter (Author), 2002, Texttypologie und Übersetzungsstrategie - Eine linguistisch-translatorische Studie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12922