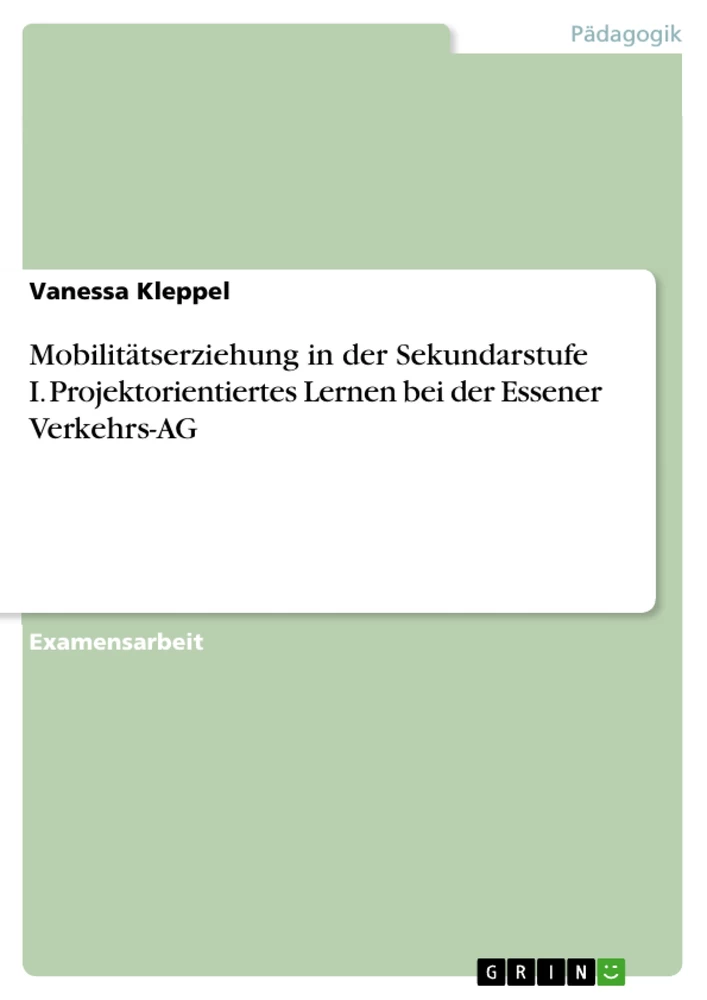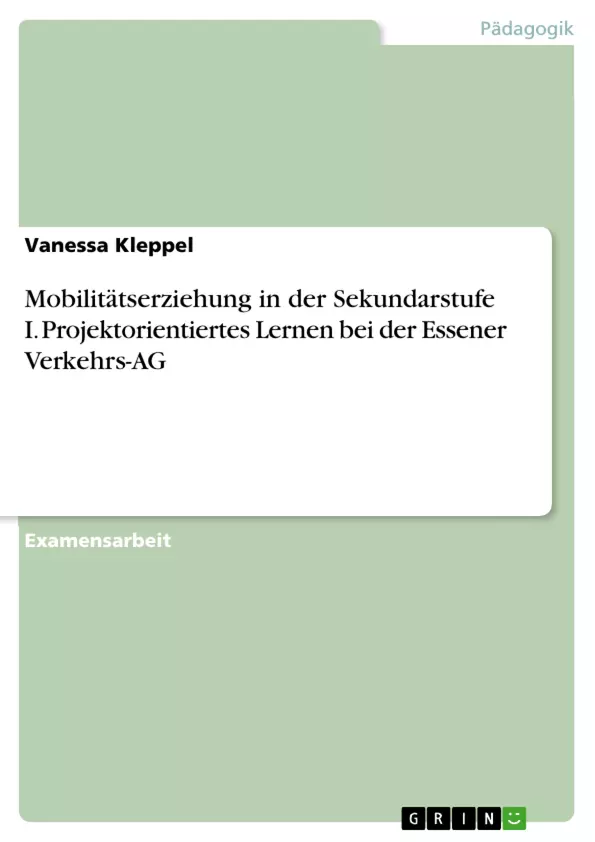Diese Examensarbeit wird sich mit der Thematik der Verkehrs- und Mobilitätserziehung im Kindesalter und der Vorbereitung und Festigung des Weges zu weiterführenden Schulen, der häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad bewältigt werden muss, befassen. Es ist das angestrebte Ziel, die Kinder und Jugendlichen im Verkehr zu sichern und zu schützen, denn Verkehrsunfälle sind die häufigsten Todesursachen im Kindes- und Jugendalter. Das Ziel, Kinder zu verantwortungsbewussten Verkehrsteilnehmern auszubilden, kann jedoch nur erreicht werden, wenn den Kindern und Jugendlichen verkehrssichere Tipps vermittelt werden und sie sich dementsprechende Verhaltensweisen aneignen.
Doch um Kindern ein verantwortungsvolles und sicheres Verhalten zu ermöglichen, ist eine Unterrichtsform erforderlich, die aktive Teilnahme und eigenständiges Handeln miteinander verbindet. Dies bietet die Projektmethode. Die Projektmethode umfasst lebensnahes Lernen, indem die Öffnung der Schule gewährleistet wird. Es kommt zur Verknüpfung zwischen schulischem und außerschulischem Lebensraum. Besonders für den Bereich der Schulwegsicherung ist die Lehr- und Lernsituation im realen Straßenverkehr mit typischen Verkehrssituationen von immenser Bedeutung.
Allerdings wird in dieser Arbeit nicht ausschließlich theoretisch über projektorientierten Unterricht diskutiert, sondern das Thema Projektunterricht und Verkehrserziehung durch ein Praxisbeispiel verbunden: das Beispiel der EVAG-Busschule.
Inhaltsverzeichnis
- A. THEORETISCHER TEIL
- 1. EINLEITUNG
- 2. UNTERRICHT
- 2.1 DEFINITION UND MERKMALE VON UNTERRICHT
- 2.2 PLANUNG UND ORGANISATION VON UNTERRICHT
- 2.3 PRINZIPIEN EFFEKTIVEN UNTERRICHTS
- 3. UNTERRICHTSFORM PROJEKTUNTERRICHT – EIN HISTORISCHER ABRISS
- 3.1 ENTSTEHUNG UND HERKUNFT DES PROJEKTUNTERRICHTS
- 3.2 DER PROJEKTGEDANKE BEI JOHN DEWEY UND WILLIAM H. KILPATRICK
- 3.3 ABGRENZUNG DES PROJEKTBEGRIFFS
- 4. AKTUELLE KONZEPTIONEN DES PROJEKTUNTERRICHTS
- 4.1 DIE PROJEKTMETHODE NACH KARL FREY
- 4.2 DIE PROJEKTMETHODE NACH HERBERT GUDJONS
- 4.3 FAZIT
- 5. MERKMALE DES PROJEKTUNTERRICHTS
- 5.1 HANDLUNGSORIENTIERUNG
- 5.2 GANZHEITLICHKEIT
- 5.3 SCHÜLERORIENTIERUNG
- 5.4 SELBSTORGANISATION
- 5.5 PRODUKTIONSORIENTIERUNG
- 6. DIE METHODE DES PROJEKTUNTERRICHTS ALS FORM DES OFFENEN UNTERRICHTS
- 6.1 DEFINITION, MERKMALE UND ZIELE OFFENEN UNTERRICHTS
- 6.2 INWIEWEIT IST DER PROJEKTUNTERRICHT OFFEN?
- 7. ZIELE DES PROJEKTUNTERRICHTS
- 8. MÖGLICHKEITEN DES PROJEKTUNTERRICHTS
- 9. NOTWENDIGKEIT DES PROJEKTUNTERRICHTS IN DER SCHULE
- 9.1 DER WANDEL DER KINDLICHEN LEBENSWELT
- 9.2 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHE BEGRÜNDUNG – JEAN PIAGET
- 9.3 DIE BEDEUTUNG DER VERÄNDERTEN KINDHEIT UND DER ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE FÜR DIE SCHULE UND DEN UNTERRICHT
- 10. PROJEKTTYPEN
- 10.1 ERKUNDUNGSPROJEKTE
- 10.2 FORSCHUNGSPROJEKTE
- 10.3 GESTALTUNGSPROJEKT
- 11. BEWERTEN UND ZENSIEREN IM PROJEKTUNTERRICHT
- 12. GRENZEN DES PROJEKTUNTERRICHTS
- 13. MOBILITÄT VON KINDERN UND DIE DAMIT VERBUNDENE NOTWENDIGKEIT DER VERKEHRSERZIEHUNG IN DER SEKUNDARSTUFE I
- 13.1 DIE NOTWENDIGKEIT DER MOBILITÄTSERZIEHUNG IN DER SCHULE
- 13.2 ZIELE UND SCHWERPUNKTE DER VERKEHRS- UND MOBILITÄTSERZIEHUNG
- 13.3 SCHULWEGUNFÄLLE VERSCHIEDENER MOBILITÄTSFORMEN IM STRAẞENVERKEHR
- 13.3.1 Fahrradunfälle
- 13.3.2 Fußgängerunfälle
- 13.3.3 ÖPNV- und Schulbusunfälle
- 13.4 ÖPNV ALS THEMA IN DER MOBILITÄTSERZIEHUNG IN DER SEKUNDARSTUFE I
- 13.5 POSITIVE FAKTOREN DER NUTZUNG DES ÖPNV
- 13.6 PRÄVENTIONSMAẞNAHMEN
- 14. VERKEHRSUNTERNEHMEN UND DIE ARBEIT MIT SCHULEN
- 14.1 VERKEHRSPÄDAGOGISCHE ZUSAMMENARBEIT VON SCHULEN UND BETRIEBEN
- 14.2 DIE ESSENER VERKEHRS-AG
- B PRAKTISCHER TEIL
- 15. VERKEHRSPÄDAGOGISCHE UNTERRICHTSSEQUENZ IN KOOPERATION VON SCHULEN MIT AUBERSCHULISCHEN PARTNERN IM SINNE DER VERKEHRSERZIEHUNG AM THEMA BUS UND BAHN - EVAG MACHT SCHULE
- 15.1 GRUNDLAGEN ZUR EVAG-BUSSCHULE
- 15.2 VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG DER BUSSCHULE
- 15.2.1 Einführender Unterricht
- 15.2.1.1 Vorstellung der ÖPNV-Mittel
- 15.2.1.2 Die ALLbert-Folien
- 15.2.1.3 Der Fahrplan
- 15.2.1.4 Erklärung des Arbeitsblattes
- 15.2.1.5 Arbeitsphase
- 15.2.1.6 Besprechung der Ergebnisse
- 15.2.2 Übungen auf dem Betriebshof der EVAG
- 15.2.2.1 Frühstückspause in der Betriebshofkantine
- 15.2.2.2 Der Nothammer und Notausstieg
- 15.2.2.3 Erklärung der Schilder im und am Bus
- 15.2.2.4 Praktische Übung: Die Einklemmprobe
- 15.2.2.5 Ausschwenkprobe beim An- und Abfahren an der Haltestelle
- 15.2.2.6 Den Bus aus Sicht des Busfahrers erleben
- 15.2.2.7 Die Bremsprobe mit Tommy
- 15.2.3 Die EVAG-Rallye
- 15.2.3.1 Die Einteilung der Gruppen
- 15.2.3.2 Die Rallye
- 15.2.3.3 Der Schoko-Pass
- 15.2.4 Fazit
- 16. DIE INTEGRATION DER BUSSCHULE ALS TEILASPEKT EINES MÖGLICHEN PROJEKTS IN DER SEKUNDARSTUFE I
- 16.1 DIE MÖGLICHE PROJEKTDURCHFÜHRUNG NACH KARL FREY IM DEUTSCHUNTERRICHT
- 16.2 PROJEKTDURCHFÜHRUNG DES PROJEKTUNTERRICHTS NACH HERBERT GUDJONS IM RELIGIONS- BZW. ETHIKUNTERRICHT
- 16.2.1 Projektskizze
- 16.2.2 Der Projekttag
- 17. SCHLUSSWORT
- 18. LITERATURVERZEICHNIS
- Projektorientierter Unterricht als effektive Methode für die Vermittlung von Verkehrssicherheit
- Die Bedeutung der Mobilitätserziehung in der Sekundarstufe I
- Die Rolle des ÖPNV in der Mobilitätserziehung
- Die Integration von außerschulischen Partnern in den projektorientierten Unterricht
- Die praktische Umsetzung des projektorientierten Unterrichts am Beispiel der EVAG-Busschule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Thematik des projektorientierten Lernens in der Sekundarstufe I, wobei der Fokus auf die Mobilitätserziehung gelegt wird. Ziel ist es, die Bedeutung des projektorientierten Unterrichts für die Vermittlung von Verkehrssicherheit und verantwortungsvollem Verhalten im Straßenverkehr aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen des projektorientierten Unterrichts und beleuchtet die Vorteile dieser Unterrichtsform für die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten im Bereich der Mobilität.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Verkehrs- und Mobilitätserziehung im Kindesalter ein und erläutert die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche im Verkehr zu schützen. Die Projektmethode wird als geeignete Unterrichtsform für die Vermittlung von Verkehrssicherheit vorgestellt, da sie aktive Teilnahme und eigenständiges Handeln miteinander verbindet.
Kapitel 2 definiert den Begriff Unterricht und beleuchtet die Planung und Organisation von Unterricht sowie die Prinzipien effektiven Unterrichts. Kapitel 3 gibt einen historischen Abriss des Projektgedankens und beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Projektorientierten Unterrichts. Die Kapitel 4 und 5 befassen sich mit aktuellen Konzeptionen des Projektorientierten Unterrichts und den Merkmalen dieser Unterrichtsform.
Kapitel 6 untersucht die Methode des Projektorientierten Unterrichts als Form des offenen Unterrichts und beleuchtet die Ziele des Projektorientierten Unterrichts. Kapitel 7 und 8 befassen sich mit den Möglichkeiten und der Notwendigkeit des Projektorientierten Unterrichts in der Schule. Kapitel 9 beleuchtet den Wandel der kindlichen Lebenswelt und die Bedeutung der Entwicklungspsychologie für die Schule und den Unterricht.
Kapitel 10 stellt verschiedene Projekttypen vor, während Kapitel 11 das Bewerten und Zensieren im Projektorientierten Unterricht behandelt. Kapitel 12 beleuchtet die Grenzen des Projektorientierten Unterrichts.
Kapitel 13 befasst sich mit der Mobilität von Kindern und der damit verbundenen Notwendigkeit der Verkehrserziehung in der Sekundarstufe I. Die Bedeutung der Mobilitätserziehung in der Schule, die Ziele und Schwerpunkte der Verkehrs- und Mobilitätserziehung sowie die Problematik von Schulwegunfällen werden beleuchtet.
Kapitel 14 untersucht die Zusammenarbeit von Verkehrsunternehmen mit Schulen im Bereich der Verkehrserziehung.
Der praktische Teil der Arbeit stellt die EVAG-Busschule als Beispiel für eine verkehrspädagogische Unterrichtssequenz in Kooperation von Schulen mit außerschulischen Partnern vor.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den projektorientierten Unterricht, die Mobilitätserziehung, die Verkehrssicherheit, die Sekundarstufe I, den ÖPNV, die EVAG-Busschule, die Zusammenarbeit von Schulen und Verkehrsunternehmen sowie die praktische Umsetzung von Verkehrserziehung im Unterricht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Mobilitätserziehung in der Sekundarstufe I?
Ziel ist es, Jugendliche zu verantwortungsbewussten Verkehrsteilnehmern auszubilden und sie insbesondere auf dem Schulweg (Bus, Bahn, Fahrrad) vor Unfällen zu schützen.
Warum wird die Projektmethode für die Verkehrserziehung empfohlen?
Sie verbindet aktives Handeln mit lebensnahem Lernen und ermöglicht die Verknüpfung von schulischem Wissen mit realen Situationen im Straßenverkehr.
Was ist die „EVAG-Busschule“?
Ein Praxisbeispiel für projektorientierten Unterricht, bei dem Schüler direkt am und im Bus sicherheitsrelevante Verhaltensweisen (z.B. Einklemmprobe, Bremsprobe) trainieren.
Welche Rolle spielt der ÖPNV in der Mobilitätserziehung?
Der ÖPNV ist ein zentrales Thema, da viele Schüler ab der 5. Klasse darauf angewiesen sind. Die Erziehung fördert die sichere Nutzung und ein positives Verständnis für Bus und Bahn.
Wie können Schulen und Verkehrsbetriebe zusammenarbeiten?
Durch verkehrspädagogische Kooperationen wie Betriebshofbesichtigungen, Rallyes und Unterrichtssequenzen mit Experten aus der Praxis.
- Citar trabajo
- Vanessa Kleppel (Autor), 2009, Mobilitätserziehung in der Sekundarstufe I. Projektorientiertes Lernen bei der Essener Verkehrs-AG, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129232