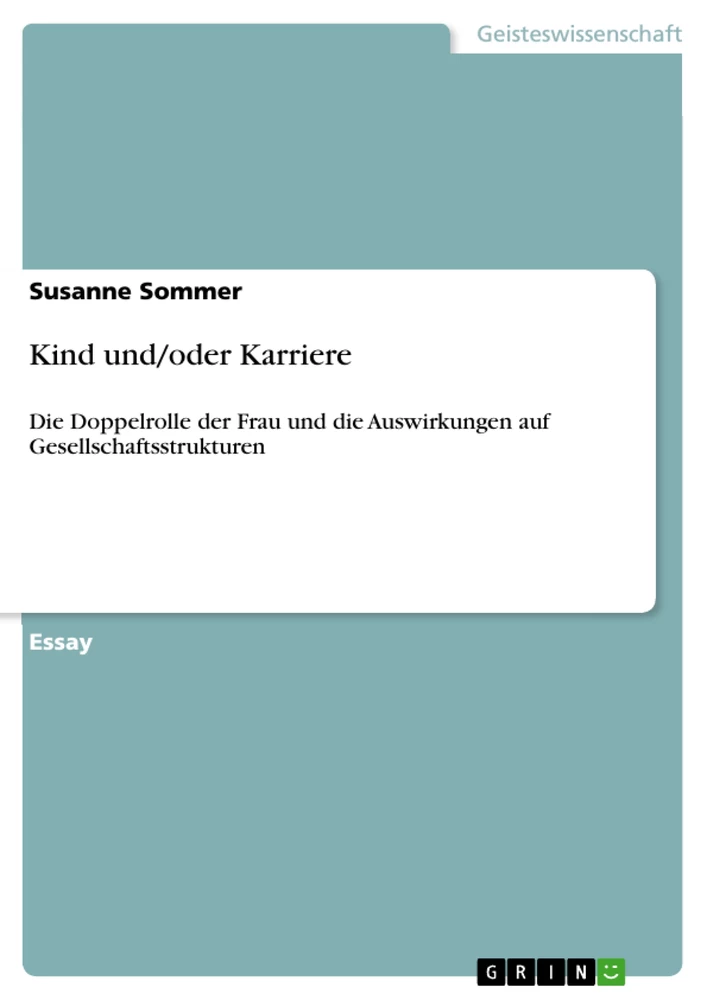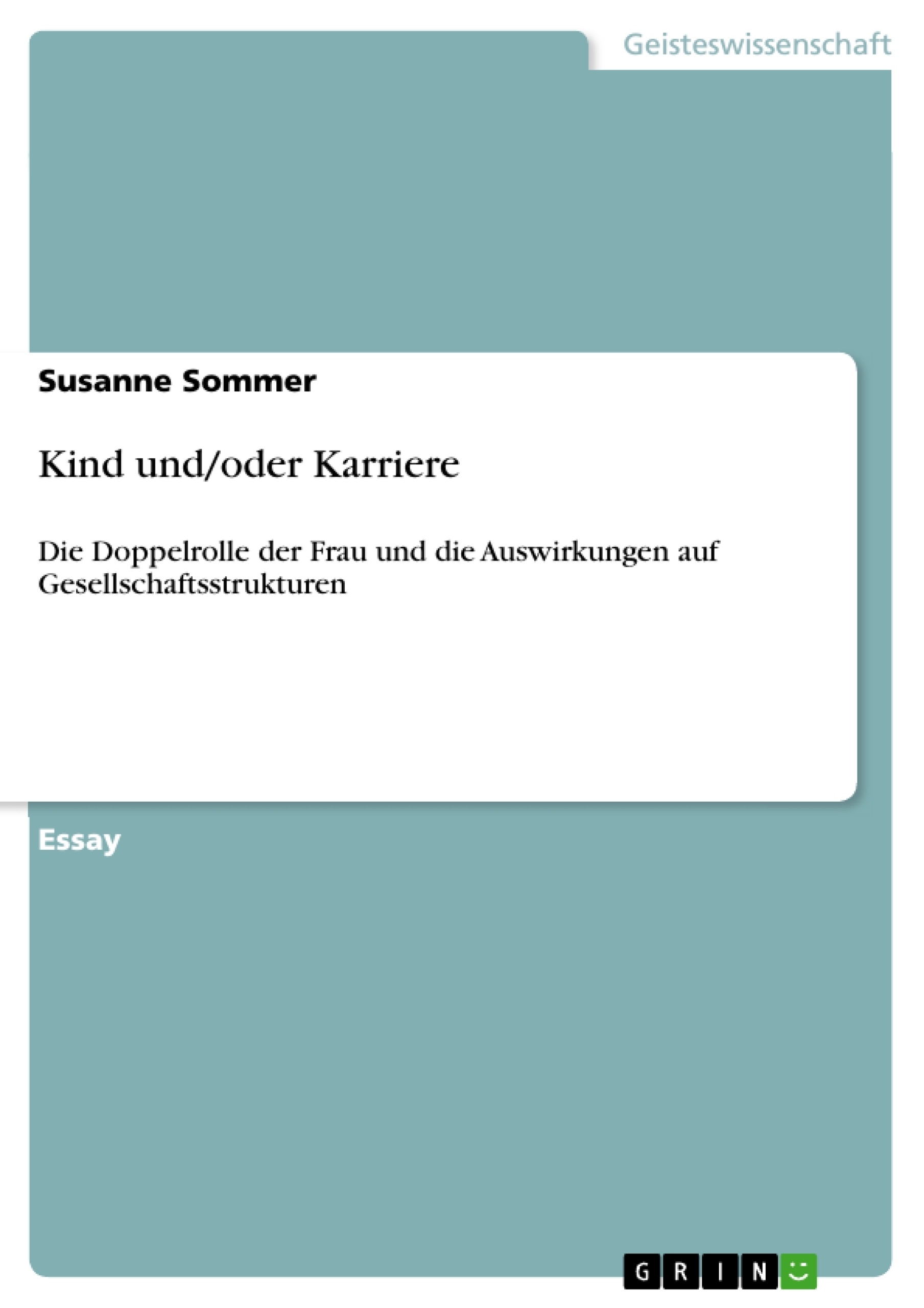In diesem Essay wird auf die Doppelrolle der Frau eingegangen und versucht herauszufinden ob man wirklich noch von einer doppelten Belastung nur für die Frau sprechen kann, oder ob nicht inzwischen ein Wandel stattgefunden hat und vielleicht sogar Männer mittlerweile vor dem gleichen Problem stehen. Nämlich dem Problem Beruf und Haushalt gleichzeitig bewältigen zu müssen. Inwiefern hat sich also die Rolle der Frau verändert?
Inhaltsverzeichnis
- 1,In diesem Essay möchte ich auf die Doppelrolle der Frau eingehen und werde versuchen herauszufinden, ob man wirklich noch von einer doppelten Belastung nur für die Frau sprechen kann, oder ob nicht ein inzwischen ein Wandel stattgefunden hat und vielleicht sogar Männer mittlerweile vor dem gleichen Problem stehen. Nämlich dem Problem Beruf und Haushalt gleichzeitig bewältigen zu müssen. Inwiefern hat sich also die Rolle der Frau verändert?
- Solange ich denken kann, also etwa die letzten zwanzig Jahre, kann ich mich an eine Diskussion über die Diskriminierung der Frauen erinnern und auch heute ist es ein Thema das ständig analysiert wird. Aber hat sich an der Rolle der Frau wirklich nichts bzw. kaum etwas verändert, wie es viele behaupten, oder gab es schon längst eine entscheidende Veränderung in unserer Gesellschaftsstruktur?
- Es ist nicht immer einfach als Frau über die Rolle der Frau zu sprechen, da man schnell in die Schublade der Feministinnen gesteckt wird. Daher möchte ich auch nicht näher darauf eingehen, dass Frauen sich ungerecht behandelt fühlen. Ich werde mein Hauptaugenmerk auf die Analyse der „doppelten Vergesellschaftung“ legen und dabei vor allem die Texte zu diesem Thema von Reinhard Kreckel und Regina Becker-Schmidt heranziehen und mich mit deren Aussagen dazu auseinandersetzen. Zu aller erst möchte ich aber damit beginnen den Begriff der „doppelten Vergesellschaftung“ dieser beiden Autoren näher erläutern:
- Reinhard Kreckel sieht die Wurzeln der Geschlechterunterschiede innerhalb der privaten Haushaltsführung vor allem in den historischen Voraussetzungen und verweist dabei auf deren sozialen Zusammenhang. Dieser Voraussetzungen sind, dass Frauen schon immer für den Haushalt und die Erziehung der Kinder verantwortlich waren und die Männer im Gegensatz dazu jagen gegangen sind um für die Erhaltung der Familie zu sorgen. Die Entwicklung zum Kapitalismus führte dann dazu, dass das Familien- und Erwerbsleben immer stärker voneinander getrennt wurde. Die Frau war demnach ausschließlich für die Reproduktionsaufgaben zuständig wodurch sich die Ideal-Arbeitskraft des „Nur-Arbeiters“ mit der „Nur-Hausfrau“ an seiner Seite ergab. Laut Kreckel gab es zwei gesellschaftliche „Faustregeln“. Die erste ist, der Mann ernährt seine Familie und die zweite lautet, Frau und Mann konkurrieren nicht miteinander.
- und Der Begriff der „doppelte Vergesellschaftung" bedeutet, nach Kreckel, dass Gesellschaftsmitglieder Berufsleben und Haushalt gleichermaßen miteinander verbinden und berücksichtigen müssen. In der modernen kapitalistischen Gesellschaft gebe es eine Trennung zwischen Produktion und Reproduktion, Frauen wie Männer müssen sich mit dieser Ambivalenz auseinandersetzen. Wie sie dies tun sei aber unterschiedlich, denn Männer lösen den Konflikt, in dem sie ihr Privatleben dem Beruflichen unterordnen, und diese Unterordnung habe zur Konsequenz, dass die Frauen sich um das Familienleben kümmern müssen. Die Frau wird also dadurch benachteiligt, da die Reproduktionsarbeit die unbezahlte ist und somit in der heutigen kapitalistischen Gesellschaft nicht zählt. Da diese Doppelrolle der Frau solche Probleme mit sich bringt ist heute eine Entwicklung festzustellen, bei der Frauen sich immer häufiger für eine Karriere entscheiden und nicht mehr für Familie. Die Sozialstrukturen der Gesellschaft differenzieren sich dadurch immer mehr und somit rückt auch die Entwicklung der eigenen Individualität immer mehr in den Vordergrund. Außerdem ist zu beachten, dass sich auch die sozialen Betrachtungsweisen verändert haben, und dass die traditionellen Pflichtwerte immer mehr an Bedeutung verlieren und an ihre Stelle Selbstverwirklichungswerte gesetzt werden, das dazu führt, dass Frauen ein stärkeres Verlangen nach Selbstständigkeit und Annerkennung entwickeln. Allerdings muss die Frau sich diese Selbstständigkeit und Annerkennung eigenständig erarbeiten, wohingegen diese bei den Männern bereits historisch gegeben ist. Eine weitere und entscheidende Veränderung findet in der Familienstruktur statt, welche sich unter anderem daraus ergibt, dass die Bildungschancen von Mann und Frau angeglichen werden, der Haushalt immer mehr technisiert wird und durch die verbesserten Verhütungsmethoden di Geburtenkontrolle vereinfacht wird. Diese Gesichtspunkte machen deutlich, welche Auswirkungen es hat, wenn die Frau im Grunde nur die gleichen Rechte einfordert wie der Mann. Das heutige Problem der Kinderlosigkeit ist demnach auf diese Individualisierung der Frau zurückzuführen und auf ihren Wunsch nach Karriere, da sich das erheblich auf den gesamten Reproduktionsprozess auswirkt. Ein weiteres Problem, ist der neu entstandene direkte Konkurrenzkampfe zwischen Männern und Frauen im Erwerbsleben. Auch wenn Frauen früher schon gearbeitet haben, haben sich die Berufsebenen von Männern und Frauen unterschieden und somit bot sich keine Fläche für Konkurrenzkämpfe zwischen den Geschlechtern. Das Bild über diese Berufsebenen existiert allerdings immer noch in den Köpfen der meisten Menschen verankert und so wird zum Beispiel eine Frau in einer Führungsposition heute als „Mannsweib“ angesehen, und ein Mann der einen typischen „Frauenberuf“ ausübt, wie zum Beispiel den eines Sekretärs gilt gleich als homosexuell. Frauen und Männern werden aufgrund ihres Geschlechts Tätigkeiten zugewiesen und das Geschlecht bildet die Grundlage der Bewertung dieser Tätigkeiten.
- Im Unterschied zu Reinhard Kreckel bezieht Regina Becker-Schmidt das Konzept der „doppelten Vergesellschaftung“ der Arbeitskraft im modernen Kapitalismus ausschließlich auf die Frauen. Ihrer Meinung nach werden Frauen in der heutigen kapitalistischen Gesellschaft dazu gezwungen sich ambivalent zu verhalten und dass sie dabei sowohl familienorientiert als auch berufsorientiert untergeordnet sind. Becker-Schmidt geht in ihrer Analyse davon aus, dass sich Männer dieser Ambivalenz nicht beugen müssen, da diese bereits eindeutig in das Erwerbsleben eingegliedert sind. Mit dem Begriff der „Doppelsozialisation“ benennt sie diese zweifache Orientierung mit der sich die Frau auseinandersetzen muss. Diese Doppelbelastung bringt, laut Becker-Schmidt sowohl qualitative als auch quantitative Probleme mit sich. Das Bestehen der Gesellschaftsform, in der der Mann die oberste Verfügungsgewalt über alle Familienmitglieder hat, erschwert die Partizipation der Frauen am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben außerhalb des Hauses. (Becker-Schmidt, 1987, S.22). Doch dadurch, dass Frauen von diesem öffentlichen Leben ausgeschlossen werden, entstehen für sie Nachteile, sowohl was ihre Erfahrung betrifft als auch für ihr Selbstbewusstsein, welches sich Männer wiederum schon immer aus ihren Berufen ziehen konnten. Und außerhalb ihrer Berufe können die Männer sich ihrem gesellschaftlichen Leben widmen, was sich für die Frau nicht so einfach gestaltet, da sie neben ihren beruflichen Aufgaben auch noch familiäre Aufgaben zu erledigen hat und somit bleibt die Zeit für das gesellschaftliche Leben oftmals auf der Strecke. Im Allgemeinen ist also zu sagen, dass Männer sowohl durch ihre besser angesehenen Berufe als auch durch die Partizipation am gesellschaftlichen Leben, wodurch sie an Erfahrung und Wissen reicher werden, stets einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft einnehmen als Frauen.
- Wie schon beschrieben, gibt es historische Voraussetzungen für diese Rollenverteilung von Mann und Frau, bei dem der Mann als Ernährer der Familie mehr Anerkennung erntet als das Hausmütterchen und daher bin ich auch der Meinung, dass die Frauen, die heutzutage die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen fordern, dieses eher aus dem Grund machen um endlich ehrliche Annerkennung für ihre Arbeit zu bekommen, als nur um dieser Doppelbelastung von Kind und Karriere nicht mehr ausgesetzt sein zu müssen. Mir stellt sich allerdings die Frage, was geschieht, wenn der Wunsch nach Individualisierung sich bei den Frauen immer mehr verstärkt. Hat das zur Konsequenz, dass der Reproduktionsprozess noch weiter zurückgeht und wir irgendwann in einer kinderlosen Gesellschaft leben? Oder wird der Prozess der Gleichberechtigung soweit führen, dass eine Frau nicht mehr zwischen Kind und Karriere abwägen muss, da der Mann die Doppelrolle übernimmt?
- Der Prozess der Gleichberechtigung ist bekanntlich schon im vollen Gange. Vor allem Bildungstechnisch stehen die Frauen den Männern heutzutage in nichts mehr nach, da die akademische Laufbahn beiden offen steht. Allerdings bleibt die Frage nach Karriere oder Kind bei den Frauen nach ihrer Ausbildung immer noch bestehen und für eins von beiden wird sie sich dann entscheiden. Nun denke ich mir aber, dass wenn jemand, das gilt für Männer genauso wie für Frauen, schon ein paar Jahre in eine Ausbildung investiert will derjenige damit auch etwas erreichen und daher fällt die Wahl bei dieser
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der Doppelrolle der Frau in der heutigen Gesellschaft und analysiert die Ursachen und Auswirkungen dieser Belastung. Der Autor untersucht, ob die traditionelle Rollenverteilung zwischen Mann und Frau noch aktuell ist oder ob sich die Situation durch die zunehmende Gleichberechtigung verändert hat. Dabei werden die Theorien von Reinhard Kreckel und Regina Becker-Schmidt zur „doppelten Vergesellschaftung“ herangezogen und kritisch beleuchtet.
- Die historische Entwicklung der Geschlechterrollen und die Entstehung der „doppelten Vergesellschaftung“
- Die Auswirkungen der „doppelten Vergesellschaftung“ auf Frauen und ihre Karriereentwicklung
- Die Rolle der Individualisierung und Selbstverwirklichung im Kontext der Geschlechterrollen
- Die Frage nach der Zukunft der Familienstruktur und der Reproduktion im Zeitalter der Gleichberechtigung
- Die Herausforderungen der Gleichberechtigung und die Notwendigkeit einer Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer Einleitung, in der der Autor die Problematik der Doppelrolle der Frau in der heutigen Gesellschaft einführt. Er stellt die Frage, ob die traditionelle Rollenverteilung zwischen Mann und Frau noch aktuell ist oder ob sich die Situation durch die zunehmende Gleichberechtigung verändert hat. Der Autor bezieht sich dabei auf die Diskussionen über die Diskriminierung von Frauen und die Analyse der „doppelten Vergesellschaftung“.
Im zweiten Kapitel werden die Theorien von Reinhard Kreckel zur „doppelten Vergesellschaftung“ vorgestellt. Kreckel sieht die Wurzeln der Geschlechterunterschiede in den historischen Voraussetzungen und verweist auf die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Er argumentiert, dass die Entwicklung zum Kapitalismus zu einer Trennung zwischen Familien- und Erwerbsleben geführt hat, wodurch Frauen für die Reproduktionsarbeit zuständig wurden und Männer sich auf die Produktion konzentrierten. Kreckel beschreibt die „doppelte Vergesellschaftung“ als die Notwendigkeit für Gesellschaftsmitglieder, Berufsleben und Haushalt gleichermaßen zu berücksichtigen. Er argumentiert, dass Männer den Konflikt zwischen Beruf und Familie lösen, indem sie ihr Privatleben dem Beruflichen unterordnen, während Frauen die Verantwortung für das Familienleben übernehmen. Diese Ungleichheit führt laut Kreckel zu einer Benachteiligung von Frauen, da die Reproduktionsarbeit unbezahlt ist und somit in der heutigen kapitalistischen Gesellschaft nicht zählt.
Im dritten Kapitel werden die Theorien von Regina Becker-Schmidt zur „doppelten Vergesellschaftung“ vorgestellt. Becker-Schmidt argumentiert, dass Frauen in der heutigen kapitalistischen Gesellschaft dazu gezwungen sind, sich ambivalent zu verhalten und sowohl familienorientiert als auch berufsorientiert untergeordnet zu sein. Sie kritisiert, dass Männer dieser Ambivalenz nicht ausgesetzt sind, da sie bereits eindeutig in das Erwerbsleben integriert sind. Becker-Schmidt bezeichnet diese zweifache Orientierung als „Doppelsozialisation“ und argumentiert, dass diese Doppelbelastung sowohl qualitative als auch quantitative Probleme für Frauen mit sich bringt. Sie kritisiert die traditionelle Gesellschaftsform, in der der Mann die oberste Verfügungsgewalt über alle Familienmitglieder hat, und argumentiert, dass diese Struktur die Partizipation von Frauen am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben außerhalb des Hauses erschwert. Becker-Schmidt betont, dass Frauen durch den Ausschluss vom öffentlichen Leben Nachteile in Bezug auf Erfahrung und Selbstbewusstsein erleiden, während Männer diese Vorteile aus ihren Berufen und der Partizipation am gesellschaftlichen Leben ziehen können.
Im vierten Kapitel reflektiert der Autor die historischen Voraussetzungen für die traditionelle Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Er argumentiert, dass der Mann als Ernährer der Familie mehr Anerkennung genießt als die Hausfrau und dass Frauen, die heute die Gleichberechtigung fordern, dies eher aus dem Wunsch nach Anerkennung für ihre Arbeit tun als aus dem Wunsch, der Doppelbelastung von Kind und Karriere zu entkommen. Der Autor stellt die Frage, welche Auswirkungen die zunehmende Individualisierung von Frauen auf den Reproduktionsprozess hat und ob die Gleichberechtigung dazu führen wird, dass Männer die Doppelrolle übernehmen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Doppelrolle der Frau, die „doppelte Vergesellschaftung“, die Gleichberechtigung, die Familienstruktur, die Reproduktion, die Individualisierung, die Selbstverwirklichung, die Karriereentwicklung und die gesellschaftlichen Strukturen. Der Essay analysiert die Ursachen und Auswirkungen der traditionellen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau und untersucht, ob sich die Situation durch die zunehmende Gleichberechtigung verändert hat. Dabei werden die Theorien von Reinhard Kreckel und Regina Becker-Schmidt zur „doppelten Vergesellschaftung“ herangezogen und kritisch beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „doppelte Vergesellschaftung“?
Der Begriff beschreibt die Notwendigkeit, sowohl am Berufsleben (Produktion) als auch an der Haus- und Familienarbeit (Reproduktion) teilzunehmen.
Wie unterscheiden sich Kreckel und Becker-Schmidt in ihrer Sichtweise?
Becker-Schmidt sieht die Doppelbelastung fast ausschließlich als Frauenproblem, während Kreckel auch die Ambivalenz für Männer im modernen Kapitalismus beleuchtet.
Warum entscheiden sich Frauen heute häufiger gegen Kinder?
Die Arbeit nennt den Wunsch nach beruflicher Selbstverwirklichung, Individualisierung und die schwierige Vereinbarkeit mit der traditionellen Mutterrolle als Gründe.
Gibt es einen Wandel in der Rolle des Mannes?
Es wird untersucht, ob Männer zunehmend vor den gleichen Problemen der Vereinbarkeit von Beruf und Haushalt stehen, die früher nur Frauen betrafen.
Was ist die „Nur-Hausfrau-Ehe“?
Ein historisches Modell, in dem der Mann als alleiniger Ernährer fungiert und die Frau ausschließlich für die unbezahlte Reproduktionsarbeit zuständig ist.
Führt Gleichberechtigung zu einer kinderlosen Gesellschaft?
Der Essay stellt die provokante Frage, ob der starke Fokus auf Individualität den Reproduktionsprozess gefährdet, solange die Rahmenbedingungen für Kinder nicht optimiert werden.
- Citar trabajo
- Susanne Sommer (Autor), 2006, Kind und/oder Karriere, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129252