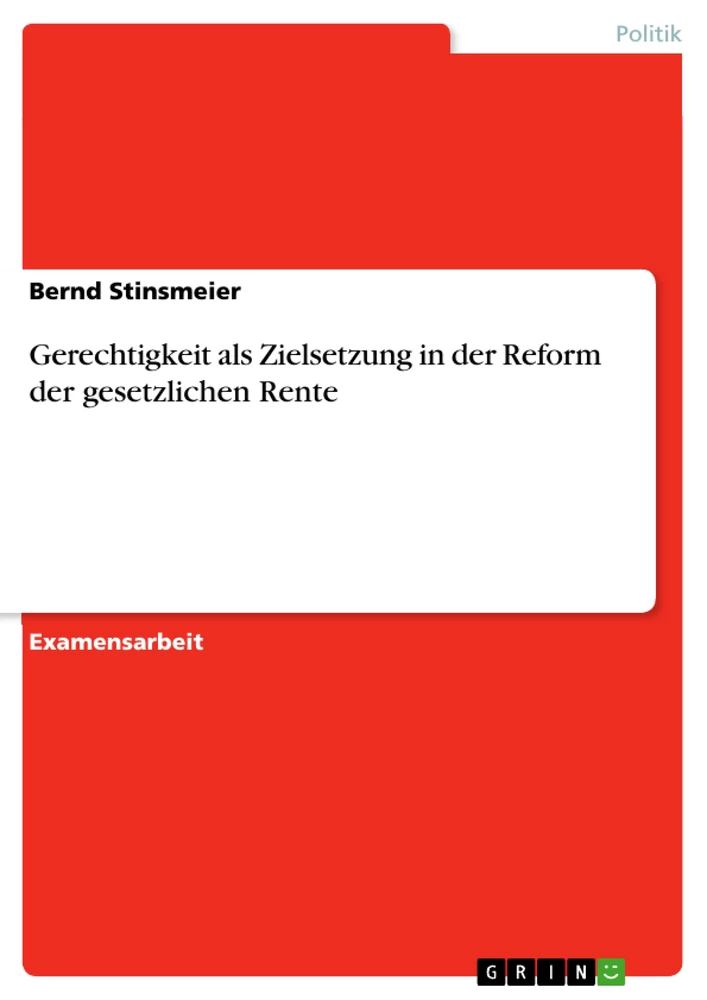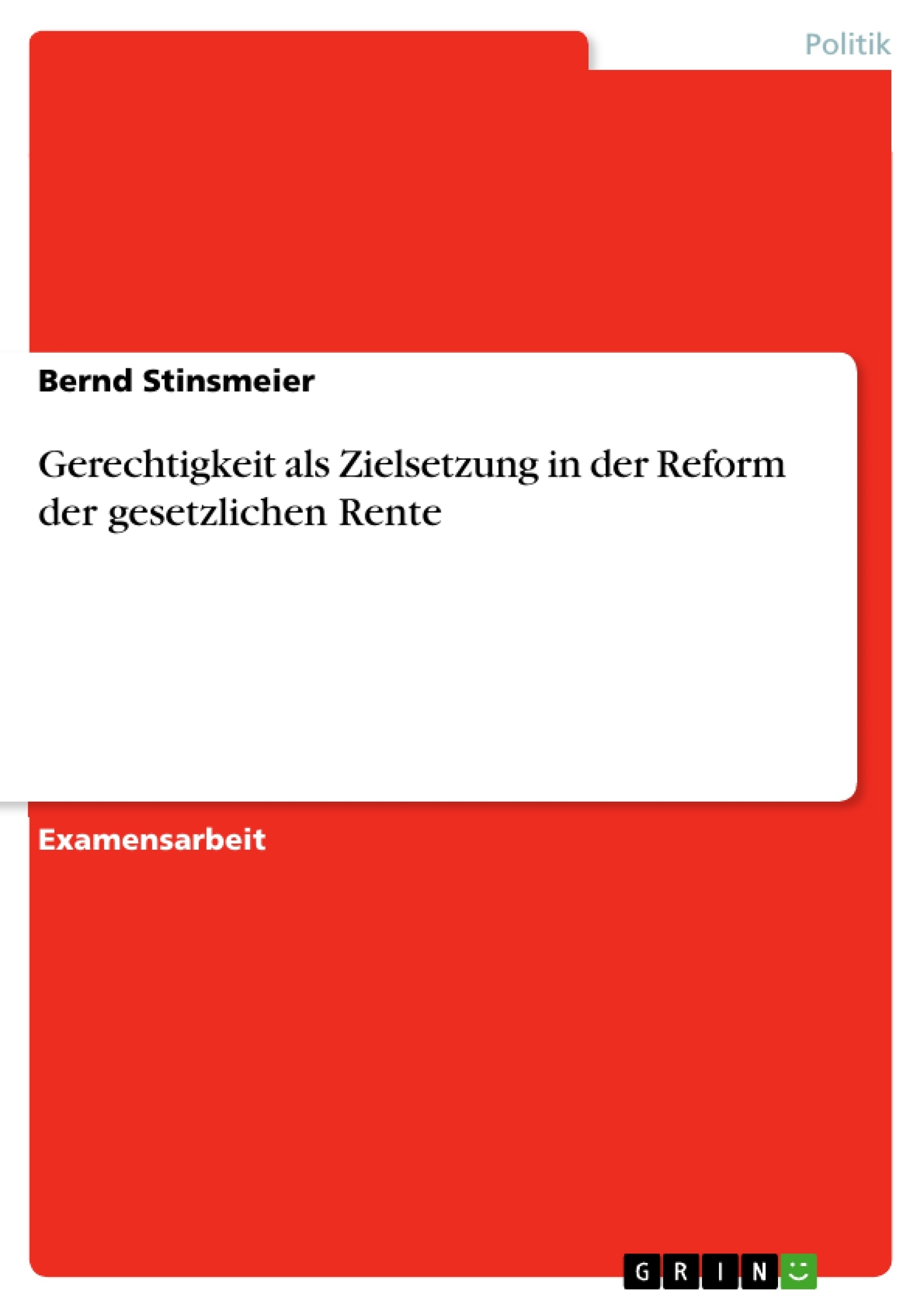Problemstellung
Soziale Gerechtigkeit ist für das Zusammenleben in jeder Gesellschaft von elementarer Bedeutung.
Besonders der Sozialstaat hat sich ihre Realisierung zum Ziel gesetzt. Er stellt eine Art Versicherung dar, auf die sich seine Bürger in schwierigen Lebenslagen verlassen können. Die Garantie, dass selbst in einer individuellen Notsituation eine Existenzabsicherung des Einkommensniveaus erhalten bleibt, gibt nicht nur Sicherheit, sondern spornt auch an, risikoreichere Lebenschancen wahrzunehmen. Unternehmerische Leistungs- und Risikobereitschaft wird dadurch entscheidend gefördert. Die oft geäußerte Meinung, dass der Sozialstaat ein Hemmschuh der Wirtschaft sei, muss also zumindest teilweise hinterfragt werden. Er trägt hingegen durch seine Sicherungsfunktion zur Produktivität der Volkswirtschaft und damit maßgeblich zum Fortbestehen der staatlichen und wirtschaftlichen Ordnung bei. Die Umverteilungsmaßnahmen, die in seinem Kontext stattfinden, schützen die Bürger vor Armut und Not. Auf diese Weise wird einer stark inhomogenen Einkommensverteilung entgegengewirkt. Verteilungskämpfe werden somit abgemildert und der soziale Frieden bleibt gewahrt.
Zu den Eckpfeilern des deutschen Sozialstaates gehören die Sozialversicherungen. Unter ihnen nimmt die 1889 gegründete gesetzliche Rentenversicherung (GRV) eine besondere Stellung ein. Mit einem Ausgabenvolumen von 12,6% des Bruttosozialprodukts stellt sie das größte soziale Sicherungssystem in der Bundesrepublik Deutschland dar. Sie versorgt den überwiegenden Teil der Rentnergeneration und ist zur wichtigsten Einkommensquelle für alte Menschen geworden.
In den letzten Jahren ist die GRV unter Druck geraten. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat die Sozialversicherungen in Deutschland in eine finanzielle Krise gestürzt und damit auch die Grundannahmen der GRV zur Disposition gestellt. Um den Herausforderungen heute und in Zukunft gewachsen zu sein, mussten im Rahmen einer grundlegenden Reform die Ziele und Wege der Alterssicherung neu überdacht werden. Das Ergebnis war ein Reformpaket, das im Frühjahr 2001 beschlossen wurde.
Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, ob das von der Bundesregierung beschlossene Bündel von Maßnahmen in seiner konzeptionellen Idee und in seiner Wirkung eine sozial gerechte Antwort auf die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit gibt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1. PROBLEMSTELLUNG
- 1.2. AUFBAU DER ARBEIT
- 2. EINGRENZUNG DES BEGRIFFS „SOZIALE GERECHTIGKEIT“
- 2.1. GERECHTIGKEITSPRINZIPIEN IM SOZIALSTAAT
- 2.2. VERFASSUNGSRECHTLICHE VORGABEN
- 2.2.1. Das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes
- 2.2.2. Vorgaben des Bundesverfassungsgericht zur GRV
- 2.3. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER GERECHTIGKEITS-AUFFASSUNGEN IN DER GRV BIS 1998
- 2.3.1. Auswertung der historischen Entwicklung
- 2.4. EINORDNUNG DEUTSCHLANDS IN DAS INTERNATIONALE SYSTEM VERSCHIEDENER WOHLFAHRTSSTAATSKONZEPTE
- 2.4.1. Das Bismarck-Modell
- 2.4.2. Das Beveridge-Modell
- 2.4.3. Espring-Andersons Konzeption der Wohlfahrtsstaaten
- 2.5. DER AKTUELLE GERECHTIGKEITSPOLITISCHE DISKURS: ANALYSE DER GERECHTIGKEITSKONZEPTE DER PARTEIEN DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES
- 2.5.1. PDS
- 2.5.2. Bündnis 90/Die Grünen
- 2.5.3. SPD
- 2.5.4. CDU
- 2.5.5. FDP
- 2.5.6. Auswertung der Parteienanalyse
- 2.6. NORMATIVE SCHWERPUNKTSETZUNG DER RENTENREFORM 2001
- 2.6.1. Soziale Gerechtigkeit als Gegenstand des Koalitionsvertrags 1998
- 2.6.2. Stellungnahmen der Parteien zur Gewichtung der Teilgebiete sozialer Gerechtigkeit in der Rentenreform
- 2.7. ZWISCHENFAZIT
- 2.7.1. Allgemeine Kernbestandteile sozialer Gerechtigkeit
- 2.7.2. Definition sozialer Gerechtigkeit in der GRV
- 3. DAS DEUTSCHE SYSTEM DER ALTERSVORSORGE
- 3.1. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN ZUR URSACHE UND ZUM INSTRUMENTARIUM DER ALTERSVORSORGE
- 3.1.1. Sicherheitsbedürfnisse als Antrieb zur Vorsorge
- 3.1.2. Das risikopolitische Instrumentarium
- 3.2. DAS DREI-SÄULEN-SYSTEM DER DEUTSCHEN ALTERSVORSORGE
- 3.3. KONZEPTION DER GRV
- 3.3.1. Ziele der GRV
- 3.3.2. Kreis der Versicherten
- 3.3.3. Voraussetzungen für einen Rentenanspruch
- 3.3.4. Leistungsgestaltung der GRV
- 3.3.5. Finanzierung der Rentenleistungen
- 3.4.6. Zusammenfassung
- 4. PRÄZISIERUNG DER ZU UNTERSUCHENDEN TEILGERECHTIGKEITEN IN BEZUG AUF DIE GRV
- 4.1. GENERATIONENGERECHTIGKEIT
- 4.2. GERECHTIGKEIT FÜR FAMILIEN
- 4.3. GERECHTIGKEIT ZWISCHEN DEN GESCHLECHTERN
- 4.4. DIE INHALTLICHE VERBUNDENHEIT DER DREI TEILGEBIETE
- 5. HERAUSFORDERUNGEN UND PROBLEMSTELLUNGEN DER RENTENPOLITIK
- 5.1. GESELLSCHAFTLICHE HERAUSFORDERUNGEN
- 5.1.1. Demographischer Wandel
- 5.1.2. Wertewandel
- 5.2. ÖKONOMISCHE HERAUSFORDERUNGEN
- 5.2.1. Globalisierung
- 5.2.2. Veränderung der Arbeitswelt
- 5.2.3. Die finanzielle Situation der GRV
- 5.2.4. Zwischenfazit
- 5.3. GERECHTIGKEITSDEFIZITE
- 5.3.1. Generationengerechtigkeit
- 5.3.2. Gerechtigkeit für Familien
- 5.3.3. Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern
- 5.3.4. Zwischenfazit
- 6. DIE RENTENREFORM 2001
- 6.1. ZIEL DER REFORM
- 6.2. INHALTE DER REFORM
- 6.2.1. Die langfristige Gestaltung des Beitragssatzes und Rentenniveaus
- 6.2.2. Förderung der privaten Altersvorsorge
- 6.2.3. Förderung der betriebliche Altersvorsorge
- 6.2.4. Neuerungen in der Vergütung von Kindererziehungsleistungen
- 6.2.5. Neuerungen in der Hinterbliebenenrente
- 6.2.6. Einführung des Ehegattensplittings
- 6.2.7. Einführung der Grundrente
- 6.2.8. Neuerungen bzgl. der Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
- 6.2.9. Zusammenfassung
- 7. ANALYSE DER RENTENREFORM 2001
- 7.1. GENERATIONENGERECHTIGKEIT
- 7.1.1. Gestaltung des Beitragssatzes und Rentenniveaus
- 7.1.2. Renditen- und Kapitalwertentwicklung
- 7.1.4. Kritik an den demographischen und wirtschaftlichen Grundannahmen der Berechnungen der Bundesregierung
- 7.1.5. Maßnahmen zum Ausbau der Generationengerechtigkeit
- 7.1.6. Zwischenfazit
- 7.2. GERECHTIGKEIT FÜR FAMILIEN
- 7.2.1. Neuerungen in der Vergütung von Kindererziehungsleistungen
- 7.2.2. Förderung der privaten und betrieblichen Altersvorsorge
- 7.2.3. Maßnahmen zum Ausbau der Gerechtigkeit für Familien
- 7.2.4. Zwischenfazit
- 7.3. GERECHTIGKEIT ZWISCHEN DEN GESCHLECHTERN
- 7.3.1. Gestaltung des Rentenniveaus und der Hinterbliebenenrente
- 7.3.2. Einführung des Ehegattensplitting
- 7.3.3. Förderung der privaten Altersvorsorge
- 7.3.4. Förderung der betrieblichen Altersvorsorge
- 7.3.5. Einführung der Grundrente
- 7.3.6. Maßnahmen zum Ausbau der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern
- 7.3.7. Zwischenfazit
- 8. GRUNDLEGENDE REFORMOPTIONEN
- 8.1. MABNAHMEN ZUR FINANZIELLEN STABILISIERUNG DER GRV
- 8.1.1 Erhöhung der Ökosteuer
- 8.1.2. Stärkere Umverteilung innerhalb einer Generation
- 8.1.3. Verlängerung der Lebensarbeitszeit
- 8.1.4. Ausweitung des Versichertenkreises
- 8.1.5. Ausweitung der Bemessungsgrundlage und Einführung von wertschöpfungsbezogenen Beiträgen der Unternehmen
- 8.1.6. Steigerung der Effizienz in der Verwaltung
- 8.1.7. Zwischenfazit
- 8.2. DAS SCHWEIZER MODELL DER ALTERSVORSORGE ALS VORBILD?
- 8.2.1. Darstellung des Modells
- 8.2.2. Bewertung des Modells
- Soziale Gerechtigkeit als Leitprinzip der Rentenreform
- Analyse verschiedener Gerechtigkeitskonzepte in der Rentenpolitik
- Herausforderungen und Problemfelder der Rentenreform
- Bewertung der Reform in Bezug auf die Teilbereiche der sozialen Gerechtigkeit
- Grundlegende Reformoptionen für ein gerechteres Rentensystem
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Reform der gesetzlichen Rente im Jahr 2001 und analysiert, inwieweit diese Reform den Anspruch auf soziale Gerechtigkeit erfüllt. Insbesondere wird untersucht, ob die Reform in Bezug auf Generationengerechtigkeit, Gerechtigkeit für Familien und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern einen Beitrag zur Gestaltung eines gerechteren Rentensystems leistet.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung der Rentenreform im Kontext sozialer Gerechtigkeit definiert und den Aufbau der Arbeit erläutert. Anschließend wird der Begriff „soziale Gerechtigkeit“ im Kontext des Sozialstaats und unter Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Vorgaben eingegrenzt. Die historische Entwicklung der Gerechtigkeitsauffassungen in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) bis 1998 wird analysiert. Darüber hinaus wird die Einordnung Deutschlands in das internationale System verschiedener Wohlfahrtsstaatkonzepte betrachtet. Die Arbeit untersucht anschließend die aktuellen Gerechtigkeitskonzepte der Parteien des Deutschen Bundestages, um die normative Schwerpunktsetzung der Rentenreform 2001 zu beleuchten.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem deutschen System der Altersvorsorge, wobei insbesondere die Konzeption der GRV mit ihren Zielen, Versichertenkreis, Voraussetzungen für einen Rentenanspruch, Leistungsgestaltung und Finanzierung im Detail dargestellt wird. Die Arbeit präzisiert in Kapitel 4 die zu untersuchenden Teilgerechtigkeiten in Bezug auf die GRV: Generationengerechtigkeit, Gerechtigkeit für Familien und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Kapitel 5 beleuchtet die Herausforderungen und Problemfelder der Rentenpolitik, wobei gesellschaftliche und ökonomische Herausforderungen sowie Gerechtigkeitsdefizite in den drei Teilbereichen dargestellt werden. Die Arbeit analysiert in Kapitel 6 die Rentenreform 2001, wobei die Ziele der Reform und die einzelnen Inhalte, wie z.B. die Gestaltung des Beitragssatzes und Rentenniveaus, die Förderung der privaten und betrieblichen Altersvorsorge, sowie Neuerungen in der Vergütung von Kindererziehungsleistungen, Hinterbliebenenrente, Ehegattensplitting, Grundrente und Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, detailliert dargestellt werden.
Im 7. Kapitel erfolgt eine Analyse der Rentenreform 2001 in Bezug auf die drei Teilgerechtigkeiten. Die Arbeit untersucht die Gestaltung des Beitragssatzes und Rentenniveaus, die Renditen- und Kapitalwertentwicklung, die Kritik an den demographischen und wirtschaftlichen Grundannahmen der Bundesregierung sowie Maßnahmen zum Ausbau der Generationengerechtigkeit. Im Kontext der Gerechtigkeit für Familien werden Neuerungen in der Vergütung von Kindererziehungsleistungen, die Förderung der privaten und betrieblichen Altersvorsorge sowie Maßnahmen zum Ausbau der Gerechtigkeit für Familien analysiert. In Bezug auf die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern werden die Gestaltung des Rentenniveaus und der Hinterbliebenenrente, die Einführung des Ehegattensplittings, die Förderung der privaten und betrieblichen Altersvorsorge, die Einführung der Grundrente sowie Maßnahmen zum Ausbau der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern untersucht.
Kapitel 8 befasst sich mit grundlegenden Reformoptionen, wie z.B. Maßnahmen zur finanziellen Stabilisierung der GRV, wie die Erhöhung der Ökosteuer, die Stärkere Umverteilung innerhalb einer Generation, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, die Ausweitung des Versichertenkreises, die Ausweitung der Bemessungsgrundlage und die Einführung von wertschöpfungsbezogenen Beiträgen der Unternehmen sowie die Steigerung der Effizienz in der Verwaltung. Das Kapitel untersucht zudem das Schweizer Modell der Altersvorsorge als mögliches Vorbild.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den zentralen Themen der sozialen Gerechtigkeit, der Rentenreform und der Altersvorsorge. Im Mittelpunkt stehen die Gerechtigkeitskonzepte, die Herausforderungen und Problemfelder der Rentenpolitik, die Analyse der Rentenreform 2001 in Bezug auf Generationengerechtigkeit, Gerechtigkeit für Familien und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern sowie grundlegende Reformoptionen für ein gerechteres Rentensystem.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der Rentenreform 2001 in Deutschland?
Die Reform zielte darauf ab, die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) angesichts des demographischen Wandels finanziell zu stabilisieren und die private sowie betriebliche Vorsorge zu stärken.
Wie wird soziale Gerechtigkeit in der Rentenreform definiert?
Sie umfasst mehrere Dimensionen: Generationengerechtigkeit, Gerechtigkeit für Familien (Berücksichtigung von Erziehungszeiten) und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern.
Was bedeutet Generationengerechtigkeit im Rentensystem?
Es geht um eine faire Lastenverteilung zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern, damit künftige Generationen nicht übermäßig belastet werden, während heutige Rentner abgesichert bleiben.
Welche Neuerungen gab es für Familien durch die Reform 2001?
Die Reform verbesserte die Bewertung von Kindererziehungszeiten und führte Maßnahmen ein, um die eigenständige Alterssicherung von Frauen zu fördern (z. B. Ehegattensplitting).
Was sind die größten Herausforderungen für die Rentenpolitik?
Der demographische Wandel (alternde Gesellschaft), die Globalisierung und Veränderungen in der Arbeitswelt (instabile Erwerbsbiografien) setzen die Finanzierung der GRV unter Druck.
- Quote paper
- Bernd Stinsmeier (Author), 2002, Gerechtigkeit als Zielsetzung in der Reform der gesetzlichen Rente, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12945