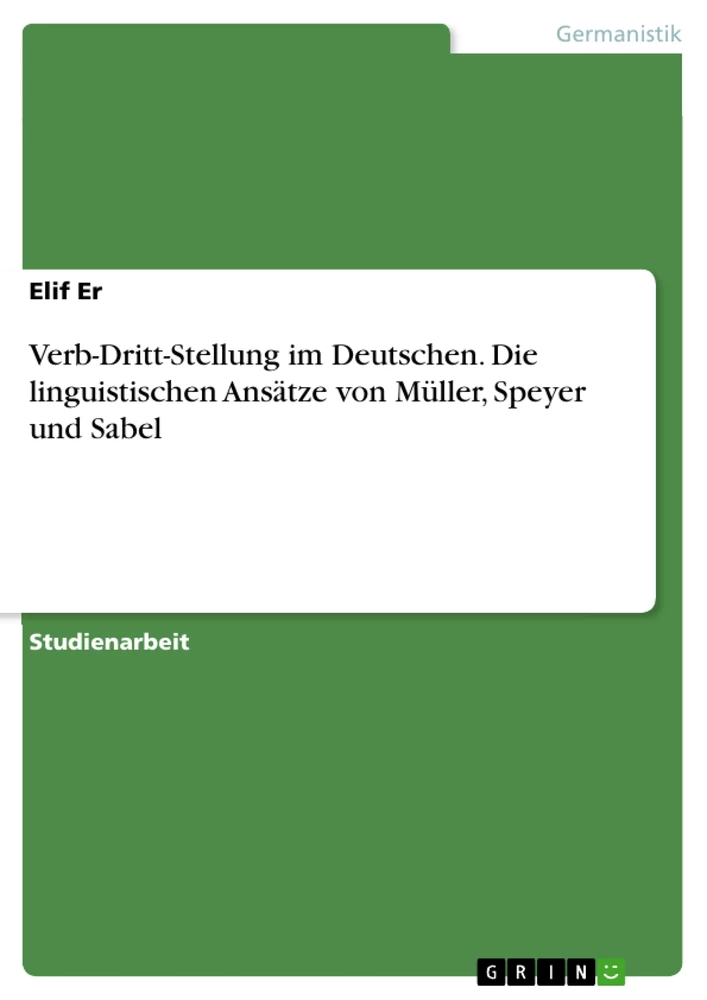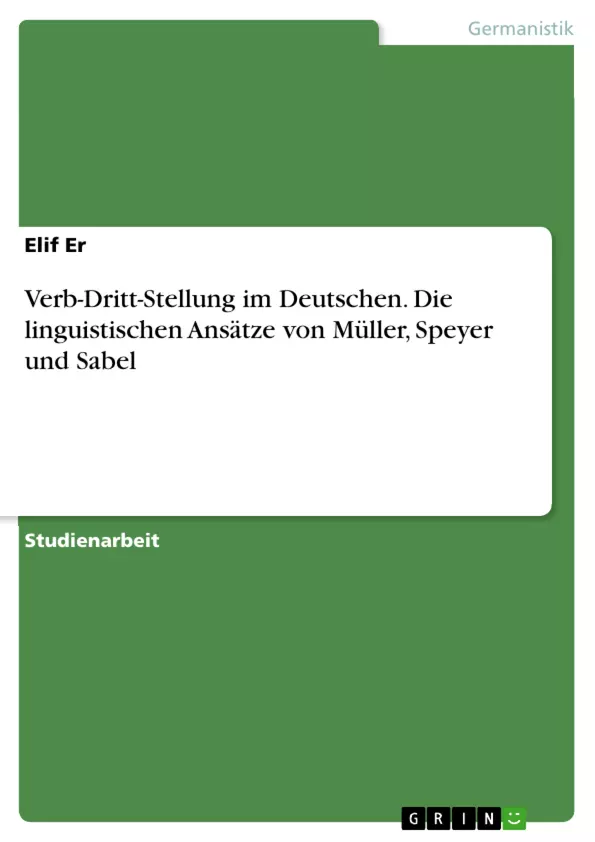Die Hausarbeit befasst sich mit der Verb-Dritt-Stellung im Deutschen. Verb-Dritt-Stellung oder auch V3-Stellung bezeichnet die mehrfache Besetzung des Vorfeldes, beziehungsweise das Vorangehen des finiten Verbs mit zwei Konstituenten. Da das Standarddeutsche als Verb-Zweit-Sprache gilt, vor dem finiten Verb somit nur eine Konstituente vorangehen darf, wird die V3-Stellung sehr kontrovers debattiert.
Inhalt dieser Diskussion ist die Frage nach der Wirklichkeit einer vorhandenen Verb-Dritt-Struktur oder, ob es nicht doch eine nur scheinbare Verb-Dritt-Stellung ist. Vor allem in der Zeitungs- und Radiosprache als auch im Kiezdeutsch findet man Verb-Dritt-Strukturen wieder, welche für die generative Grammatik im Bereich der Syntax von großer Relevanz sind.
Die Arbeit legt drei verschiedene Ansätze zur Analyse von Verb-Dritt-Strukturen dar. Bei dem ersten Ansatz handelt es sich um den Ansatz von Stefan Müller, welcher die V3-Stellung als eine nur scheinbar mehrfache Vorfeldbesetzung betrachtet, wohingegen Augustin Speyer in seiner Ansicht von einer klaren Verbdritt-Struktur ausgeht. Ein weiterer Ansatz von Joachim Sabel fügt die V3-Strukturen in eine Clusteranalyse, bei der Sätze mit mehrfacher Vorfeldbesetzung als Verb-Zweit-Sätze analysiert werden.
Die Ansätze werden anhand von kleinen Beispielen auf das Standarddeutsche und Kiezdeutsche angewandt. Zuletzt werden die Ergebnisse der Untersuchung dieser drei Ansätze in Form eines Fazits zusammengefasst und der plausibelste Ansatz benannt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Verbdritt-Stellung im Deutschen
- 2.1 eine scheinbar mehrfache Vorfeldbesetzung nach Müller (2005)
- 2.2 die doppelte Vorfeldbesetzung nach Speyer (2008)
- 2.3 Die Clusteranalyse nach Sabel (2020)
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Verb-Dritt-Stellung (V3-Stellung) im Deutschen. Sie analysiert unterschiedliche theoretische Ansätze, die diese Konstruktion erklären versuchen, und wendet diese auf Beispiele aus dem Standarddeutschen und dem Kiezdeutsch an. Ziel ist es, die Frage nach der tatsächlichen Existenz einer V3-Struktur oder ihrer bloßen Scheinbarkeit zu klären.
- Analyse der Verb-Dritt-Stellung im Deutschen
- Vergleich verschiedener theoretischer Ansätze zur Erklärung der V3-Stellung
- Anwendung der Ansätze auf Beispiele aus dem Standarddeutschen und Kiezdeutsch
- Untersuchung der informationsstrukturellen Aspekte der V3-Stellung
- Bewertung der Plausibilität der verschiedenen Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Verb-Dritt-Stellung im Deutschen ein und beschreibt den Forschungsgegenstand. Es wird die Kontroverse um die Existenz einer tatsächlichen V3-Struktur gegenüber einer scheinbaren V3-Stellung erläutert. Die Arbeit kündigt die Analyse dreier unterschiedlicher Ansätze zur Erklärung der V3-Stellung an: Müller (2005), Speyer (2008) und Sabel (2020). Die Anwendung der Ansätze auf Beispiele aus dem Standarddeutschen und Kiezdeutsch wird angekündigt, gefolgt von einem Fazit, das den plausibelsten Ansatz benennen soll.
2. Verbdritt-Stellung im Deutschen: Dieses Kapitel beleuchtet die Verb-Zweit-Regel des Standarddeutschen und zeigt anhand von Beispielen die Ungrammatikalität mehrfacher Vorfeldbesetzung. Anschließend werden Beispiele aus der Zeitungssprache, der Radiosprache und dem Kiezdeutsch präsentiert, die V3-Konstruktionen aufweisen. Der Fokus liegt auf der Feststellung, dass trotz der etablierten Verb-Zweit-Regel, V3-Konstruktionen in verschiedenen Sprachvarietäten vorkommen, was die Notwendigkeit der Analyse unterschiedlicher theoretischer Ansätze unterstreicht. Der Kapitel vermittelt, dass die V3-Stellung ein vielschichtiges Phänomen darstellt, welches weitere Untersuchung erfordert.
Schlüsselwörter
Verb-Dritt-Stellung, V3-Stellung, Verb-Zweit-Regel, Mehrfache Vorfeldbesetzung, Standarddeutsch, Kiezdeutsch, Syntax, Pragmatik, Müller (2005), Speyer (2008), Sabel (2020), Informationsstruktur, Grammatikalität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Verb-Dritt-Stellung im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Verb-Dritt-Stellung (V3-Stellung) im Deutschen. Sie analysiert verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung dieser Konstruktion und wendet diese auf Beispiele aus dem Standarddeutschen und dem Kiezdeutsch an. Das Hauptziel ist die Klärung der Frage nach der tatsächlichen Existenz einer V3-Struktur oder ihrer bloßen Scheinbarkeit.
Welche theoretischen Ansätze werden analysiert?
Die Arbeit analysiert drei unterschiedliche theoretische Ansätze zur Erklärung der V3-Stellung: Müller (2005), Speyer (2008) und Sabel (2020). Jeder Ansatz wird auf seine Eignung zur Erklärung der beobachteten Phänomene hin untersucht und verglichen.
Welche Sprachdaten werden verwendet?
Die Analyse basiert auf Beispielen aus dem Standarddeutschen und dem Kiezdeutsch. Dies ermöglicht einen Vergleich der V3-Stellung in verschiedenen Sprachvarietäten und trägt zum Verständnis ihrer Verbreitung und Verwendung bei.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Verb-Dritt-Stellung, welches die drei genannten Ansätze detailliert behandelt, und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt den Forschungsgegenstand und die Zielsetzung. Das Hauptkapitel analysiert die V3-Stellung anhand der ausgewählten Ansätze und Beispiele aus Standarddeutsch und Kiezdeutsch. Das Fazit bewertet die Plausibilität der verschiedenen Ansätze.
Welche Aspekte der V3-Stellung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der V3-Stellung, darunter die scheinbar mehrfache Vorfeldbesetzung, die informationsstrukturellen Aspekte und die Grammatikalität der Konstruktion in verschiedenen Sprachvarietäten.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Verb-Dritt-Stellung, V3-Stellung, Verb-Zweit-Regel, Mehrfache Vorfeldbesetzung, Standarddeutsch, Kiezdeutsch, Syntax, Pragmatik, Müller (2005), Speyer (2008), Sabel (2020), Informationsstruktur, Grammatikalität.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit benennt den (die) plausibelsten Ansatz(e) zur Erklärung der Verb-Dritt-Stellung nach der Analyse der drei untersuchten Ansätze (Müller, Speyer, Sabel) und der empirischen Daten aus Standarddeutsch und Kiezdeutsch. Es fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
- Quote paper
- Elif Er (Author), 2021, Verb-Dritt-Stellung im Deutschen. Die linguistischen Ansätze von Müller, Speyer und Sabel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1294645