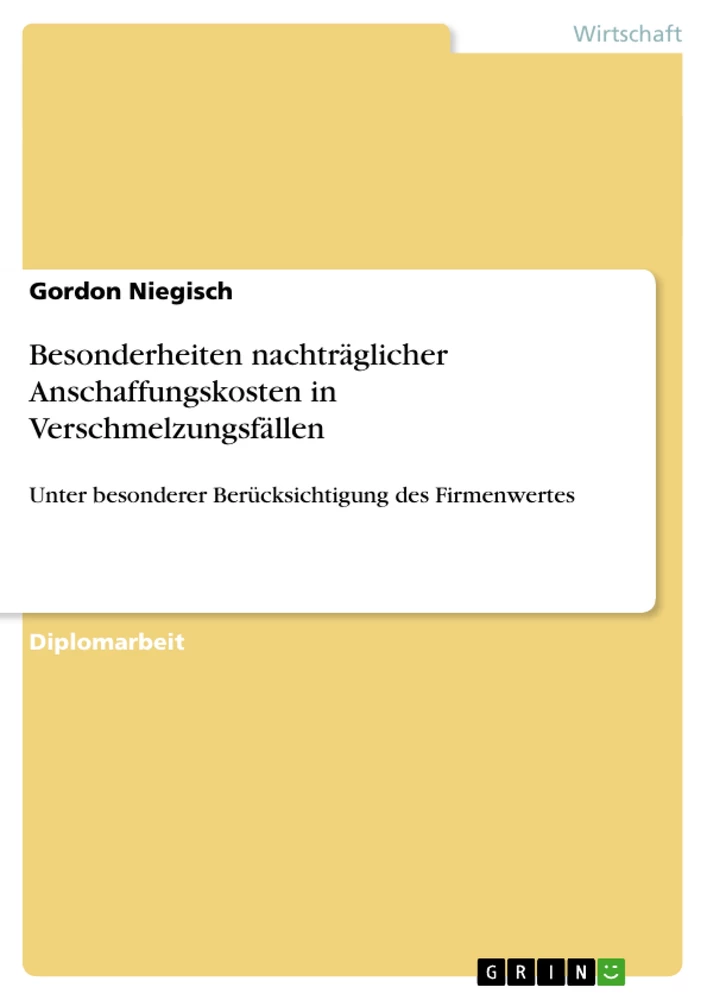Unternehmenszusammenschlüsse haben in den letzten Jahrzehnten sowohl volumen- als auch zahlenmäßig stark an Bedeutung gewonnen. Mit der zunehmenden Liberalisierung grenzüberschreitender wirtschaftlicher Tätigkeiten war eine Zunahme internationaler Zusammenschlüsse zu beobachten. Dabei nahm auch das Transaktionsvolumen zu. Während 1992 der Wert einer Transaktion 24 Mio. Euro betrug, waren es 1998 durchschnittlich 62 Mio. Euro und im Jahr 1999 sogar 219 Mio. Euro.
Neben der Ermittlung der nachträglichen Anschaffungskosten scheint es sinnvoll im Rahmen der vorliegenden Arbeit, den Anwendungsbereich der anzuwendenden Regelungen abzugrenzen. Auf Grund divergierender Zielsetzungen der einzelnen Rechnungslegungssysteme des HGB und des IFRS existiert eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der bilanziellen Behandlungen von Verschmelzung, auf die in dieser Arbeit eingegangen werden soll.
Im deutschen Recht sind grds. vier verschiedene Möglichkeiten der Strukturveränderung bzw. Umwandlung von Unternehmen geregelt. Diese vier Formen sind im Umwandlungsgesetz (UmwG) abschließend und zwingend dargestellt.
Im Verlauf der Arbeit wird zudem auf die Rechnungslegung bei Verschmelzungen eingegangen. Es werden die Vorschriften für die Bestimmung des Bilanzstichtages, d.h. des Stichtages der Schlussbilanz der übertragenden Rechtsträger sowie des Verschmelzungsstichtages, d.h. des Stichtages der Eröffnungsbilanz des übernehmenden Rechtsträgers erläutert. In einem weiteren Unterabschnitt wird sodann eine Klassifizierung der Verschmelzung als Anschaffungsvorgang im Zusammenhang mit der Klärung des Begriffs und der Ermittlung der Anschaffungskosten vorgenommen. Danach wird die Entstehung des derivativen Firmenwertes diskutiert und die wesentlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften nach HGB und IFRS 3 vorgestellt sowie auf die Behandlung des positiven und des negativen Goodwills eingegangen, bevor in dem Hauptteil der Arbeit auf die Besonderheiten der nachträglichen Anschaffungskosten in Verschmelzungsfällen eingegangen wird. Darin werden unterschiedliche Fälle erörtert, in denen nachträgliche Anschaffungskosten bei einer Verschmelzung entstehen können. Neben dem HGB und den IFRS wird hierbei auch auf die vom Deutschen Standardisierungsrat konzipierten Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- 1. PROBLEMSTELLUNG
- 2. ANWENDUNGSBEREICH VON HGB, UMWG UND IFRS
- 2.1. Nach HGB und UmwG
- 2.2. Nach IFRS
- 3. RECHNUNGSLEGUNG BEI VERSCHMELZUNG
- 3.1. Verschmelzungsstichtag und Bilanzstichtag
- 3.1.1. Der Stichtag der Schlussbilanz
- 3.1.2. Der Verschmelzungsstichtag
- 3.2. Bewertung und Ermittlung der Beherrschung
- 3.3. Wahlrechte und Beurteilungsspielräume bei Ansatz und Bewertung nach HGB und IFRS
- 4. ANSCHAFFUNGSVORGANG UND ANSCHAFFUNGSKOSTEN
- 4.1. Verschmelzung als Anschaffungsvorgang
- 4.2. Begriff und Ermittlung der Anschaffungskosten
- 4.2.1. Kosten des Erwerbs nach HGB
- 4.2.2. Kosten für die Erlangung der Betriebsbereitschaft nach HGB
- 4.2.3. Anschaffungsnebenkosten und nachträgliche Anschaffungskosten nach HGB
- 4.2.4. Anschaffungspreisminderungen
- 4.3. IFRS
- 4.4. Zusammenfassung
- 5. DER FIRMENWERT
- 5.1. Entstehung des derivativen Firmenwertes
- 5.2. Die bilanzielle Einordnung des Differenzbetrages
- 5.3. Grundlegende Ansatz- und Bewertungsregeln des Goodwills
- 5.3.1. Nach HGB
- 5.3.2. Nach IAS/IFRS
- 5.3.2.1. Ansatz- und Bewertungsregeln des Goodwills
- 5.3.2.2. Abschreibung des Goodwills
- 5.3.2.3. Wertminderung und Werttaufholung
- 5.3.2.4. Werthaltigkeit
- 5.3.3. Zusammenfassung
- 5.4. Der negative Goodwill
- 5.4.1. Die fünf Lösungsansätze
- 5.4.1.1. Ausweis als passiver Unterschiedsbetrag
- 5.4.1.2. Abstocken der Zeitwerte/Aktiva
- 5.4.1.3. Ausweis als Eigenkapital
- 5.4.1.4. Passivierung als Rückstellung
- 5.4.1.5. Bildung eines sonstigen Sonderpostens
- 5.4.1.6. Zusammenfassung
- 5.4.2. Nach HGB
- 5.4.3. Nach IFRS
- 6. DIE BEHANDLUNG NACHTRÄGLICHER ANSCHAFFUNGSKOSTEN BEI UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLÜSSEN
- 6.1. Grundlagen
- 6.2. Nachträgliche Anschaffungskosten nach HGB
- 6.3. Nachträgliche Anschaffungskosten nach IFRS
- 6.4. Nachträgliche Aktivierung von Bestandteilen des Firmenwertes
- 6.5. Nachträgliche Anschaffungskosten bei Earn-Out-Klauseln
- 6.5.1. Grundlagen
- 6.5.2. Qualifizierung als Personalkosten
- 6.5.3. Qualifizierung als Kaufpreisbestandteil
- 6.5.4. Bestimmung der Eintrittswahrscheinlichkeit und Verlässlichkeit
- 6.5.5. Beispielrechnung für IFRS 3 und DRS 4
- 6.6. Kaufpreisgarantien bei der Ausgabe von Aktien oder anderen Gegenleistungen
- 6.7. Optionsvereinbarungen
- 6.7.1. Grundlagen der Bilanzierung
- 6.7.2. Bewertung
- 6.7.2.1. Grundlagen
- 6.7.2.2. Bewertungsmodelle
- 6.7.2.2.1. Das Black-Scholes-Modell
- 6.7.2.2.2. Das Binomialmodell
- 6.8. Abzinsung nachträglicher Anschaffungskosten
- 6.9. Anpassungen bereits bilanzierter Werte
- 7. AUSBLICK AUF KOMMENDE ÄNDERUNGEN IN DEN RECHNUNGSLEGUNGSSYSTEMEN DES HGB UND DES IFRS
- 7.1. Bilanzrechtsreform (Gesetzesvorschlag)
- 7.1.1. Neudefinition des Geschäfts- oder Firmenwertes
- 7.1.2. Beizulegende Zeitwerte als Wertkategorie
- 7.2. Exposure Draft IFRS 3
- 7.2.1. Full Goodwill Methode
- 7.2.2. Positiver und negativer Unterschiedsbetrag
- 7.2.3. Anschaffungskostenprinzip
- 8. RESÜMEE
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Besonderheiten nachträglicher Anschaffungskosten im Kontext von Verschmelzungsfällen. Der Fokus liegt dabei auf der Berücksichtigung des Firmenwertes, der im Zuge einer Verschmelzung entsteht. Die Arbeit analysiert die relevanten Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), des Umwandlungsgesetzes (UmwG) und der International Financial Reporting Standards (IFRS) und untersucht die Auswirkungen auf die Bilanzierung.
- Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Ansätze zur Bewertung und Bilanzierung von Firmenwerten im Rahmen von Verschmelzungen.
- Sie analysiert die Behandlung nachträglicher Anschaffungskosten, die im Zusammenhang mit der Integration des erworbenen Unternehmens entstehen können.
- Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von Earn-Out-Klauseln und Optionsvereinbarungen auf die Bilanzierung nachträglicher Anschaffungskosten.
- Sie beleuchtet die Herausforderungen der Bilanzierung von Firmenwerten und nachträglichen Anschaffungskosten im Kontext von IFRS 3 und DRS 4.
- Die Arbeit diskutiert die Auswirkungen der Bilanzrechtsreform und des Exposure Draft IFRS 3 auf die Bilanzierung von Firmenwerten und nachträglichen Anschaffungskosten.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt die Problemstellung dar und erläutert die Relevanz des Themas. Kapitel 2 behandelt den Anwendungsbereich von HGB, UmwG und IFRS im Kontext von Verschmelzungen. Kapitel 3 befasst sich mit der Rechnungslegung bei Verschmelzungen, insbesondere mit dem Verschmelzungsstichtag und der Bewertung der Beherrschung. Kapitel 4 analysiert den Anschaffungsprozess und die Anschaffungskosten im Rahmen von Verschmelzungen. Kapitel 5 behandelt den Firmenwert, seine Entstehung und die verschiedenen Ansätze zur Bilanzierung. Kapitel 6 untersucht die Behandlung nachträglicher Anschaffungskosten bei Unternehmenszusammenschlüssen, insbesondere im Zusammenhang mit Earn-Out-Klauseln und Optionsvereinbarungen. Kapitel 7 gibt einen Ausblick auf kommende Änderungen in den Rechnungslegungssystemen des HGB und des IFRS. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die nachträglichen Anschaffungskosten, Verschmelzungsfälle, Firmenwert, Goodwill, negative Goodwill, Earn-Out-Klauseln, Optionsvereinbarungen, HGB, UmwG, IFRS, Bilanzrechtsreform, Exposure Draft IFRS 3.
Häufig gestellte Fragen
Was sind nachträgliche Anschaffungskosten bei Verschmelzungen?
Es sind Kosten, die erst nach dem eigentlichen Verschmelzungsstichtag anfallen, aber dem Erwerbsvorgang zugerechnet werden müssen, wie z. B. Earn-Out-Zahlungen.
Wie wird der Firmenwert (Goodwill) nach HGB und IFRS behandelt?
Nach HGB wird der Firmenwert planmäßig abgeschrieben, während er nach IFRS einem jährlichen Impairment-Test (Werthaltigkeitsprüfung) unterzogen wird.
Was ist eine Earn-Out-Klausel?
Eine Vereinbarung, bei der ein Teil des Kaufpreises erst später gezahlt wird, abhängig vom Erreichen bestimmter wirtschaftlicher Ziele des übernommenen Unternehmens.
Was passiert bei einem negativen Firmenwert (Badwill)?
Ein negativer Unterschiedsbetrag entsteht, wenn der Kaufpreis niedriger ist als der Zeitwert des Nettovermögens. Er wird je nach Rechnungslegungssystem unterschiedlich passiviert oder erfolgswirksam aufgelöst.
Welche Rolle spielt das Umwandlungsgesetz (UmwG)?
Das UmwG regelt die rechtlichen Rahmenbedingungen für Verschmelzungen, Spaltungen und andere Strukturveränderungen von Unternehmen in Deutschland.
- Quote paper
- Diplom-Kfm Gordon Niegisch (Author), 2008, Besonderheiten nachträglicher Anschaffungskosten in Verschmelzungsfällen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129654