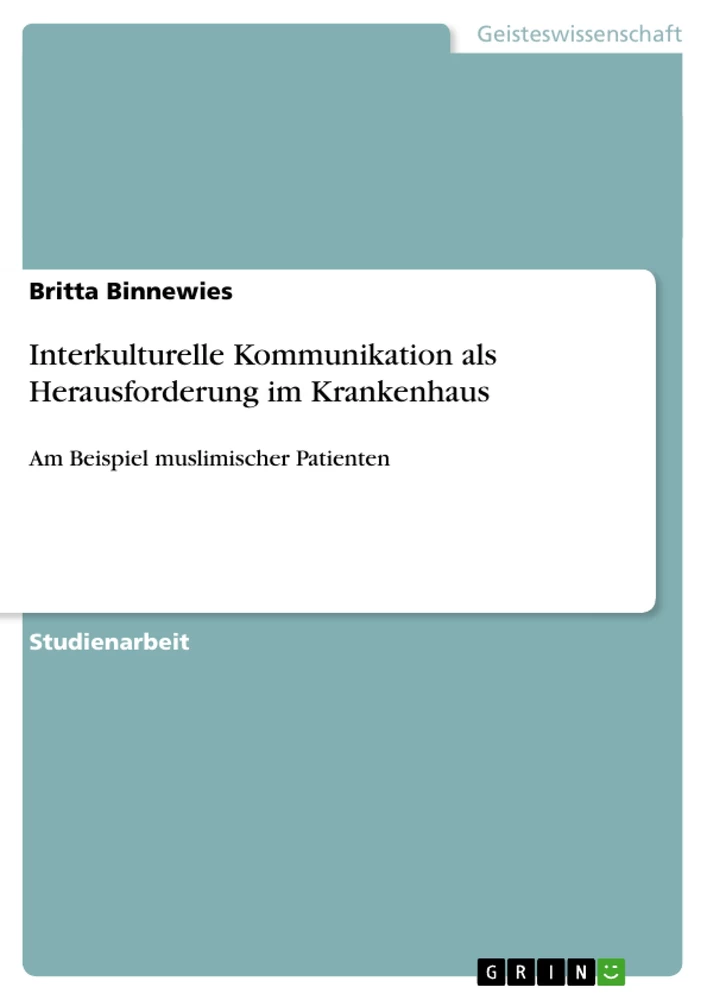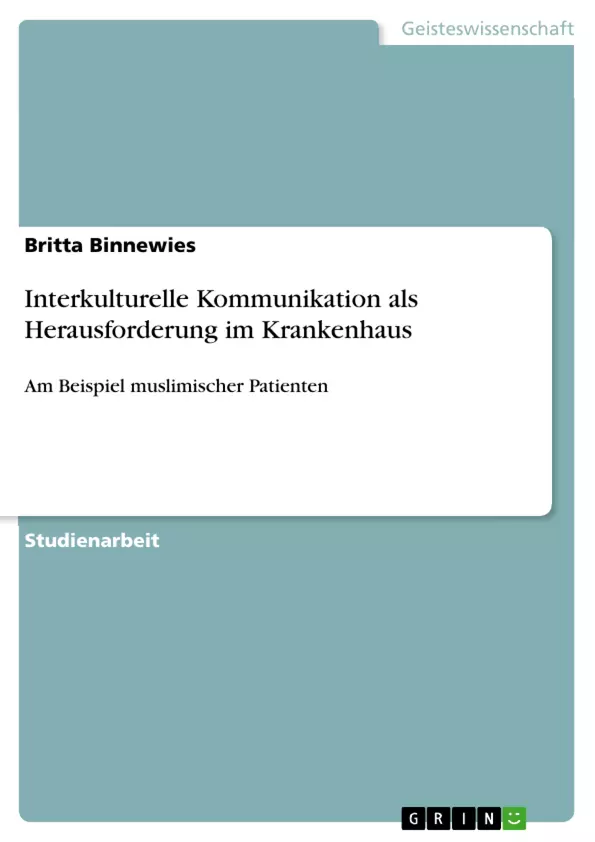Umgezogen ist jeder schon einmal. Man verpackt sein Leben in Kisten, wechselt Wohnung und Wohnort. Am Zielort ist dann alles neu und anders: die Nachbarn, die Einkaufsmöglichkeiten, der Weg zur Arbeit oder zur Schule. Meistens ist dieser Umzug auch mit einer Verbesserung der Lebensumstände verbunden. Der Weg zur Arbeit ist kürzer, die Wohnung komfortabler oder die Gegend schöner. Aber was ist, wenn man in ein neues Land zieht, mit einer fremden Sprache, einer fremden Kultur? Auch für Migranten kann der Umzug in ein anderes Land ein Vorteil sein, der Kontakt zu einer anderen Kultur bringt dennoch viele Herausforderungen mit sich.
Diese Ausarbeitung wird sich damit beschäftigen, wie schwierig es ist einander zu verstehen, wenn kulturell unterschiedlich geprägte Handlungsweisen im Gesundheitssystem in Deutschland aufeinandertreffen. Handlungsweisen in Bezug auf Krankheit, Schmerz, Scham, Sterben oder aber auf Familie können den zunehmend internationaler werdenden Krankenhausaufenthalt prägen.
Im Folgenden wird aufgezeigt, dass der Besuch im Krankenhaus eine große Belastung sowohl für Migranten, als auch für Pfleger oder Ärzte sein kann. Denn im weitesten Sinne hat das Krankenhaus auch eine Art eigener Kultur.
Da das Thema Interkulturelle Kommunikation im Krankenhaus ein sehr weites ist, beziehe ich mich an dieser Stelle auf die Zielgruppe der muslimischen Patienten. Diese bildet in Deutschland die größte zugewanderte Migrantengruppe. Außerdem sind die kulturellen Unterschiede der religiösen Vorstellungen durch den Islam besonders different und somit prägend für die Kommunikation im Krankenhaus zwischen Patient und Angestellten.
Eine Studie der Charité Berlin, die verschiedene ausländische Patienten erfasste, ergab, dass 30% der Untersuchten türkische Patienten waren und 64% der Gesamtgruppe Moslems. Innerhalb der Gesamtgruppe wiesen 54% keine bis geringe Deutschkenntnisse auf , was meine Auswahl der Zielgruppe und die Wichtigkeit der Thematik Sprache verdeutlicht.
Die Kernfrage Interkultureller Kommunikation lautet, welche Faktoren die Entstehung von Missverständnissen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Kultur beeinflussen. Diese Missverständnisse werde ich im Folgenden schildern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition der Zielgruppe Muslimische Patienten
- Sprachliche Schwierigkeiten in der Interaktion zwischen Klinikpersonal und Migranten
- Kulturelle Differenzen
- Die Angehörigen
- Glaube
- Medizinische Maßnahmen
- Intimsphäre und gegengeschlechtlicher Umgang
- Umgang mit Tod und Trauer
- Umgang mit Schmerz
- Notwendige Konsequenzen
- Bereich der stationären Versorgung/ Kliniken
- Bereich der Aus- und Weiterbildung
- Dolmetschen
- Resümee
- Reflexion des Seminars
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung befasst sich mit den Herausforderungen der interkulturellen Kommunikation im Krankenhaus am Beispiel muslimischer Patienten. Sie analysiert die Schwierigkeiten, die aus sprachlichen und kulturellen Differenzen zwischen Klinikpersonal und Migranten entstehen können. Die Arbeit zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse und Erwartungen muslimischer Patienten im Krankenhaus zu schaffen und Handlungsempfehlungen für eine verbesserte interkulturelle Kommunikation zu entwickeln.
- Sprachliche Barrieren
- Kulturelle Unterschiede im Umgang mit Krankheit, Schmerz und Tod
- Religiöse Einflüsse auf medizinische Entscheidungen
- Intimsphäre und gegengeschlechtlicher Umgang
- Notwendige Veränderungen im Gesundheitssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der interkulturellen Kommunikation im Krankenhaus ein und stellt die Zielgruppe der muslimischen Patienten vor. Sie beleuchtet die Bedeutung des Themas im Kontext der zunehmenden Migrationsbewegungen und der damit verbundenen kulturellen Vielfalt in Deutschland.
Das Kapitel "Definition der Zielgruppe Muslimische Patienten" gibt einen Überblick über die Geschichte der türkischen Migration nach Deutschland und die soziokulturellen Besonderheiten der Zielgruppe. Es werden die Herausforderungen der Integration und die spezifischen Bedürfnisse muslimischer Patienten im Krankenhaus beleuchtet.
Das Kapitel "Sprachliche Schwierigkeiten in der Interaktion zwischen Klinikpersonal und Migranten" analysiert die sprachlichen Barrieren, die die Kommunikation zwischen Klinikpersonal und muslimischen Patienten erschweren können. Es werden verschiedene Aspekte der sprachlichen Verständigung, wie z.B. die Bedeutung von Dolmetschern, die Verwendung von Fachbegriffen und die kulturellen Unterschiede in der Kommunikation, behandelt.
Das Kapitel "Kulturelle Differenzen" befasst sich mit den kulturellen Unterschieden, die die Interaktion zwischen Klinikpersonal und muslimischen Patienten beeinflussen können. Es werden verschiedene Bereiche, wie z.B. das Besuchsverhalten der Angehörigen, die religiösen Vorstellungen, die Einstellung zu medizinischen Maßnahmen, die Intimsphäre und der Umgang mit Tod und Trauer, analysiert.
Das Kapitel "Notwendige Konsequenzen" stellt Handlungsempfehlungen für eine Verbesserung der interkulturellen Kommunikation im Krankenhaus vor. Es werden verschiedene Bereiche, wie z.B. die Aus- und Weiterbildung des Klinikpersonals, die Bereitstellung von Dolmetschern und die Entwicklung von interkulturellen Kommunikationsstrategien, behandelt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die interkulturelle Kommunikation, muslimische Patienten, Krankenhaus, sprachliche Barrieren, kulturelle Differenzen, religiöse Einflüsse, medizinische Maßnahmen, Intimsphäre, Tod und Trauer, Dolmetschen, Aus- und Weiterbildung, Integration.
- Quote paper
- Britta Binnewies (Author), 2008, Interkulturelle Kommunikation als Herausforderung im Krankenhaus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129658