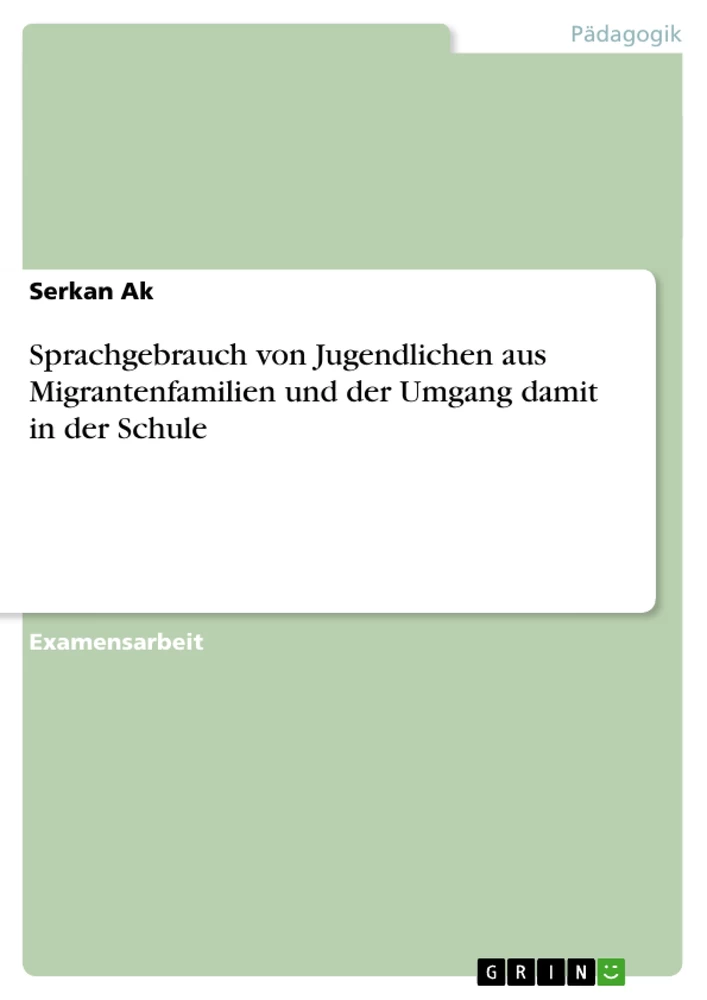Als Einstig in die komplexe Thematik der Mehrsprachigkeit von Migrantenjugendlichen und den Umgang damit an deutschen Schulen habe ich mich im Kapitel 2 mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich die migrationsbedingte sprachlich-kulturelle Heterogenität in Deutschland entwickelt hat und welche Konsequenzen für Erziehung und Bildung zu ziehen sind. Die zunehmende sprachlich-kulturelle Heterogenität ist ein besonders hervorzuhebendes Merkmal unserer Gesellschaft. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist in Deutschland eine sprachlich-kulturelle Heterogenität zu beobachten, die besonders auf eine grenzüberschreitende Migration zurückzuführen ist. Die gesamte Migrationsbewegung hat sich neben allen gesellschaftlichen Bereichen insbesondere auf den Erziehungs- und Bildungsbereich ausgewirkt. Die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft stellt eine Herausforderung für die Lehrkräfte dar, da sie Kompetenzen im Bereich der interkulturellen Erziehung verlangt.
Im Kapitel 3 habe ich meine Ausführungen auf die Kernfrage bezogen, was die charakteristischen Merkmale des Sprachgebrauchs von Migrantenjugendlichen sind. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund wachsen in zwei unterschiedlichen Gesellschaften auf. Ein beträchtlicher Teil dieser wächst im Kontext von Transmigration auf. Unter diesen Bedingungen bilden sie Sprechweisen aus, die man als „Mischsprache“ bezeichnen kann. Diese Sprechweise ist in besonderem Maße durch das Phänomen des Code-switching geprägt. Das Beherrschen zwei oder mehrerer Sprachen ermöglicht die Konstruktion verschiedener Identitätsausprägungen. Auer und Dirim sehen die Sprachmischung als einen wichtigen funktionalen Bestandteil des Sprachgebrauchs mehrsprachiger Jugendlicher, die auf verschiedenen Ebenen identitätsstiftend wirken.
Im Kapitel 4 gebe ich Antwort auf die Frage, wie das deutsche Schulsystem mit Mehrsprachigkeit bzw. Heterogenität umgeht. Es werden auch die Fragen beantwortet, aus welchen Gründen Schüler mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen scheitern und welche schulischen Handlungsmöglichkeiten es zur Förderung gibt. Auf die Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit von Schülern aus Migrantenfamilien wird an deutschen Schulen bisher keine Rücksicht genommen. Gogolin spricht von einem monolingualen Habitus der deutschen Schule, der die Bildungsvoraussetzungen mehrsprachiger Schüler nicht berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Migration und sprachlich-kulturelle Heterogenität
- Begriffsbestimmungen
- Sprachlich-kulturelle Heterogenität in Deutschland
- Folgen für Erziehung und Bildung
- Situation von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien im deutschen Bildungssystem
- Sprachgebrauch von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Familiäre Bedingungen und sprachliche Sozialisation
- Mischsprachliche Varietäten bei türkischstämmigen Jugendlichen
- Spracherhalt und Sprachwandel
- Das Phänomen des Code-switching
- Interferenz und Sprachmischung
- Typische Eigenschaften des Sprachgebrauchs türkischstämmiger Kinder und Jugendlicher in Deutschland
- Beweggründe für den Sprachgebrauch
- Zusammenhang zwischen Sprache und Identität
- Sprachmischung als Ausdruck von Identität
- Identitätsentwicklung am Beispiel türkischstämmiger Jugendlicher
- Mehrsprachigkeit und Schule
- Zur Mehrsprachigkeit
- Umgang mit Mehrsprachigkeit bzw. Heterogenität
- Mehrsprachige Migrantenkinder im Elementarbereich
- Mehrsprachige Migrantenkinder und -jugendliche im Schulbereich
- Blickpunkt Lehrer/innen
- Einstellungen der Lehrenden auf migrationsbedingte Heterogenität
- Gründe für das Scheitern von Schüler/innen mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen
- Schulische Handlungsmöglichkeiten zur Förderung von Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit
- Didaktische Ansätze für einen Deutschunterricht mit Migrantenkindern
- Schulmodelle zur Förderung von Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit
- Modelle sprachlicher Bildung
- Modelle sprachlicher Bildung in Deutschland
- Beispiele für verschiedene Konzepte im Ausland
- Zukunftsperspektiven: Zum Umgang mit Mehrsprachigkeit
- Zukünftige Anforderungen an den Unterricht mit mehrsprachigen Schüler/innen
- Anforderungen an Lehrkräfte
- Mehrsprachigkeit als soziale Realität anerkennen
- Zusammenfassung und Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Staatsexamensarbeit befasst sich mit dem Sprachgebrauch von Jugendlichen aus Migrantenfamilien und dem Umgang damit in der Schule. Ziel ist es, die sprachliche Situation von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem zu beleuchten und die Herausforderungen und Chancen der Mehrsprachigkeit im Schulkontext zu analysieren.
- Sprachliche Sozialisation von Migrantenkindern
- Code-switching und Sprachmischung bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Zusammenhang zwischen Sprache und Identität
- Umgang mit Mehrsprachigkeit in der Schule
- Förderung von Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Bedeutung sprachlicher Kompetenzen im Kontext der zunehmenden Internationalisierung. Sie stellt die Problematik des Schulerfolgs von Migrantenkindern in Deutschland dar und zeigt die Notwendigkeit, die sprachliche Situation dieser Schülergruppe genauer zu betrachten.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Wanderungsgeschehen nach Deutschland und der daraus resultierenden sprachlich-kulturellen Heterogenität. Es werden die Folgen für Erziehung und Bildung aufgezeigt und die Situation von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien im deutschen Bildungssystem analysiert.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Sprachgebrauch von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Es untersucht die familiären Bedingungen und die sprachliche Sozialisation von Migrantenkindern und analysiert das Phänomen des Code-switching, der Interferenz und der Sprachmischung bei türkischstämmigen Jugendlichen. Der Zusammenhang zwischen Sprachmischung und Identität wird ebenfalls beleuchtet.
Das vierte Kapitel behandelt die Mehrsprachigkeit und den Umgang damit in der Schule. Es werden die Einstellungen von Lehrkräften gegenüber migrationsbedingter Heterogenität beleuchtet und Gründe für das Scheitern mehrsprachiger Schüler/innen an deutschen Schulen dargelegt. Des Weiteren werden schulische Handlungsmöglichkeiten zur Förderung von Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit vorgestellt und verschiedene Schulmodelle im In- und Ausland analysiert.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit Zukunftsperspektiven im Umgang mit Mehrsprachigkeit. Es werden die Anforderungen an den Unterricht mit mehrsprachigen Schüler/innen und an Lehrkräfte in der Zukunft beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Sprachgebrauch von Jugendlichen aus Migrantenfamilien, die sprachlich-kulturelle Heterogenität in Deutschland, Code-switching, Sprachmischung, Mehrsprachigkeit, Identität, Umgang mit Mehrsprachigkeit in der Schule, Förderung von Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit, Schulmodelle zur Förderung von Mehrsprachigkeit und Zukunftsperspektiven im Umgang mit Mehrsprachigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was charakterisiert den Sprachgebrauch von Migrantenjugendlichen?
Viele Jugendliche entwickeln „Mischsprachen“, die durch Phänomene wie Code-switching und Interferenz zwischen der Herkunftssprache und Deutsch geprägt sind.
Was versteht man unter „Code-switching“?
Code-switching bezeichnet den fließenden Wechsel zwischen zwei oder mehr Sprachen innerhalb eines Gesprächs oder sogar eines Satzes.
Wie reagiert das deutsche Schulsystem auf Mehrsprachigkeit?
Die Arbeit kritisiert einen „monolingualen Habitus“ der deutschen Schule, der die Mehrsprachigkeit der Schüler oft nicht als Kompetenz berücksichtigt.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Sprache und Identität?
Sprachmischung wirkt oft identitätsstiftend. Sie ermöglicht es Jugendlichen, verschiedene kulturelle Zugehörigkeiten auszudrücken und zu konstruieren.
Warum scheitern Schüler mit Migrationshintergrund oft an Schulen?
Ein Hauptgrund ist, dass Bildungsvoraussetzungen mehrsprachiger Schüler im Unterricht oft nicht ausreichend berücksichtigt und gefördert werden.
Welche Schulmodelle zur Förderung gibt es?
Die Arbeit stellt verschiedene Konzepte zur Förderung von Zwei- und Mehrsprachigkeit im In- und Ausland vor, die über den herkömmlichen Deutschunterricht hinausgehen.
- Citar trabajo
- Serkan Ak (Autor), 2008, Sprachgebrauch von Jugendlichen aus Migrantenfamilien und der Umgang damit in der Schule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129666