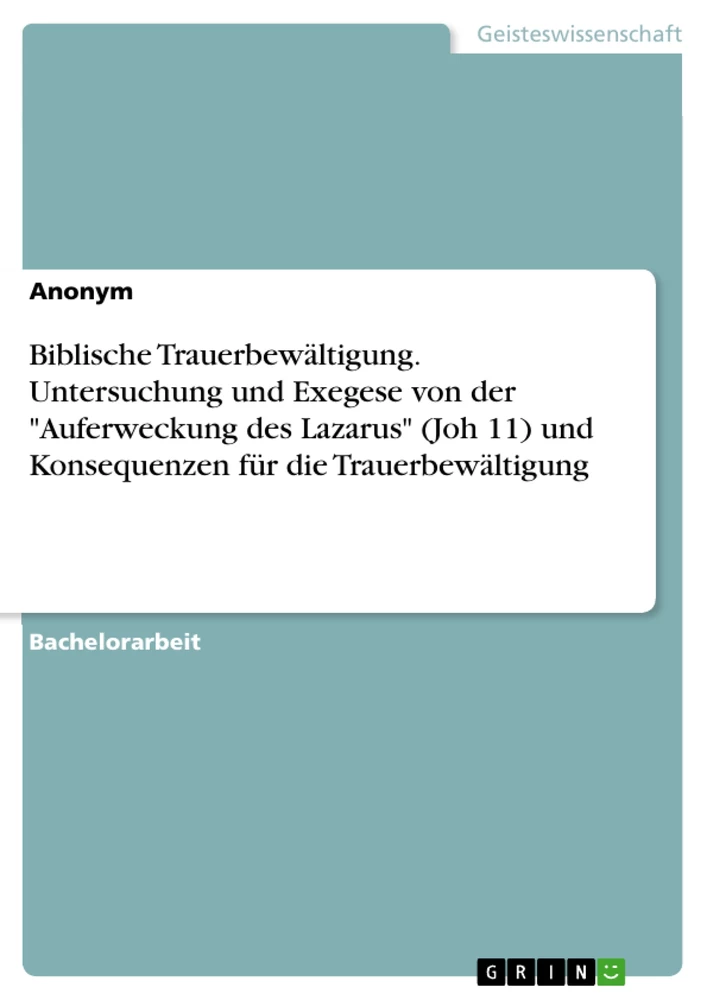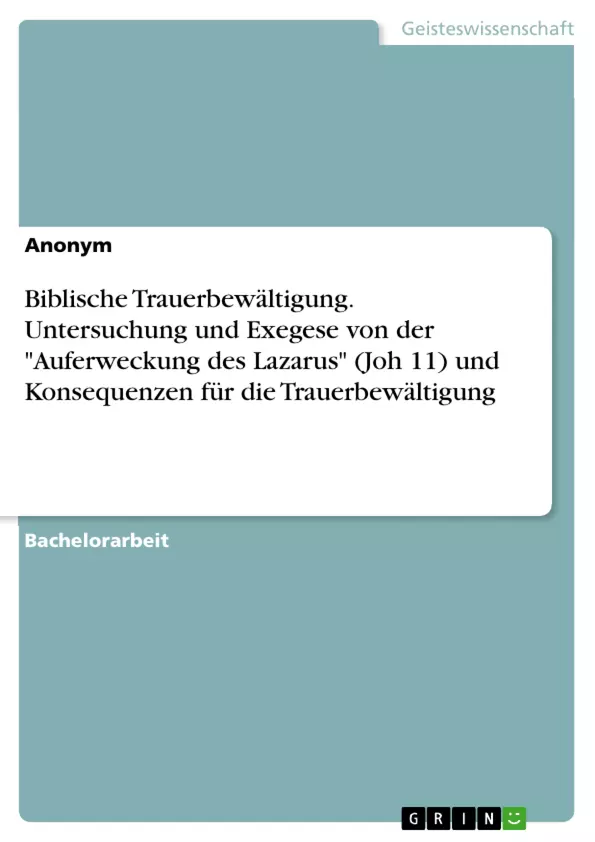Diese Arbeit kann in drei Hauptteile geteilt werden: Erstens fragt sie nach dem richtigen Verständnis von Joh 11 und gibt durch eine Vers-für-Vers-Exegese Antworten auf alle wichtigen Fragen. Zweitens werden die Glaubwürdigkeit der Geschichte und einige besondere Referenzen überprüft. Drittens zielt die Studie darauf ab, eine optimale, praktische Strategie zur Überwindung von Trauer zu entdecken, indem sie vom Vorbild Jesu lernt. Abschließend hat sich die Arbeit mit psychologischen Einwänden befasst und stellt ihnen einige Zitate und Gedanken aus der Bibel gegenüber.
Zunächst werden aufgrund der Suche nach dem richtigen Verständnis von Joh 11 theologische Kommentare und Literatur verwendet. Die Methode, den Text zu unterteilen, ist eine Vers-für-Vers-Exegese und der beste Weg, um einen biblischen Text zugänglich zu machen. Der zweite Teil gibt Antworten auf vier wesentliche Dinge: (1) die Möglichkeit, die biblische Erzählung als Symbol zu verstehen, (2) die Erzählung im Vergleich zu den anderen Evangelien, (3) die Sprache und Sichtweise des Autors, (4) ein Blick auf außerbiblische Quellen. Der ganze Teil zielte darauf ab, die Erzählung glaubwürdig zu machen. Es werden theologische Kommentare und Literatur verwendet.
Für den dritten Teil wurde u.a. Literatur von Elisabeth Kübler-Ross und Yorick Spiegel herangezogen. Die Methode Jesu in Joh 11 wurde in praktischen Vorschlägen auf die Stufen der Trauer übertragen. Der letzte Teil enthält Schriften von Sigmund Freud und Zitate des Apostels Paulus und auch Dietrich Bonhoeffer.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stellenwert der Perikope im Kontext des Johannesevangeliums
- Verfasserschaft des Johannesevangeliums
- Abfassungsort und Zeit
- Die Auferweckung des Lazarus als „Zeichen“ / Wunder - Das Somei-on-Konzept
- Die Eigenschaften eines Zeichens
- Die Auswirkung eines Zeichens
- Gliederung
- Exegese
- V.1-6: Die Vorstellung der Personen und der Notlage
- V.7 - 16 Der Dialog mit den Jüngern und die Angst vor den Juden
- V.17 - 27 Die Begegnung Jesu mit Marta
- V.28-37 Die Begegnung der Maria und die Trauer Jesu
- V.38-46 Die Auferstehungshandlung am Grab
- V.47 - 57 Ratssitzung über Jesus: Beschluss, ihn zu töten
- V.54-57 Der Rückzug Jesu
- Die Lazaruserzählung als Geschehnis oder Symbol verstehen?
- Der Blick auf die anderen Evangelien
- Die Sprache und Ansicht des Verfassers
- Außerbiblische Quellen
- Die bleibende Schwierigkeit an die Begebenheit des Lazarus zu glauben
- Praktische Konsequenzen für die Trauerbewältigung bei Todesfällen
- Einordnung in die Trauerphasen von Marta und Maria
- Die Einordnung der Marta
- Einordnung der Maria
- Lernen am Modell Jesu: Die Grenzen
- Lernen am Modell Jesus: Die Möglichkeiten
- Jesus ist da und hört zu
- Jesus hält Abstand
- Jesu Umgang mit Anschuldigung und der Aufbau von Glaube
- Jesus liebt und zeigt Mitgefühl
- Der Trost der christlichen Trauerbewältigung und die Angst vor dem Tod
- Die Angst des modernen Menschen
- Die christliche Botschaft und das Verhältnis zum Tod
- Dietrich Bonhoeffer als Beispiel für einen furchtlosen Tod
- Christliche Jenseitsvorstellung als billiger Trost und Verdrängung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die biblische Erzählung von der Auferweckung des Lazarus (Johannes 11) und deren Relevanz für die Trauerbewältigung. Durch eine exegetische Analyse des Textes soll ein tieferes Verständnis des Ereignisses gewonnen und dessen Glaubwürdigkeit beleuchtet werden. Im Anschluss daran werden die darin enthaltenen Botschaften und Lehren für die Bewältigung von Trauer und Verlust im Kontext christlichen Glaubens beleuchtet.
- Exegese und Interpretation der Lazarus-Perikope
- Theologische Aspekte der Auferstehung und des Lebens nach dem Tod
- Tragweite des Ereignisses für die christliche Trauerbewältigung
- Vergleich mit psychologischen Modellen der Trauerbewältigung
- Relevanz des christlichen Glaubens für die Bewältigung von Verlust und Tod
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Stellenwert der Lazarus-Perikope im Johannesevangelium beleuchtet, die Verfasserschaft, den Abfassungsort und die Zeit des Evangeliums sowie die Bedeutung der Auferweckung als „Zeichen“ erörtert. Im Anschluss daran erfolgt eine detaillierte Exegese des Textes in mehreren Abschnitten, die die einzelnen Versgruppen analysieren. Dabei werden die jeweiligen Figuren, Dialoge und Handlungen im Kontext des Textes beleuchtet.
Das dritte Kapitel untersucht, ob die Lazaruserzählung als Geschehnis oder als Symbol verstanden werden soll. Hierbei werden die Perspektiven der anderen Evangelien, die Sprache und Ansicht des Autors sowie außerbiblische Quellen einbezogen. In den folgenden Kapiteln werden die praktischen Konsequenzen für die Trauerbewältigung anhand des Modells Jesu und im Vergleich mit psychologischen Trauermodellen (Kübler-Ross, Spiegel) erörtert. Dabei werden die Trauerphasen von Marta und Maria in die Modelle eingeordnet und anhand des Verhaltens Jesu hilfreiche Handlungsoptionen für Trauernde aufgezeigt.
Abschließend werden der Trost der christlichen Trauerbewältigung, die Angst vor dem Tod und die Jenseitsvorstellung im christlichen Glauben beleuchtet. Es werden auch kritische Aspekte wie die Gefahr der Verdrängung und die Abgrenzung zu anderen Religionen thematisiert.
Schlüsselwörter
Auferweckung des Lazarus, Johannes 11, Trauerbewältigung, christlicher Glaube, Exegese, Theologie, Symbol, Tod, Jenseitsvorstellung, Kübler-Ross, Spiegel, Dietrich Bonhoeffer, Glaube, Hoffnung
Häufig gestellte Fragen
Was lehrt die Auferweckung des Lazarus über Trauer?
Die Erzählung in Johannes 11 zeigt verschiedene Trauerphasen (Marta und Maria) und wie Jesus durch Mitgefühl, Zuhören und Hoffnung Trost spendet.
Ist die Lazaruserzählung historisch oder symbolisch zu verstehen?
Die Arbeit vergleicht exegetisch beide Ansätze unter Einbeziehung außerbiblischer Quellen und der Sprachweise des Verfassers.
Wie ordnet man Marta und Maria in moderne Trauermodelle ein?
Das Verhalten der Schwestern wird mit den Trauerphasen von Elisabeth Kübler-Ross und Yorick Spiegel verglichen.
Was bedeutet das "Semeion-Konzept" bei Johannes?
Wunder werden im Johannesevangelium als "Zeichen" (Semeia) verstanden, die auf eine tiefere theologische Wahrheit über Jesus als Sohn Gottes hinweisen.
Welche Rolle spielt Dietrich Bonhoeffer in dieser Arbeit?
Bonhoeffer dient als Beispiel für einen furchtlosen Umgang mit dem Tod aus christlicher Überzeugung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Biblische Trauerbewältigung. Untersuchung und Exegese von der "Auferweckung des Lazarus" (Joh 11) und Konsequenzen für die Trauerbewältigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1296772