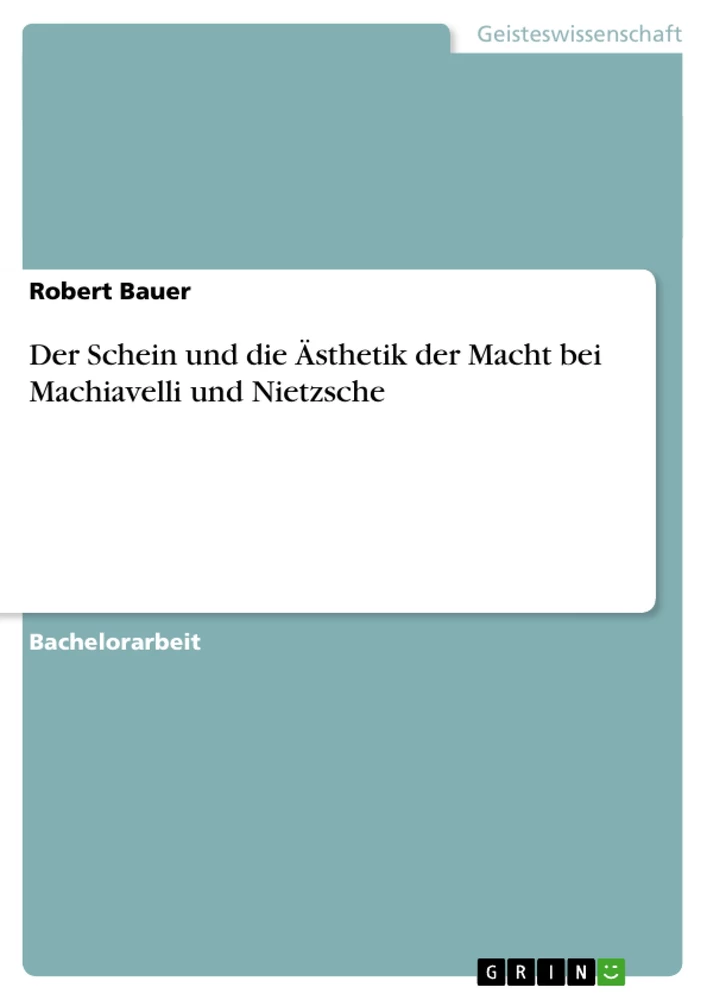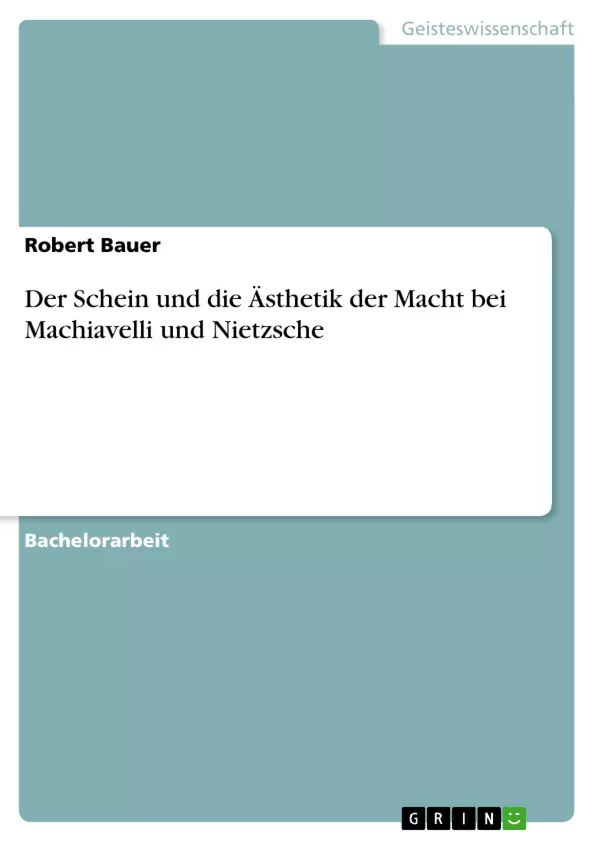Heute werden im Namen Machiavellis Handbücher und Abhaklisten der Macht zum alltäglichen Gebrauch für jeden daher gelaufenen Manager vertrieben. Seine Aussagen polarisieren - und das treibt die Absatzzahlen in die Höhe.
Gerade zu Beginn der Neuzeit ist Machiavelli einer der ersten, der begreift, dass die Todesstunde für ein transzendentes Weltverständnis zur Legitimierung des Machtanspruchs bereits geschlagen hat. In einer solchen Welt muss sich Macht behaupten und zwar ohne Hilfe durch eine höhere Gewalt und gegen die stets volatilen Einzelinteressen der Beteiligten. Der Fürst ist nun der Vielzahl an Perspektiven ausgesetzt und muss den Blicken des Publikums standhalten. Für diese Zwecke muss sich der Herrscher der Ästhetik der Macht bedienen. Der damit inszenierte Schein wird zur Grundlage jeder realistischen Politik.
Friedrich Nietzsche greift gute 350 Jahre später einige Aspekte des Florentiners auf und entwickelt sie in seiner Theorie vom Übermenschen weiter. Freilich: ihm geht es weniger um das Wissen um die Macht als vielmehr um den oft zitierten Willen zur Macht, der gewissermaßen als tief greifender Instinkt dem Menschen inne wohnt. Den genauen Zusammenhang erhält der Leser am Ende dieses Textes, doch zuvor widmen wir uns ausführlich dem Schein und der Ästhetik der Macht bei Machiavelli.
Inhaltsverzeichnis
- Das Wissen um Macht
- Der Begriff der politischen Macht
- Machiavelli und seine Zeit
- Machiavellis Kindheit und die Medicis
- Savonarola - eine Sünde gegen die Gelegenheit
- Caterina Sforza und die List einer Mutigen
- Machiavelli bei Cesare Borgia, dem Meister des Verrats
- Der Schein und die Ästhetik der Macht
- Konfrontation mit anderen Philosophen
- Thukydides und die Politik jenseits von Gut und Böse
- Platon und die Philosophenkönige
- Aristoteles und der Hass der Bevölkerung
- Cicero und der Irrtum über die Heuchelei
- Das Neue an Machiavellis Gedanken
- Machiavellis Menschenbild
- Die menschliche Kleingläubigkeit
- Egoismus als Grundprinzip
- Virtù - die Fürstentugend
- Die Religion als Stütze der Zivilisation
- Die Ästhetik der Macht
- Die Bedeutung der Perspektive
- Die Rolle der Darstellung und der Medien
- Der Schein der Macht
- Der Schein als Bindemittel zwischen Wirklichkeit und Image
- Mehr Schein als Sein
- Der Fürst als Täuscher und Heuchler
- Konfrontation mit anderen Philosophen
- Reaktionen und Einflüsse
- Machiavellismus
- Eine konstruktive Auseinandersetzung mit Machiavelli
- Botero, Bodin und Bacon
- Thomas Hobbes und der Preis der Menschen
- Mandeville und die Laster der Gesellschaft
- Helvétius und die Liebe zur Macht
- Nietzsche und der Wille zur Macht
- Menschliches
- Die Macht des Scheins
- Der Wille zur Macht
- Herrenmoral und Sklavenmoral
- Vom schöpferischen Übermenschen
- Wege jenseits von Gut und Böse
- Abkürzungen und Quellenverzeichnis
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, wie Macht im Denken von Niccolò Machiavelli und Friedrich Nietzsche inszeniert wird. Die Arbeit analysiert die Konzepte des Scheins und der Ästhetik der Macht bei beiden Denkern und untersucht, wie diese Konzepte die Wahrnehmung und Ausübung von Macht beeinflussen.
- Die Rolle des Scheins in der Machtausübung
- Die Bedeutung der Ästhetik für die Legitimierung von Macht
- Die Beziehung zwischen Macht und Moral
- Die Auswirkungen der Macht auf das Individuum und die Gesellschaft
- Die Relevanz der Konzepte von Machiavelli und Nietzsche für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik des Wissens um Macht ein und beleuchtet die Bedeutung von Machiavellis Werk für das politische Denken. Es wird die These aufgestellt, dass Macht in einer Welt ohne transzendenten Weltverständnis neu definiert werden muss und sich der Ästhetik der Macht bedienen muss, um sich zu behaupten.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der politischen Macht und stellt die verschiedenen Facetten von Macht in den Vordergrund. Es wird die Frage nach der Legitimität von Macht und der Rolle des Staates in der Gesellschaft aufgeworfen.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Leben und Werk von Niccolò Machiavelli. Es werden seine Kindheit, seine Zeit in Florenz und seine Begegnung mit Cesare Borgia beleuchtet.
Das vierte Kapitel analysiert Machiavellis Konzeption des Scheins und der Ästhetik der Macht. Es wird die Frage nach dem Verhältnis von Schein und Sein, der Rolle der Perspektive und der Bedeutung der Darstellung für die Machtausübung untersucht.
Das fünfte Kapitel beleuchtet die Reaktionen und Einflüsse von Machiavellis Werk auf die politische Philosophie. Es werden die Konzepte von Botero, Bodin, Bacon, Hobbes, Mandeville und Helvétius in Bezug auf Machiavelli diskutiert.
Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit Friedrich Nietzsche und seinem Konzept des Willens zur Macht. Es werden die Themen des Menschlichen, der Macht des Scheins, der Herrenmoral und der Sklavenmoral sowie der schöpferische Übermensch behandelt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Schein, die Ästhetik der Macht, die politische Philosophie, Niccolò Machiavelli, Friedrich Nietzsche, der Wille zur Macht, die Legitimität von Macht, die Rolle des Staates, die Perspektive, die Darstellung, die Moral, das Individuum, die Gesellschaft und die Relevanz für die heutige Zeit.
- Citation du texte
- Robert Bauer (Auteur), 2009, Der Schein und die Ästhetik der Macht bei Machiavelli und Nietzsche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129678