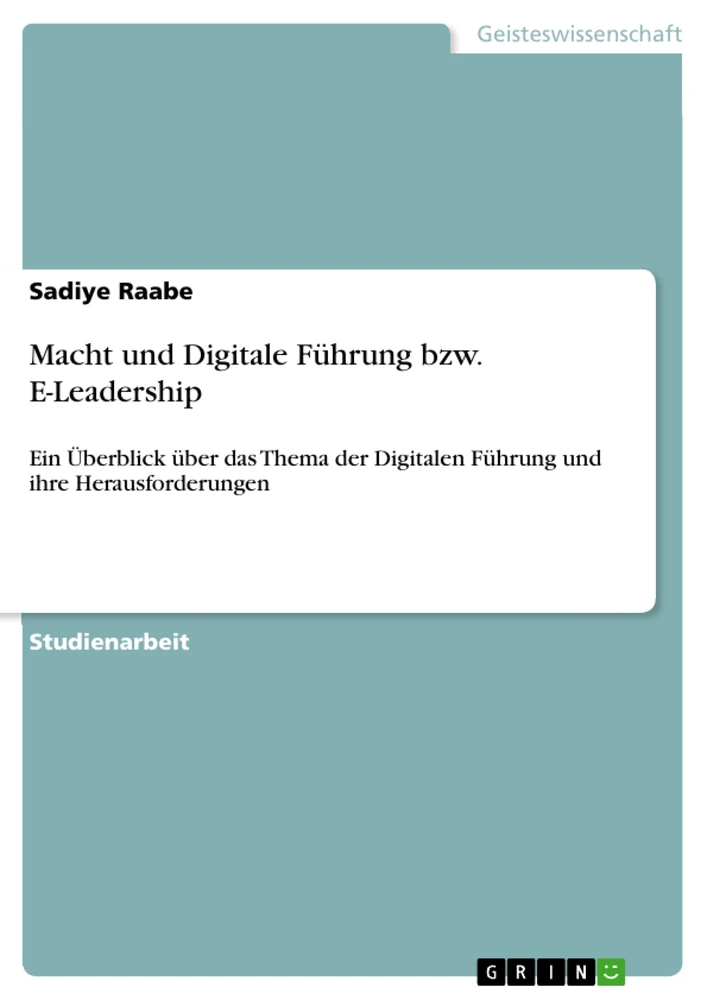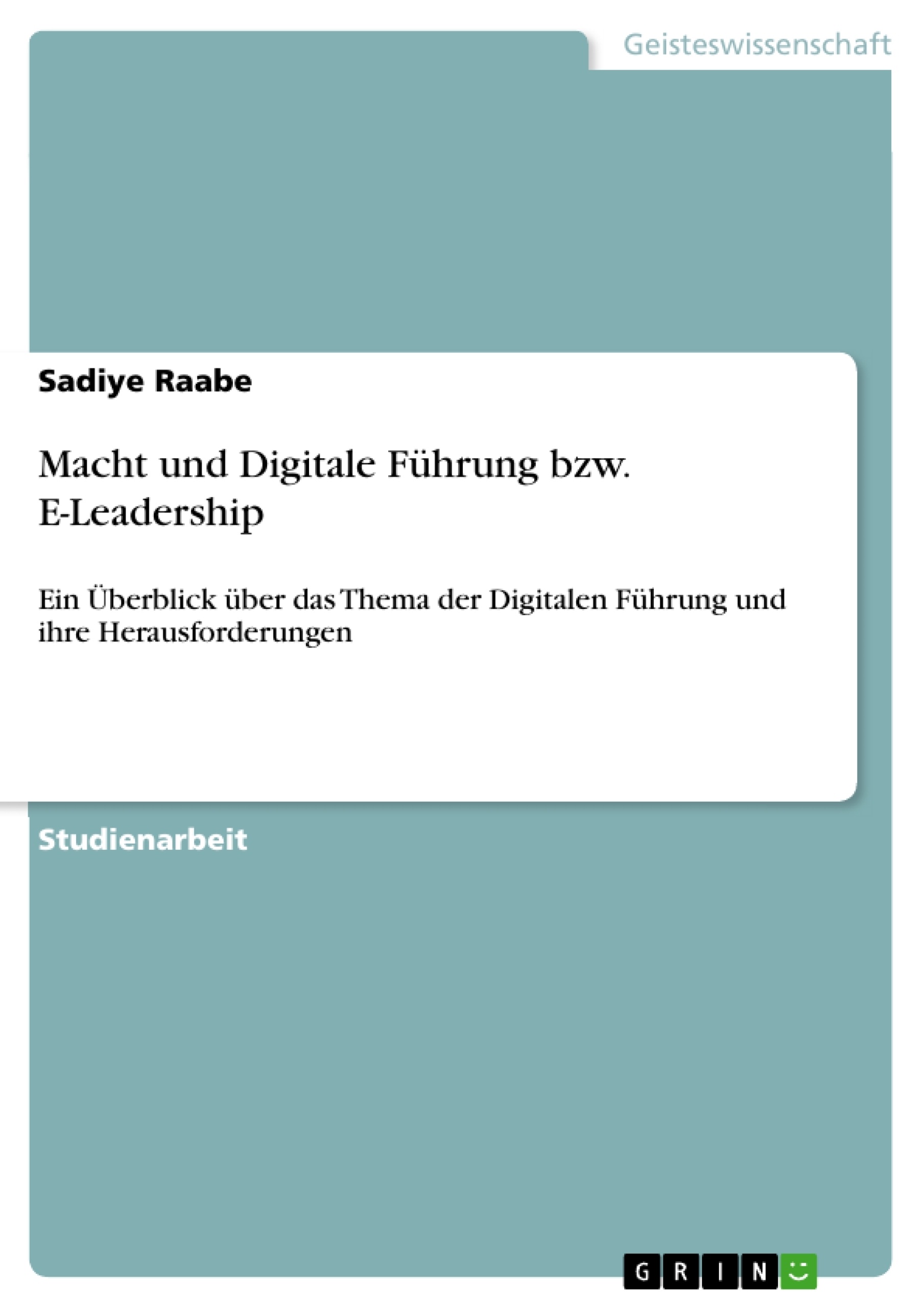Es wird ein Überblick über das Thema Digitale Führung bzw. E-Leadership gegeben und welche Herausforderungen in diesem Zusammenhang bestehen. Es wird ausgearbeitet, wie ein Umgang mit Macht aussehen kann und welche Eigenschaften und Kompetenzen Führungskräfte mitbringen sollten, um in einer zunehmend digitalisierten Welt erfolgreich führen zu können.
In der vorliegenden Arbeit wird zunächst ein Überblick über Theorien und Ansätze über Führung und Macht, dem Zusammenspiel über Führung und Macht sowie Digitale Führung bzw. E-Leadership hergestellt werden. Dazu beginnt die Arbeit mit einem Überblick über Führung (Abschnitt 2), wobei zunächst vorgestellt wird, was Führung ist und wie Führung definiert wird. Dann folgt ein Überblick über verschiedene Theorien aus der Führungsforschung, von den klassischen bis zu den neueren Führungstheorien. Anschliessend folgt ein Resümee über die klassischen und neueren Theorien. Abschliessend folgt noch ein Einblick in aktuelle Themen der Führungsforschung.
Verschiedene Aspekte von Macht haben einen wichtigen Einfluss auf die Führung von Mitarbeitenden. Dazu wird das Thema der Macht näher beleuchtet (Abschnitt 3), indem zunächst angeschaut wird, was Macht überhaupt ist, um dann die verschiedenen Ebenen und Quellen von Macht, deren dunklen, aber auch positiven Seiten vorzustellen.
Im Anschluss werden der Zusammenhang und das Wechselspiel zwischen Führung und Macht (Abschnitt 4) näher vorgestellt.
In der modernen Arbeitswelt gewinnt die digitale Führung an Bedeutung. Basierend auf den Grundlagen der vorangegangenen Kapitel werden im Abschnitt 5 verschiedene Facetten der digitalen Führung bzw. E-Leadership näher betrachtet. Dazu wird zunächst geklärt, was unter digitaler Führung zu verstehen ist und welche Kompetenzen von Führungskräften in der digitalen Welt notwendig sind. Es werden Herausforderungen der digitalen Führung sowie ein veränderter Umgang mit Macht in der digitalen Führung betrachtet.
Im Abschnitt 6 werden die Effekte der digitalen Führung kritisch betrachtet und diskutiert.
Die Arbeit wird mit einem Fazit abgeschlossen (Abschnitt 7).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Führung (inkl. Forschungsstand)
- 2.1 Was ist Führung?
- 2.2 Definition von Führung
- 2.3 Führungsforschung
- 2.3.1 Klassische Führungstheorien
- 2.3.2 Neuere Führungstheorien
- 2.3.3 Fazit zu den klassischen und neueren Führungstheorien
- 2.3.4 Aktuelle Themen der Führungsforschung
- 3. Macht als komplexes Phänomen
- 3.1 Was ist Macht?
- 3.2 Ebenen und Quellen der Macht
- 3.3 Die dunkle Seite der Macht auf den Machthaber
- 3.4 Die positive Seite der Macht auf den Machthaber
- 4. Führung und Macht
- 5. Digitale Führung bzw. E-Leadership
- 5.1 Was ist digitale Führung?
- 5.2 Kompetenzen von Führungskräften in der digitalisierten Welt
- 5.3 Herausforderungen der digitalen Führung
- 5.4 Umgang mit Macht in der digitalen Führung
- 6. Kritische Betrachtung und Diskussion
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik der digitalen Führung in Unternehmen und beleuchtet die damit einhergehenden Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit "Macht". Das Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die digitale Führung zu geben und zu analysieren, welche Eigenschaften und Kompetenzen Führungskräfte in der digitalisierten Welt benötigen, um erfolgreich zu sein.
- Definition und verschiedene Theorien der Führung
- Macht als ein zentrales Element in Führungsprozessen
- Das Konzept der digitalen Führung und E-Leadership
- Herausforderungen der digitalen Führung in der Praxis
- Der Umgang mit Macht in der digitalen Führungsrolle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Begriff der Führung und ihrer verschiedenen Facetten, von der Mitarbeiterführung bis zur Unternehmensführung. Anschließend werden wichtige Theorien und Ansätze aus der Führungsforschung beleuchtet, darunter klassische und neuere Ansätze sowie aktuelle Forschungsschwerpunkte.
Im weiteren Verlauf wird das komplexe Phänomen "Macht" näher betrachtet. Die verschiedenen Ebenen und Quellen von Macht werden analysiert, sowie die positiven und negativen Auswirkungen von Macht auf die Machthaber selbst. Der Zusammenhang zwischen Führung und Macht wird dann im Detail erörtert.
Im fünften Kapitel wird der Fokus auf die digitale Führung gelegt. Die Definition von digitaler Führung wird erläutert, sowie die spezifischen Kompetenzen, die Führungskräfte in der digitalisierten Welt benötigen. Die Arbeit beleuchtet außerdem die Herausforderungen der digitalen Führung und den veränderten Umgang mit Macht in diesem Kontext.
Das sechste Kapitel bietet eine kritische Betrachtung der Effekte der digitalen Führung.
Schlüsselwörter
Digitale Führung, E-Leadership, Führungstheorien, Macht, Machtstrukturen, Kompetenzen, Herausforderungen, Digitalisierung, Unternehmenskultur, Mitarbeiterführung, Führungsforschung, moderne Arbeitswelt.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "E-Leadership"?
E-Leadership oder digitale Führung bezeichnet die Leitung von Teams und Organisationen unter Nutzung digitaler Kommunikationstechnologien in einer vernetzten Arbeitswelt.
Wie verändert sich der Umgang mit Macht in der digitalen Führung?
In der digitalen Welt müssen Führungskräfte Machtquellen neu bewerten, da hierarchische Kontrolle oft durch Vertrauen und Kompetenz ersetzt werden muss.
Welche Kompetenzen benötigen Führungskräfte in der digitalisierten Welt?
Neben technischem Verständnis sind soziale Kompetenzen, Flexibilität und die Fähigkeit zur virtuellen Beziehungsgestaltung entscheidend.
Gibt es eine "dunkle Seite" der Macht bei Führungskräften?
Die Arbeit beleuchtet sowohl positive als auch negative Auswirkungen von Macht auf den Machthaber selbst, wie etwa die Gefahr von Machtmissbrauch.
Was sind die größten Herausforderungen der digitalen Führung?
Herausforderungen liegen in der räumlichen Distanz, der Informationsflut, der Aufrechterhaltung der Unternehmenskultur und der veränderten Mitarbeiterführung.
- Arbeit zitieren
- Sadiye Raabe (Autor:in), 2021, Macht und Digitale Führung bzw. E-Leadership, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1297633