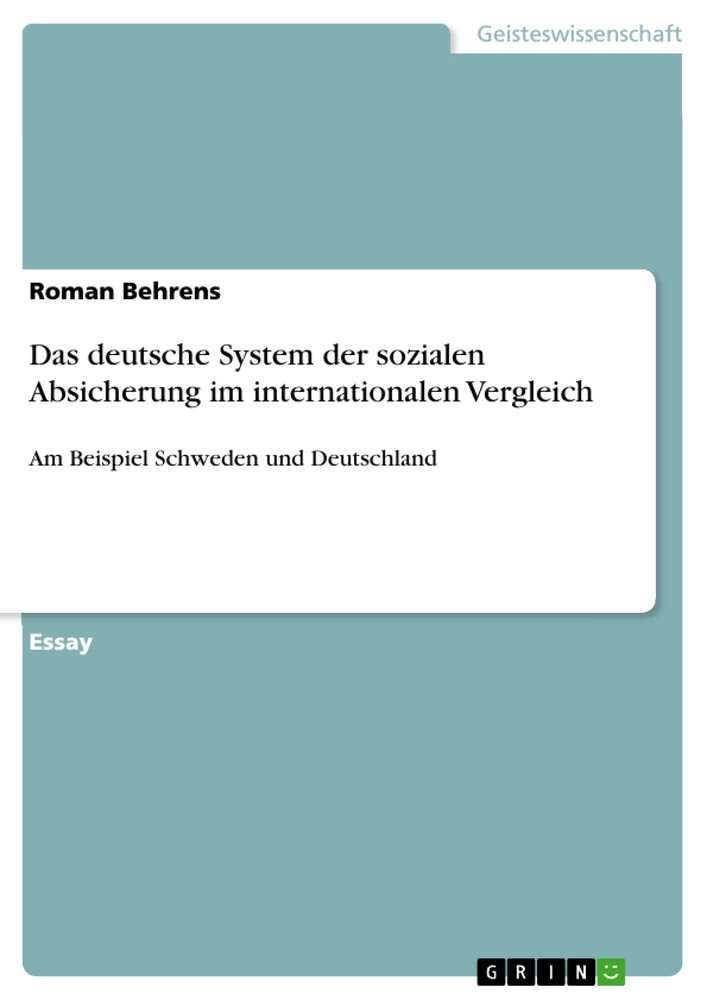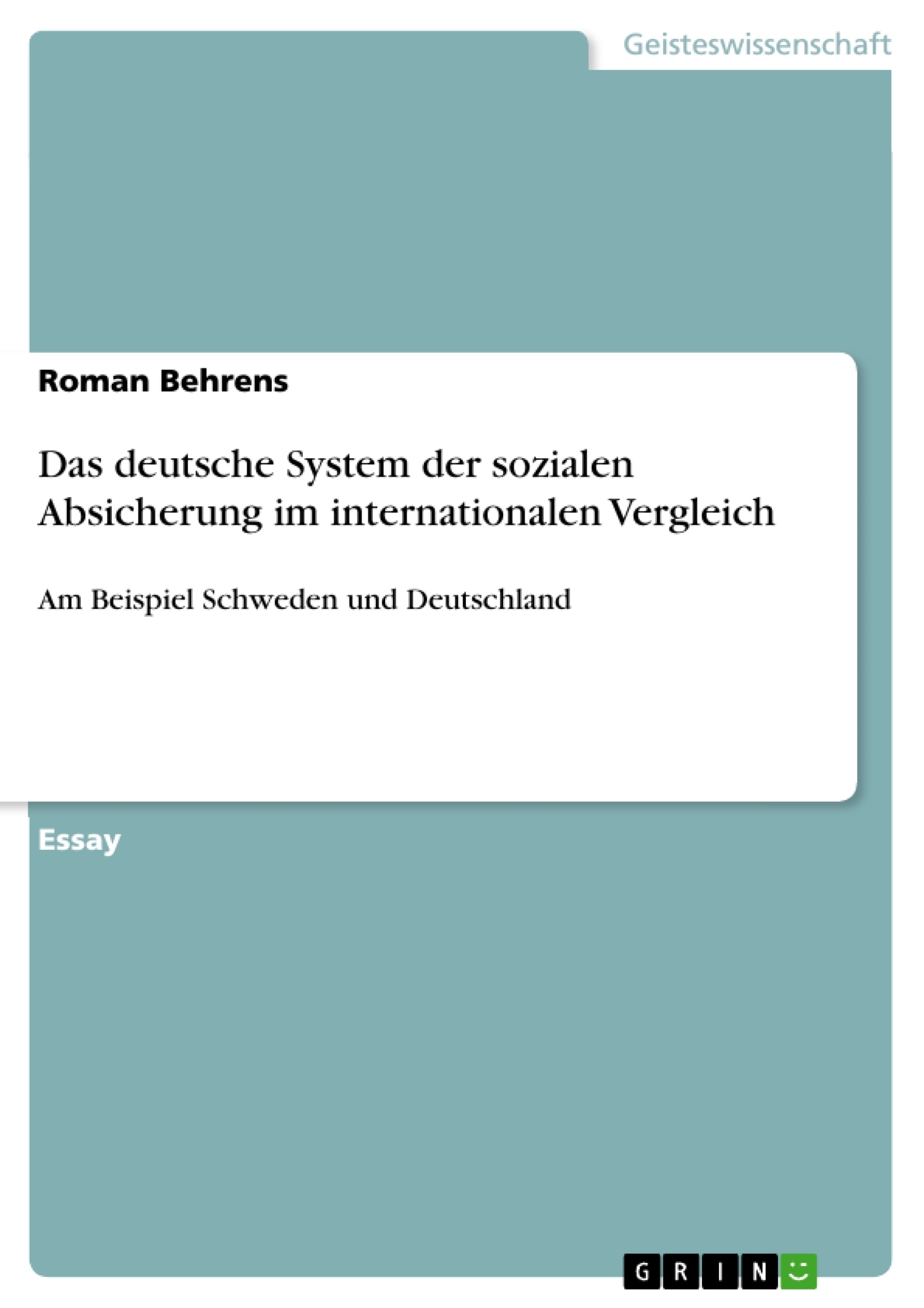„Das Übel erkennen heißt schon, ihm teilweise abhelfen...“
Das wohl größte Übel im ausgehenden 19.Jahrhundert war das Elend der Arbeiterklasse. Reichskanzler Bismarck erkannte genau dies und ohne das gerade eben von ihm zitierte wie erkannte Übel wäre er nicht auf die Idee gekommen etwas Grundlegendes in Deutschland einzuführen: die ersten Gesetze und Versicherungen, welche die Menschen jener Zeit vor finanziellem Unheil bei drohender Arbeitslosigkeit bewahren sollte.
Im Rahmen dieses Essays soll daher versucht werden, eine Antwort darauf zu finden, inwiefern das deutsche System der sozialen Absicherung einem internationalen Vergleich standhält. Deshalb soll neben einer kleinen einführenden historischen Exkursion in die Thematik das System der sozialen Absicherung von Deutschland und Schweden vergleichend betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Das Übel erkennen heißt schon, ihm teilweise abhelfen...
- Die heutige soziale Absicherung erfolgt in mehrebiger Hinsicht.
- Dieser Einführung in die Theorie der sozialen Absicherung soll nun ein praxisnaher Vergleich von zwei europäischen Staaten, hier Deutschland und Schweden, folgen.
- Diesem schwedischen Modell steht das konservative Modell Deutschlands gegenüber.
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert das deutsche System der sozialen Absicherung im internationalen Vergleich, wobei Schweden als Referenzland dient. Ziel ist es, die Stärken und Schwächen des deutschen Systems aufzuzeigen und seine Positionierung im internationalen Kontext zu beleuchten.
- Historische Entwicklung der sozialen Absicherung in Deutschland
- Vergleichende Analyse der sozialen Sicherungssysteme in Deutschland und Schweden
- Die Rolle des Staates in der sozialen Absicherung
- Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der sozialen Absicherung
- Der Einfluss der sozialen Absicherung auf die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Übel erkennen heißt schon, ihm teilweise abhelfen...: Dieser Abschnitt bietet einen kurzen historischen Überblick über die Entstehung der sozialen Absicherung in Deutschland und zeigt die Bedeutung der Sozialreformen Bismarcks auf. Die Entstehung der Sozialversicherungssysteme in anderen europäischen Ländern wird ebenfalls beleuchtet.
- Die heutige soziale Absicherung erfolgt in mehrebiger Hinsicht.: Dieser Abschnitt erläutert die verschiedenen Formen der sozialen Absicherung und die unterschiedlichen Organisationsformen von Sicherungssystemen. Die verschiedenen Typen von Wohlfahrtsstaaten nach Esping-Andersen werden vorgestellt.
- Dieser Einführung in die Theorie der sozialen Absicherung soll nun ein praxisnaher Vergleich von zwei europäischen Staaten, hier Deutschland und Schweden, folgen.: Dieser Abschnitt beschreibt das schwedische System der sozialen Sicherheit, welches auf drei Säulen basiert: der allgemeinen Sozialversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der sozialen Mindestsicherung. Die Universalität des schwedischen Modells und seine Finanzierung werden erläutert.
- Diesem schwedischen Modell steht das konservative Modell Deutschlands gegenüber.: Dieser Abschnitt beschreibt das deutsche System der sozialen Absicherung, welches sich in die Sozialversicherung, die Sozialhilfe sowie spezielle Hilfs- und Förderprogramme gliedert. Die Finanzierung des deutschen Systems und seine Herausforderungen werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die soziale Absicherung, den internationalen Vergleich, Deutschland, Schweden, Bismarck-Modell, Beveridge-Modell, Wohlfahrtsstaat, Sozialversicherung, Sozialhilfe, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Universalität, Kategorialität, Finanzierung, Herausforderungen, Zukunftsperspektiven.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich das deutsche Sozialsystem vom schwedischen?
Deutschland folgt dem konservativen Bismarck-Modell (beitragsfinanziert), während Schweden ein universalistisches Modell (steuerfinanziert, für alle Bürger) anwendet.
Welche Rolle spielte Bismarck für die soziale Absicherung?
Bismarck führte Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Sozialversicherungen ein, um das Elend der Arbeiterklasse zu lindern und politische Stabilität zu sichern.
Was kennzeichnet einen universalistischen Wohlfahrtsstaat?
Leistungen werden unabhängig vom Erwerbsstatus an alle Bürger gewährt, was zu einer stärkeren sozialen Gleichheit führt (z.B. in Schweden).
Wie werden die Sozialversicherungen in Deutschland finanziert?
Hauptsächlich durch paritätische Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung.
Vor welchen Herausforderungen stehen moderne Sicherungssysteme?
Demografischer Wandel, Arbeitslosigkeit und Globalisierung setzen die Finanzierbarkeit und den Leistungsumfang der Wohlfahrtsstaaten unter Druck.
- Quote paper
- Roman Behrens (Author), 2008, Das deutsche System der sozialen Absicherung im internationalen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129790