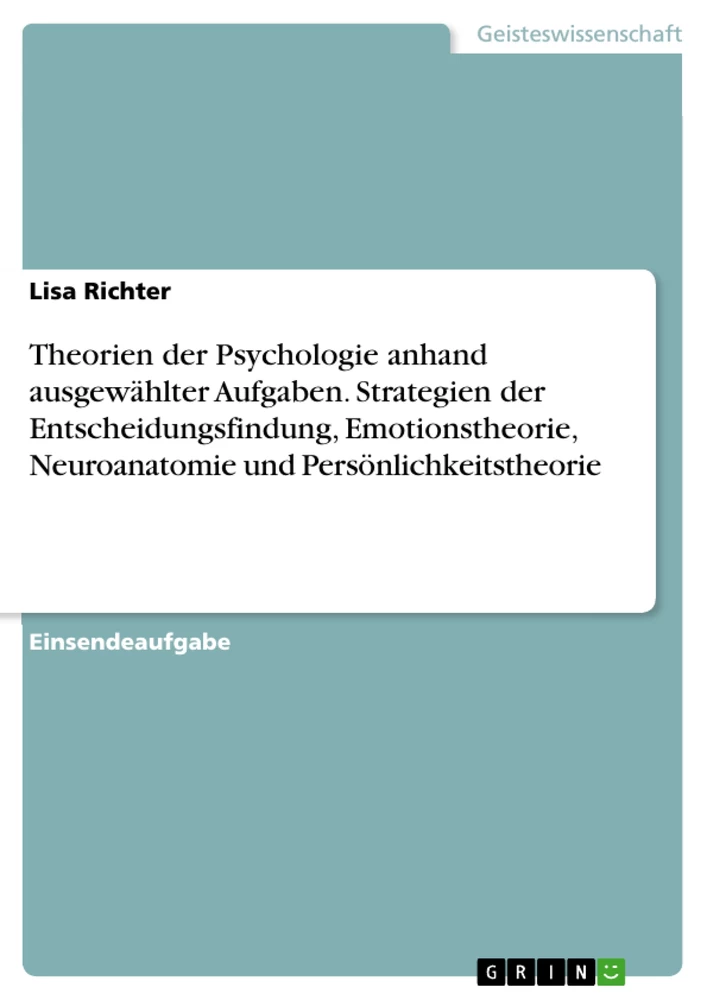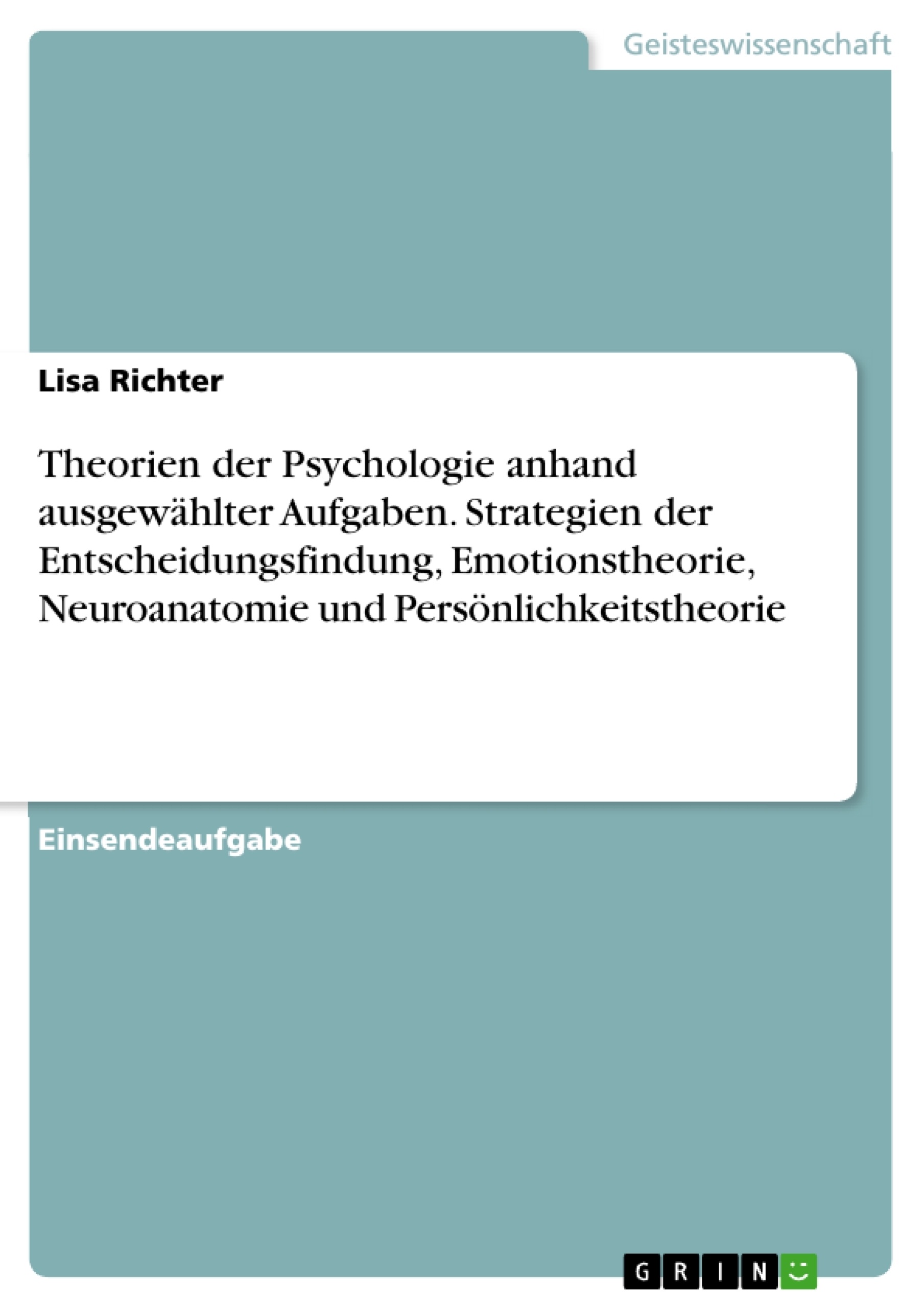Diese Arbeit beantwortet folgende Aufgaben:
1. Tina und Jan kaufen im Getränkemarkt Bier für ihre Party, können sich aber nicht über die Marke einigen. Erläutern Sie die jeweiligen Strategien der Entscheidungsfindung.
2. Ein Clown bringt nicht nur andere zum Lachen, sondern löst auch bei sich selbst positive Emotionen aus. Erläutern Sie dies anhand einer selbstgewählten Emotionstheorie.
3. Blinde kompensieren den fehlenden Sehsinn u.a. durch einen verbesserten Hörsinn. Erläutern Sie, in welchen Teilen des Gehirns deshalb neuroanatomische Veränderungen zu erwarten sind.
4. Erläutern Sie, warum es sinnvoll ist, bei Bewerbungen ein möglichst attraktives Foto mitzuschicken.
5. Erklären Sie vor dem Hintergrund einer Persönlichkeitstheorie, warum es sinnvoll ist, dass Jugendliche ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- Workbookaufgabe 1: Tina und Jan kaufen im Getränkemarkt Bier für ihre Party, können sich aber nicht über die Marke einigen. Erläutern Sie die jeweiligen Strategien der Entscheidungsfindung.
- Workbookaufgabe 2: Ein Clown bringt nicht nur andere zum Lachen, sondern löst auch bei sich selbst positive Emotionen aus. Erläutern Sie dies anhand einer selbstgewählten Emotionstheorie.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Workbookaufgabe befasst sich mit dem Entscheidungsverhalten von Menschen in Alltagssituationen und den emotionalen Prozessen, die bei einem Clown und seinem Publikum ablaufen.
- Entscheidungsfindung im Alltag
- Heuristiken und Intuition
- Verfügbarkeitsheuristik
- Ankerheuristik
- Emotionen und das limbische System
Zusammenfassung der Kapitel
Workbookaufgabe 1
Tina und Jan nutzen unterschiedliche Heuristiken, um sich für eine Biermarke zu entscheiden. Jan wendet die Verfügbarkeitsheuristik an, indem er sich von der Werbung beeinflussen lässt. Tina hingegen nutzt die Ankerheuristik und vertraut auf ihre Vorerfahrungen mit ihrer Lieblingssorte.
Workbookaufgabe 2
Die James-Lange-Theorie wird herangezogen, um zu erklären, wie ein Clown positive Emotionen bei sich selbst auslösen kann. Die Theorie besagt, dass Emotionen durch körperliche Reaktionen auf einen Reiz entstehen. Der Clown löst durch sein Lachen auch bei seinem Publikum Lachen aus, was wiederum positive Emotionen bei ihm selbst auslöst.
Schlüsselwörter
Entscheidungsfindung, Heuristiken, Verfügbarkeitsheuristik, Ankerheuristik, Emotionen, limbisches System, James-Lange-Theorie, Spiegelneuronen
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Verfügbarkeitsheuristik bei Entscheidungen?
Menschen schätzen die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen danach ein, wie leicht ihnen Beispiele dafür einfallen (z. B. durch Werbung beeinflusst).
Was besagt die James-Lange-Theorie der Emotionen?
Emotionen sind das Ergebnis körperlicher Reaktionen auf Reize. Man ist nicht traurig und weint deshalb, sondern man ist traurig, weil man weint.
Wie kompensiert das Gehirn den Verlust des Sehsinns?
Durch Neuroplastizität können Bereiche des Gehirns, die normalerweise für das Sehen zuständig sind, für die Verarbeitung auditiver oder taktiler Reize umstrukturiert werden.
Warum ist ein attraktives Bewerbungsfoto psychologisch vorteilhaft?
Aufgrund des Halo-Effekts: Attraktiven Menschen werden oft unbewusst auch andere positive Eigenschaften wie Kompetenz oder Zuverlässigkeit zugeschrieben.
Welche Rolle spielen Spiegelneuronen bei Emotionen?
Spiegelneuronen ermöglichen es uns, Emotionen anderer nachzuempfinden (Empathie), was z. B. erklärt, warum Lachen ansteckend wirkt.
- Citar trabajo
- Lisa Richter (Autor), 2020, Theorien der Psychologie anhand ausgewählter Aufgaben. Strategien der Entscheidungsfindung, Emotionstheorie, Neuroanatomie und Persönlichkeitstheorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1298199