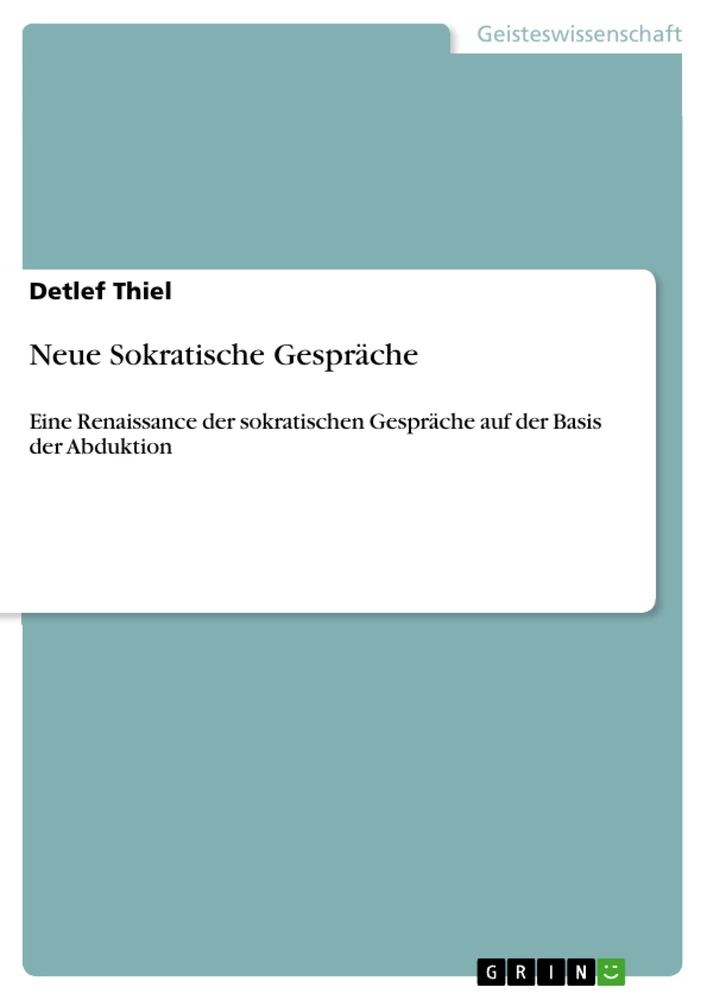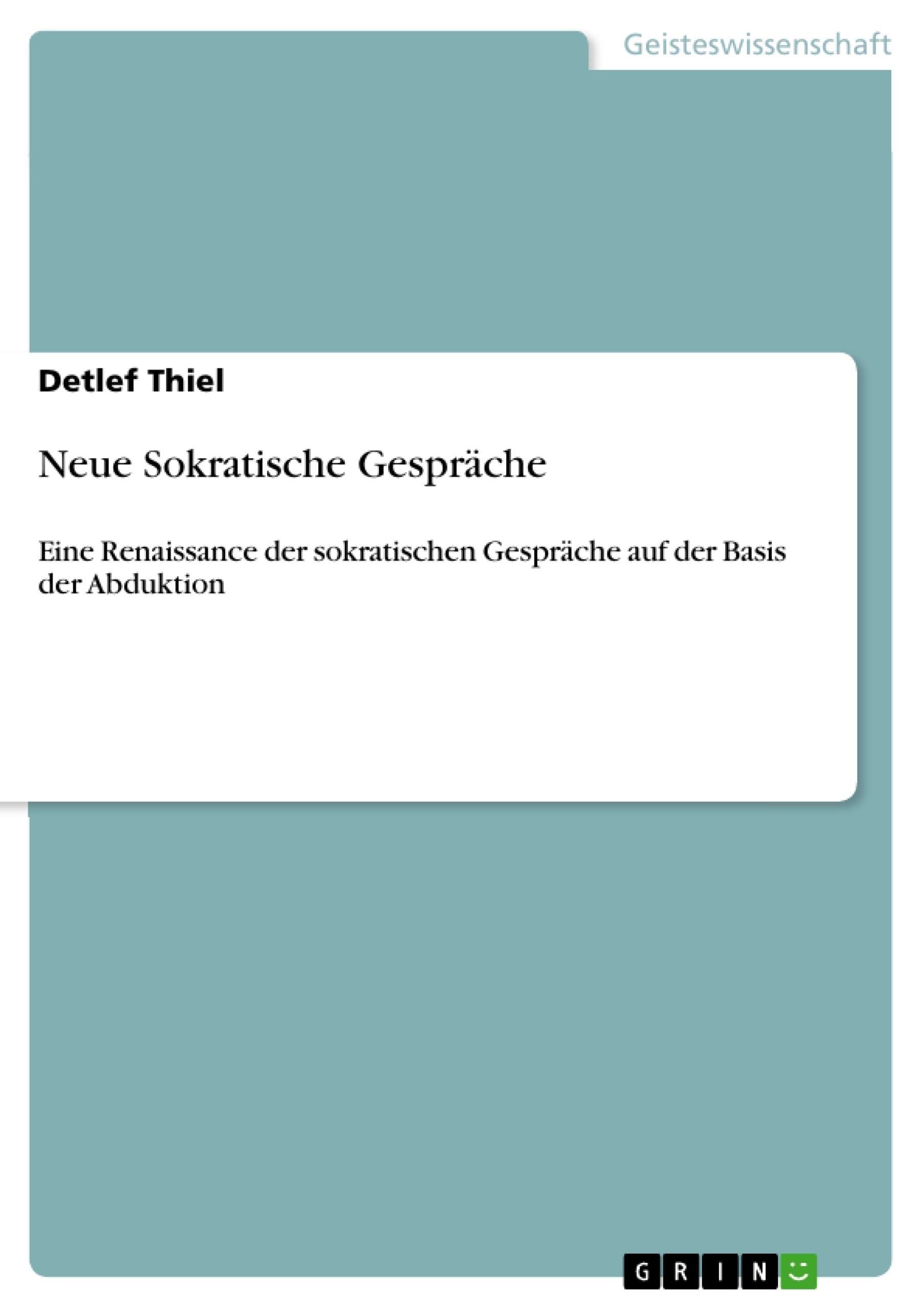Von Beginn an hatte die Philosophie ein Selbstverständnis ihrer selbst. Dieses Selbstverständnis war von Anfang an gekoppelt an eine Art Rückprojektion auf ihre Anfänge, wobei sich bereits in der Antike – also von Anfang an – zwei verschiedene Stoßrichtungen bezüglich der Ursprungsfrage der Philosophie ausmachen lassen: begann die Philosophie bei den Griechen oder gab es sie bereits davor?
Viele, unter ihnen auch Diogenes Laertius, lassen die Philosophie im Sinne einer reflexiven Wissenschaft nach dem Woher und Wohin des Menschen und des Kosmos bei den vorsokratischen Philosophen beginnen. Aber auch hier postuliert er zwei Anfänge der griechischen Philosophie oder zwei Stämme, wie man sagen könnte: einmal Pythagoras und dann Anaximander.
Letztlich folgte aber die abendländische Philosophiegeschichtsschreibung der Meinung des Aristoteles, der Thales von Milet zum Urvater der abendländischen Philosophie erhebt. Er habe als erster versucht, natürliche Dinge auf natürliche Weise ohne Rückgriff auf die Götterwelt und deren Mythen zu erklären; er habe als erster nach dem Ursprung allen Seins gefragt und damit gebühre ihm die Rolle des Urvaters aller Philosophie. Er war demnach der erste in der langen Reihe der Arché-Denker.
Wer war Sokrates und welcher Art waren seine Gespräche? Viele halten ihn für den Stammvater der abendländischen Philosophie, einen Kulturstifter Europas oder gar den Begründer der Philosophischen Praxis im Sinne eines Therapieansatzes jenseits und unabhängig von der nach-freudschen Psychologie im 20. und 21. Jahrhundert.
Bereits Cicero verbreitete die Meinung, Sokrates habe die Philosophie vom Himmel nach Athen, konkret auf den Marktplatz und das Gymnasium gebracht. In der Figur des Sokrates, so hat es den Anschein, koinzidieren noch Theorie und Praxis, während heutzutage Philosophie praxislose Elfenbeinturmwissenschaft zu werden droht. Dabei hielt sich Sokrates bekanntlich an das Gesetz Athens, obwohl er hätte fliehen können und es selten einen weniger berechtigten Prozess gegeben hat. Sokrates soll nichts geschrieben haben, was angesichts des Übergangs in eine Schriftkultur ca. 430 v. Chr. überraschen mag, aber nicht zugleich heißt, er hätte nicht lesen können. Woher wissen wir dann aber überhaupt von Sokrates?
Es kann nur mit diesem Übergang von der philosophischen Oralität zur Schriftlichkeit zusammenhängen und dass seine Schüler ihm ein schriftlich fixiertes Denkmal errichteten.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- I. TEIL
- SOKRATES: QUELLENLAGE UND LEHREN
- 1 Quellen und Lehren
- 1.1 Hinführung
- 1.2 Mündlichkeit und Schriftlichkeit bei Sokrates und Platon
- 1.3 Sokrates als letzter Vertreter einer primären Oralität
- 1.4 Sokratischer Auftrag
- 1.5 Die Vorsokratiker
- 1.6 Die Sophisten
- 1.7 Quellenlage
- 1.8 Die Apologie des Sokrates
- 2 Die Lehre von der Seelsorge
- 2.1 Die Seelenvorstellung des Sokrates
- 2.2 Seelsorge im Alkibiades
- 2.3 Moderne Vorstellungen über die sokratische Selbstsorge
- 2.4 Die Uminterpretation der sokratischen Selbstsorge durch Platon
- 2.5 Literarische Formen
- 2.6 Die Einheit aus Theorie und Praxis
- 2.7 Sokratisches Argumentieren
- 2.8 Die drei konstitutiven Elemente des sokratischen Gespräches
- 2.9 Die Funktion der Aporien in den Frühdialogen
- 3 Die Tugendlehre
- 3.1 Die Tugend an sich das Prinzip des Sokrates
- 3.2 Von der Tugendlehre zur Aretologie
- 3.3 Spielarten der Metaphysik - von den Vorsokratikern bis zu Plotin
- 3.4 Sokrates als Kulturstifter
- 3.5 Zwischenresümee
- II. TEIL
- LEONARD NELSONS NEO-SOKRATISCHE METHODE
- 1 Biographisches zu L. Nelson
- 1.1 Politische und Hochschulambitionen von L. Nelson
- 1.2 Nelsons Pädagogik
- 1.3 Nelsons sokratische Methode ein Vortrag
- 2 Nelsons Epistemologie
- 2.1 Nelsons epistemologisches Dilemma
- 2.2 Was versteht Nelson unter Regression?
- 2.3 Transzendentale Deduktion (Kant - Nelson)
- 2.4 Kritik an der Regression von Nelson
- 2.5
- 2.6 Von der Regression zum sokratischen Gespräch
- 3 Transformationen in der Philosophie
- 3.1 Die Genese der Wahrheitstheorien
- 3.2 Die Paradigmen der Philosophie
- 3.3 Kants Deduktion im Unterschied zu Nelsons Regression
- 3.4 Zwischenresümee II
- III. TEIL
- CHARLES SANDERS PIERCE UND DIE ABDUKTION
- 1 Von der Semiotik zur Logik
- 1.1 Die Zeichentheorie von Ch. S. Peirce
- 1.2 Vom Wahrnehmungsurteil bei Peirce zur Allgegenwart der Abduktion
- 1.3 Logisches Schließen
- 1.4 Ein Vergleich dreier Schlussformen
- 1.5 Umberto Eco über die Abduktion
- 1.6 Das Verhältnis zwischen Abduktion und dem Schluss auf die beste Erklärung (SBE)
- 1.7 Monolog vs. Dialog im Zuge der Abduktion
- 2 Aristoteles und die Abduktion
- 2.1 Aristoteles´ Entdeckung der Abduktion
- 2.2 Dialektische Gespräche
- 2.3 Merkmale der platonischen Dialogform als sokratische Gesprächsform
- 2.4 Die Apagoge von Aristoteles und die Abduktion von Peirce
- 2.5 Der Schluss auf die beste Erklärung und/oder Abduktion?
- 3 Abduktion und die sokratischen Dialoge
- 3.1 Hinführung
- 3.2 Von der Aporie zur Abduktion
- 3.3 Die abduktive Interpretation des Menon
- 3.4 Abduktion im Ion?
- 3.5 Fazit aus der Analyse der Dialoge Menon und Ion
- 3.6 Zwischenresümee III
- IV. TEIL
- DIE NEUEN SOKRATISCHEN GESPRÄCHE
- 1 Das deutsche Bildungssystem
- 1.1 Die Kompetenzorientierung im deutschen Schulsystem
- 1.2 Die Krise des deutschen Bildungssystems
- 1.3 Bildungsnotstand und Fachdidaktik
- 1.4 Das Lehrer-Schüler-Verhältnis
- 1.5 Was ist guter Unterricht?
- 1.6 Verstehen im Unterrichtsgeschehen
- 2 NSG Methodische Hinführung
- 2.1 NSG und Fachdidaktik(en)
- 2.2 Die Methodenschlange von Martens
- 2.3 Martens Interpretation des Laches
- 2.4 Der Kompetenzbegriff
- 2.5 Kompetenzorientierung in den neo-sokratischen Gesprächen
- 3 Das sokratische Gespräch
- 3.1 Forschungsstand
- 3.2 Methode, Dialog oder Gespräch?
- 3.3 Vergleich zwischen Nelson und Sokrates
- 3.4 Das neo-sokratische Gespräch im Philosophie- und Ethikunterricht
- 3.5 Weiterentwicklungen des neo-sokratischen Gesprächs
- 3.6 Das neo-sokratische Gespräch bei weiteren Neu-Sokratikern
- 4 Die praktische Umsetzung
- 4.1 Stundenplanung
- 4.2 Der Bibliolog als facilitator von Kreativität
- 4.3 Vom Bibliolog zum Sokratolog
- 4.4 Die Durchführung eines NSG
- 4.5 Kompetenzstärkung durch das NSG
- 4.6 Didaktische Grundpositionen vor dem Hintergrund der NSG
- 4.7 Die NSG und das hypothetische Denken
- 4.8 Die NSG als ein Beitrag zur Resonanzpädagogik
- 4.9 Zwischenresümee
Schlussbetrachtungen
Literaturliste
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Formelverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wer gilt als Urvater der abendländischen Philosophie?
Traditionell gilt Thales von Milet als Urvater, da er als Erster natürliche Phänomene ohne Rückgriff auf Mythen erklärte. Sokrates wird jedoch oft als der eigentliche Begründer der lebensnahen Philosophie angesehen.
Was ist die Sokratische Methode?
Die Sokratische Methode basiert auf dem dialogischen Hinterfragen von Scheinwissen, um durch Aporie (Ratlosigkeit) zu echter Erkenntnis und Selbstsorge zu gelangen.
Was versteht Leonard Nelson unter dem Neo-Sokratischen Gespräch?
Leonard Nelson entwickelte im 20. Jahrhundert eine Methode, bei der Gruppen durch gemeinsames Nachdenken über konkrete Erfahrungen zu allgemeinen philosophischen Wahrheiten gelangen (Regressionsmethode).
Was ist "Abduktion" nach Charles Sanders Peirce?
Abduktion ist eine Schlussform, die von einer überraschenden Beobachtung auf eine erklärende Hypothese schließt. Die Arbeit verknüpft dies mit der Art und Weise, wie in sokratischen Dialogen Argumente entwickelt werden.
Wie werden Neue Sokratische Gespräche (NSG) im Unterricht eingesetzt?
NSG dienen im Ethik- und Philosophieunterricht zur Stärkung der Urteilskompetenz, des kritischen Denkens und der Resonanzpädagogik zwischen Lehrern und Schülern.
Warum hat Sokrates selbst nichts geschrieben?
Sokrates bevorzugte die Oralität (Mündlichkeit), da er Philosophie als lebendigen Prozess verstand, der im direkten Gespräch und nicht in starren Texten stattfinden sollte.
- Citar trabajo
- Dr. Detlef Thiel (Autor), 2022, Neue Sokratische Gespräche, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1298404