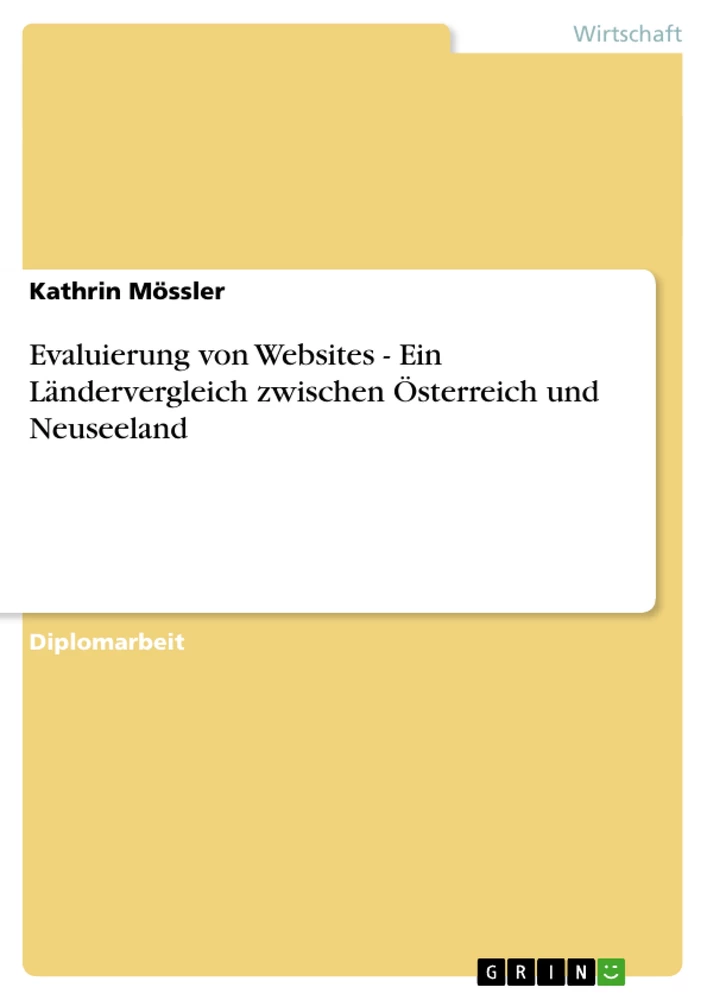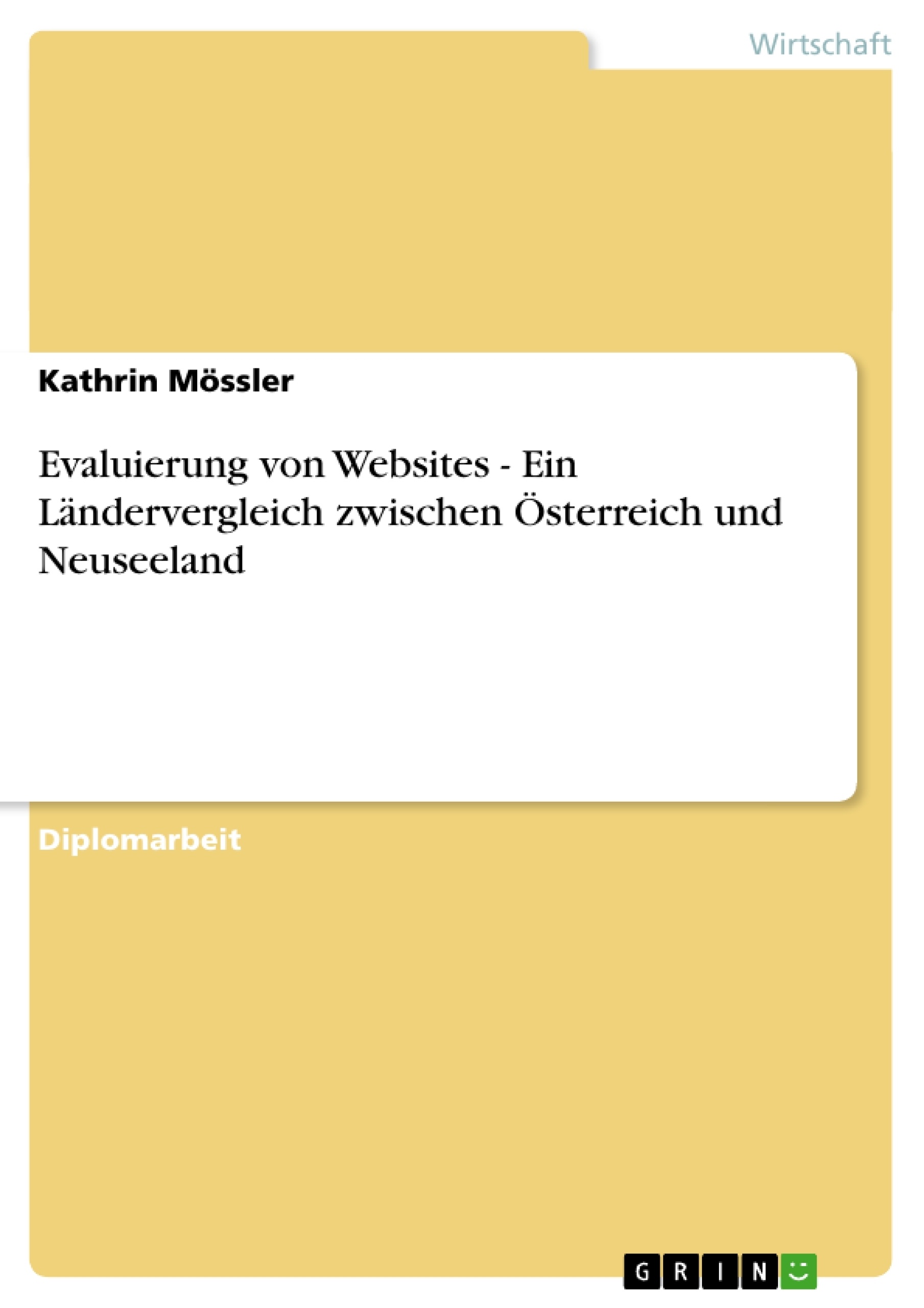Einleitung
Das Medium Internet hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen und hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem akzeptierten Massenmedium für digitale Informationen, Unterhaltung und Geschäftsaktivitäten entwickelt. Insbesondere bei letzterem wächst seine Bedeutung ständig. Es ist zu einem Instrument geworden, welches zusätzliche Kommunikations- und Interaktionswege mit potentiellen Kunden oder Geschäftspartnern erschließt. Link (1998) sieht im Internet die Chance, potentielle Kunden durch multisensorische Ansprache und Technikfaszination stärker zu beeindrucken, als durch andere Medien. Das Unternehmensimage könne sich verbessern "in Richtung Fortschrittlichkeit, Modernität, Kundennähe, Effektivität und Innovationsbereitschaft" (Link, 1998, S. 18). Auch Schneider und Rentmeister (1997) assoziieren mit der Internet-Präsenz von Unternehmen "Dynamik, Beherrschung der Technik, Offenheit und Kommunikationsfreudigkeit" (S. 53). Immer mehr neugegründete Unternehmen vermarkten ihre Produkte und Dienstleistungen ausschließlich über das Internet. Unternehmen mit einer langen Geschäftstradition, die dabei noch nicht mitmachen, sind gezwungen umzudenken.
Ein Unternehmen demonstriert seine Präsenz im Internet durch eine eigene Website. Die immer größer werdende Zahl an Unternehmen mit Web-Auftritt verstärkt massiv den Druck, nicht mehr nur im Web präsent zu sein, sondern diese Web-Präsenz auch optimal zu gestalten. Eine für Anwender leicht zu bedienende und qualitative Website, ist in der gegenwärtigen Geschäftswelt schon fast unabdingbar und trägt wesentlich zum Erfolg der Unternehmen bei. "Nur bequeme, bedienbare und daher vertrauenswürdige Sites werden auch Benutzer haben und damit erfolgreich sein" (Web Usability, 2001). Unternehmen sind daher sehr daran interessiert, dass die Website-Besucher auch in Zukunft die Site weiterbesuchen werden, oder gar Online-Bestellungen durchführen.
Bei der Websitegestaltung werden zahlreiche Entscheidungen getroffen, die für die anwenderseitige Nutzung relevant sind. Aus diesem Grund ist es notwendig, diese Entscheidungen mit Hilfe von Messinstrumenten zu validieren. Über 90 Prozent der professionellen Websiteentwickler führen daher eine Evaluierung der Websites durch (Manhartsberger und Musil, 2002). Informelle Befragungen von Kollegen werden dabei am häufigsten benutzt. Usability-Inspection-Methoden, bei denen andere Experten zu Rate gezogen werden, kommen ebenfalls zahlreich in der Praxis vor.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Ziel der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- KONZEPTIONELLER BEZUGSRAHMEN
- Methoden zur Beurteilung von Websites
- Ziele der Bewertung von Websites
- Formale (modellbasierte) Bewertungsverfahren
- Kriterienorientierte (heuristische) Bewertungsverfahren
- Experimentelle (empirische) Bewertungsverfahren
- Papier-Prototypen und Storyboard Techniken
- Evaluierung mit lauffähigen Prototypen
- Partizipatorische Evaluierung
- Benutzung von Logging-Werkzeugen
- Fazit
- B2B Websites vs. B2C Websites
- Die Begriffe Old Economy und New Economy
- Wirtschaftsstruktur, E-Business und Web-Präsenz in Österreich und Neuseeland
- Die Situation in Österreich
- Die Wirtschaftsstruktur Österreichs
- E-Business und Web-Präsenz in Österreich
- Die Situation in Neuseeland
- Die Wirtschaftsstruktur Neuseelands
- E-Business und Web-Präsenz in Neuseeland
- Fazit
- Die Situation in Österreich
- Interkulturelle Marktforschung
- Besonderheiten und Probleme der (vergleichenden) interkulturellen Marktforschung
- Voraussetzungen für interkulturelle Vergleiche in der Marktforschung
- Anforderungen an internationale Marktforschungsinformationen
- Äquivalenzbedingungen der interkulturellen Marktforschung
- Erste Ebene: Phase der Problemdefinition (problem definition)
- Zweite Ebene: Phase der Datenerhebung (data collection)
- Dritte Ebene: Phase der Datenaufbereitung (data preparation)
- Fazit
- Elemente des Web-Empowerment-Scales und Entwicklung eines Messinstruments zur Bewertung von Websites
- Methoden zur Beurteilung von Websites
- HYPOTHESEN
- METHODE DER FORSCHUNG
- Ziel der empirischen Forschung und Vorgangsweise
- Forschungsinstrument
- Die im Forschungsinstrument enthaltenen Faktoren
- Verwendete Skala
- Stichprobe und Bewertung
- Multivariate Analysemethoden
- EXPLORATIVE FAKTORENANALYSE
- Die Faktorenanalyse im Rahmen dieser Arbeit
- Ziel der Faktorenanalyse
- Ergebnisse der Faktorenanalyse
- Formalitäten der Transaktion bis Zugang
- Interpretation der Faktoren
- Online-Bestellung
- Interpretation der Faktoren
- Akademische Recherchen
- Interpretation der Faktoren
- Formalitäten der Transaktion bis Zugang
- Zusammenfassung der Faktorenanalyse und Fazit
- Die Faktorenanalyse im Rahmen dieser Arbeit
- EMPIRISCHE PRÜFUNG DER HYPOTHESEN
- Ergebnisse der Analyse
- Hypothese 1
- Hypothese 2a
- Hypothese 2b
- Hypothese 3
- Hypothese 4a
- Hypothese 4b
- Hypothese 5a
- Hypothese 5b
- Hypothese 6
- Hypothese 7
- Hypothese 8
- Hypothese 9a
- Hypothese 9b
- Hypothese 10
- Hypothese 11a
- Hypothese 11b
- Hypothese 11c.
- Fazit
- Ergebnisse der Analyse
- ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
- Zusammenfassung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Evaluierung von Websites im Vergleich zwischen Österreich und Neuseeland. Ziel ist es, ein Messinstrument zur Bewertung von Websites zu entwickeln und empirisch zu überprüfen, ob es Unterschiede in der Web-Empowerment-Bewertung zwischen den beiden Ländern gibt.
- Methoden der Website-Evaluierung
- Interkulturelle Marktforschung und ihre Herausforderungen
- Entwicklung eines Messinstruments zur Bewertung von Websites
- Empirische Überprüfung von Hypothesen zum Web-Empowerment
- Ländervergleich zwischen Österreich und Neuseeland
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Website-Evaluierung ein und beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Kapitel zwei bietet einen konzeptionellen Bezugsrahmen, indem es Methoden zur Website-Bewertung, B2B und B2C Websites, die Begriffe Old Economy und New Economy sowie die wirtschaftliche Situation in Österreich und Neuseeland beleuchtet. Im dritten Kapitel werden Hypothesen aufgestellt, die im vierten Kapitel mit einer empirischen Methode untersucht werden. Kapitel fünf befasst sich mit der explorativen Faktorenanalyse, während Kapitel sechs die empirischen Ergebnisse der Hypothesenprüfung präsentiert. Das siebte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten.
Schlüsselwörter
Website-Evaluierung, Interkulturelle Marktforschung, Web-Empowerment, Messinstrument, Österreich, Neuseeland, E-Business, Faktorenanalyse, Hypothesenprüfung.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Websites professionell evaluiert?
Es gibt formale (modellbasierte), kriterienorientierte (heuristische) und experimentelle (empirische) Verfahren, wie Usability-Tests mit Prototypen oder Logging-Werkzeugen.
Was unterscheidet Website-Nutzung in Österreich und Neuseeland?
Die Arbeit untersucht im Ländervergleich, ob kulturelle Unterschiede die Bewertung von Web-Empowerment, Transaktionsformalitäten und die Akzeptanz von E-Business beeinflussen.
Was ist interkulturelle Marktforschung?
Sie befasst sich mit den Besonderheiten und Äquivalenzbedingungen (Problemdefinition, Datenerhebung, Datenaufbereitung) beim Vergleich von Konsumentenverhalten in verschiedenen Kulturen.
Warum ist Web Usability für Unternehmen so wichtig?
Nur bedienbare und vertrauenswürdige Seiten binden Nutzer langfristig. Eine schlechte Usability führt zum Abbruch von Bestellvorgängen und schadet dem Unternehmensimage.
Was misst die explorative Faktorenanalyse in dieser Studie?
Sie identifiziert zentrale Faktoren wie Transaktionsformalitäten, Online-Bestellprozesse und akademische Recherchen, um die Qualität der Web-Präsenz messbar zu machen.
- Citation du texte
- Kathrin Mössler (Auteur), 2003, Evaluierung von Websites - Ein Ländervergleich zwischen Österreich und Neuseeland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12995