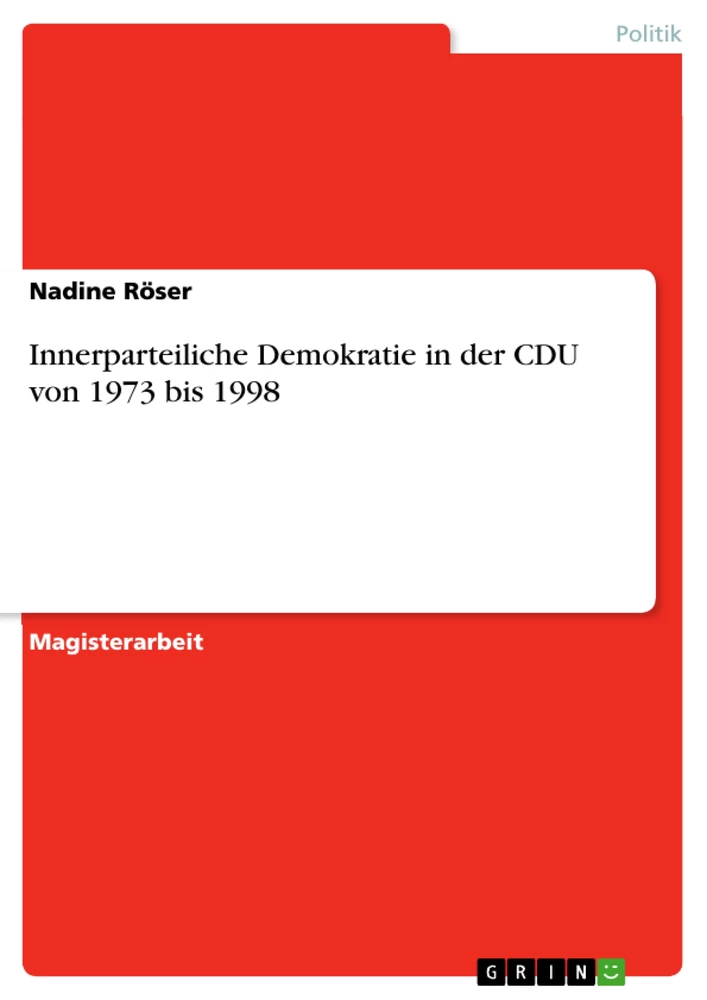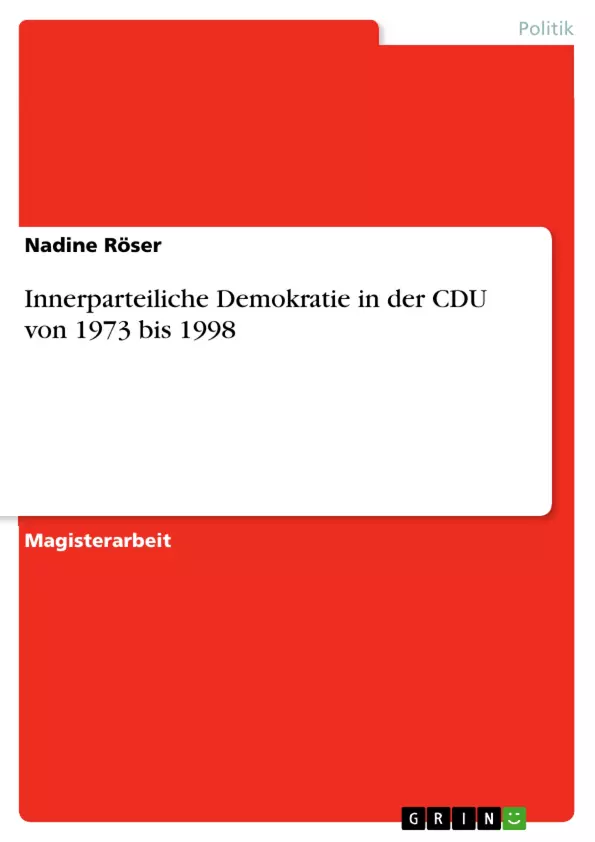Thema und Fragestellung
Die CDU-Spendenaffäre nahm am vierten November 1999 mit dem Haftbefehl gegen den früheren CDU-Schatzmeister Walther Leisler Kiep ihren Anfang und erreichte am sechzehnten Dezember 1999 ihren vorläufigen Höhepunkt. In der ZDF-Sendung >Was nun, Herr Kohl?<
räumte der Ex-Bundeskanzler ein, im Zeitraum von 1993 bis 1998 bis zu zwei Millionen Mark an Spenden in bar angenommen zu haben. Diese Gelder sind außerhalb der Buchführung verwendet worden. Kohl weigert sich bis zum heutigen Zeitpunkt, die Namen der Geldergeber zu
nennen, da diese ihn darum gebeten hätten, nicht in einer Spenderliste aufzutauchen.
Die Affäre führte die CDU in eine neue Krise und deckte gleichzeitig eine alte, seit Jahren schwelende auf. Die neue Krise war die Finanzkrise, in welche die Partei durch die Spendenaffäre
gestürzt wurde. Die alte Krise basiert auf der strukturellen Veränderung der innerparteilichen Organisationskultur. Für Pflüger geht es dabei um „...das Herrschaftssystem Helmut Kohls, den Verlust an innerparteilicher Demokratie, in dessen Folge die Union Kompetenzen und Kreativität verlor und schließlich zur Oppositionspartei wurde. Das in 25 Jahren als Parteivorsitzender und 16 Jahren als Kanzler aufgebaute Netzwerk von persönlichen
Loyalitäten in der Wirtschaft, den Medien, den Bundesländern und vor allem in der Partei – das >System Kohl< - hielt dem Kanzler den Rücken frei, schuf Spielräume für seine Europa- und außenpolitischen Erfolge.“(1)
In bezug auf die vorliegende Arbeit ist besonders der erste Teil des Zitats von Interesse. Gegenstand der Untersuchung ist die Analyse der innerparteilichen Demokratie in der CDU im Zeitraum von 1973 bis 1998. In Art. 21, Abs. 1 des Grundgesetzes wird festgelegt, dass die
innere Ordnung der Parteien demokratischen Grundsätzen entsprechen muss. Diese Forderung wird mit der verfassungsmäßigen Aufgabe der Parteien, der Mitwirkung bei der politischen Willensbildung des Volkes, begründet (Art. 21, Abs. 1). Schon Art. 20 des Grundgesetzes
impliziert die demokratische Verfassung der politischen Parteien. Dort wird die Bundesrepublik Deutschland als ein demokratischer und sozialer Bundesstaat ausgewiesen, in dem alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Die demokratisch bestimmte Willensbildung des Volkes
würde an einem Widerspruch leiden, wenn sie im Innern der Partei keine Entsprechung fände.
[...]
______
1 Pflüger 2000, S. 10f.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thema und Fragestellung
- Aufbau der Darstellung, Einordnung der Materialien
- Demokratietheoretische Modelle
- Das Konkurrenz, Transmissions- und Integrationsparadigma
- Das Organisationsprinzip der deutschen Parteien
- Zusammenfassung
- Organisationsmodelle
- Parteien als homogene Gebilde mit zentraler Steuerung
- Parteien als heterogene Gebilde mit dezentraler Steuerung
- Parteienorganisationstypen
- Zusammenfassung
- Die Bundesparteitage
- Repräsentationsfunktionen der Bundesparteitage
- Willensbildungs- und Werbefunktionen der Bundesparteitage
- Änderungsanträge der Parteigliederungen
- Die Grundsatzprogramme der CDU
- Wortmeldungen und Redezeit der Delegierten
- Diskussionskultur auf Parteitagen
- Zusammenfassung
- Die Parteiführungsgremien (Bundesvorstand und Präsidium)
- Sitzungshäufigkeit der Parteiführungsgremien
- Aufgaben der Parteiführungsgremien
- Der Sitzungsablauf des Präsidiums
- Die personelle Zusammensetzung des Präsidiums
- Zusammenfassung
- Die Bundesgeschäftstelle
- Die Reorganisation der Bundesgeschäftsstelle
- Die Folgen der Modernisierung für die Organisationsform der CDU
- Die Bundesgeschäftsstelle als Initiator der Programmdiskussion
- Die Generalsekretäre der CDU
- Zusammenfassung
- Das „System Kohl“
- Die Ämtervergabe im „System Kohl“
- Willensbildung und Entscheidungsfindung im „System Kohl“
- Das Verhältnis Kohls zur Basis
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die innerparteiliche Demokratie in der CDU im Zeitraum von 1973 bis 1998. Sie analysiert, inwieweit die Bundesparteitage und die Parteiführungsgremien ihren statutarischen Aufgaben nachkommen konnten und untersucht, wie sich das „System Kohl“ auf die innerparteiliche Demokratie ausgewirkt hat.
- Analyse der innerparteilichen Demokratie in der CDU
- Untersuchung der Rolle der Bundesparteitage und der Parteiführungsgremien
- Bewertung des Einflusses von Helmut Kohl auf die innerparteiliche Willensbildung
- Beurteilung des Verhältnisses zwischen Parteibasis und Parteiführung
- Bewertung des „System Kohl“ im Hinblick auf die innerparteiliche Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema und die Fragestellung der Arbeit vor, erläutert den Aufbau der Darstellung und ordnet die Materialien ein. Kapitel 2 behandelt die demokratietheoretischen Modelle, die zur Analyse der innerparteilichen Demokratie in der CDU herangezogen werden. Kapitel 3 befasst sich mit den Organisationsmodellen von Parteien, insbesondere mit der Frage, ob Parteien als homogene oder heterogene Gebilde mit zentraler oder dezentraler Steuerung funktionieren.
Kapitel 4 widmet sich den Bundesparteitagen und analysiert deren Repräsentations-, Willensbildungs- und Werbefunktionen. Dabei werden die Änderungsanträge der Parteigliederungen, die Grundsatzprogramme der CDU, die Wortmeldungen und Redezeiten der Delegierten sowie die Diskussionskultur auf Parteitagen untersucht.
Kapitel 5 befasst sich mit den Parteiführungsgremien, dem Bundesvorstand und dem Präsidium. Hier werden die Sitzungshäufigkeit der Gremien, ihre Aufgaben, der Sitzungsablauf des Präsidiums sowie die personelle Zusammensetzung des Präsidiums betrachtet.
Kapitel 6 untersucht die Bundesgeschäftstelle und analysiert die Reorganisation der Bundesgeschäftsstelle, die Folgen der Modernisierung für die Organisationsform der CDU sowie die Rolle der Bundesgeschäftsstelle als Initiator der Programmdiskussion.
Kapitel 7 befasst sich mit dem „System Kohl“ und analysiert die Ämtervergabe, die Willensbildung und Entscheidungsfindung im „System Kohl“ sowie das Verhältnis Kohls zur Basis.
Schlüsselwörter
Innerparteiliche Demokratie, CDU, Helmut Kohl, Bundesparteitage, Parteiführungsgremien, Bundesgeschäftsstelle, „System Kohl“, Organisationsform, Willensbildung, Entscheidungsfindung, Parteibasis, Parteiführung, Repräsentationsfunktionen, Werbefunktionen.
Häufig gestellte Fragen
Was war das "System Kohl" in der CDU?
Es beschreibt ein Netzwerk persönlicher Loyalitäten und eine Machtstruktur, die Helmut Kohl über 25 Jahre als Parteivorsitzender aufgebaut hat.
Wie wirkte sich die Spendenaffäre auf die innerparteiliche Demokratie aus?
Die Affäre deckte den Verlust an demokratischen Prozessen und die Umgehung von Kontrollgremien zugunsten einer zentral gesteuerten Parteiführung auf.
Welche Funktion haben Bundesparteitage laut Satzung?
Sie dienen der politischen Willensbildung der Basis, der Programmentwicklung und der demokratischen Wahl der Parteiführung.
Was ist der Unterschied zwischen homogener und heterogener Parteisteuerung?
Homogene Steuerung ist zentralistisch und von oben herab; heterogene Steuerung lässt mehr Raum für dezentrale Einflüsse und innerparteilichen Pluralismus.
Welche Rolle spielte die Bundesgeschäftsstelle unter Kohl?
Sie wurde modernisiert und diente oft als Initiator für Programmdiskussionen, die die Position der Parteiführung stützten.
- Quote paper
- Nadine Röser (Author), 2001, Innerparteiliche Demokratie in der CDU von 1973 bis 1998, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1299