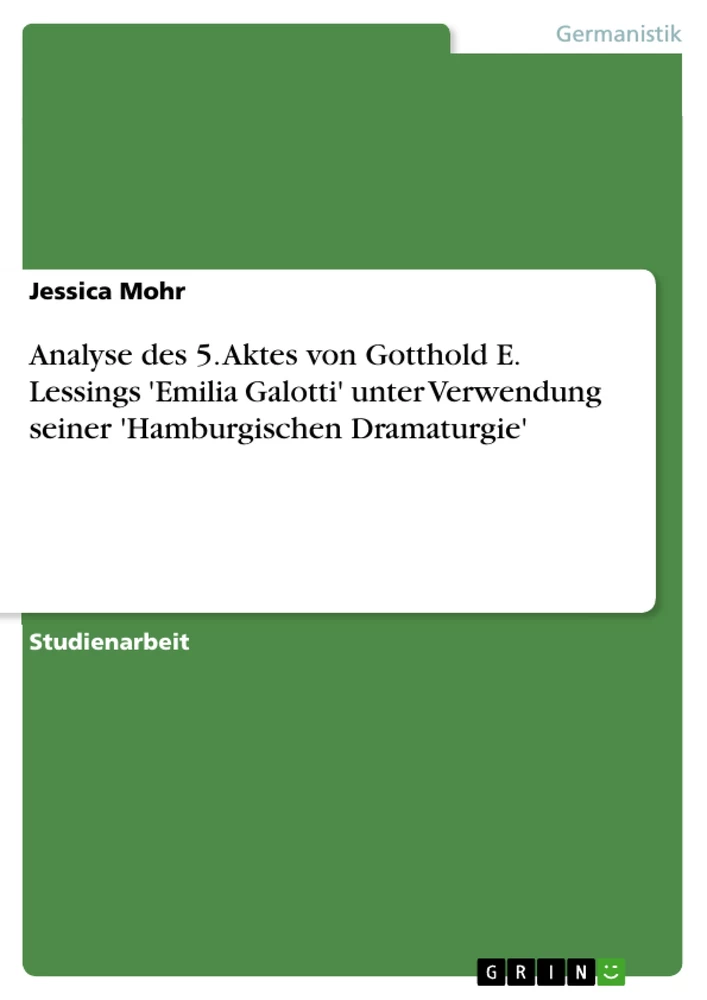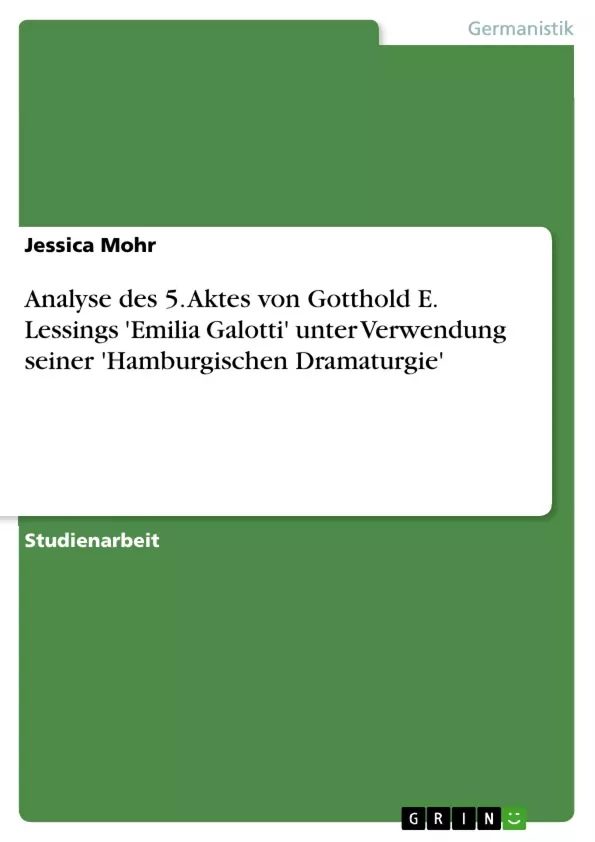Zweifelsfrei zählt die Tragödie „Emilia Galotti“ zu den bekanntesten Werken des Theaterdichters und Dramaturgen Gotthold E. Lessing. Sie ist nicht nur ein Musterbeispiel des deutschen bürgerlichen Trauerspiels, welches Lessing mitbegründet hat, sondern steht auch in der Tradition der aristotelischen Poetik, da Lessing sein Stückes stark nach den Vorgaben des griechischen Philosophen konzipiert. Dies ist vor allem in seiner dramentheoretischen Schrift der „Hamburgischen Dramaturgie“ zu sehen, in der der Dichter ausführlich die „Poetik des Aristoteles“ und ihren ästhetischen Wirkungszusammenhang analysiert.
Im ersten Teil meiner Arbeit werde ich zunächst auf die „Hamburgische Dramaturgie“ eingehen und einen Überblick über die, von Lessing verfolgten, Intentionen und Ziele geben. Dabei beschränke ich mich auf die Interpretation der Katharsis, die Wirkung auf den Zuschauer und die Gestaltung der Handlungsträger, die nach Lessing gemischten Charakteren entsprechen müssen. Ein Behandeln aller in der „Hamburgischen Dramaturgie“ erwähnten Voraussetzungen für die Tragödie, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Der zweite Teil befasst sich dann mit der Umsetzung der oben erwähnten Termini in Lessings „Emilia Galotti“. Hierbei wird vor allem der fünfte Akt als Interpretationsgrundlage herangezogen. Ziel dieser Ausarbeitung soll die Klärung der Frage sein, ob Lessings bürgerliches Trauerspiel tatsächlich gänzlich auf den Voraussetzungen der „Hamburgischen Dramaturgie“ beruht oder doch von diesen abweicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die,,Hamburgische Dramaturgie"
- Lessings Wirken am Hamburger Nationaltheater
- Allgemeine Prinzipien und Ziele der „Hamburgischen Dramaturgie"
- Von der Katharsis des Aristoteles zu Lessings gemischten Charakteren
- Analyse des 5. Aktes der „Emilia Galotti"
- Gemischte Charaktere
- Die Umsetzung der Katharsis
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den fünften Akt von Gotthold E. Lessings „Emilia Galotti“ im Kontext seiner „Hamburgischen Dramaturgie“. Ziel ist es, die Umsetzung der in der Dramaturgie dargelegten Prinzipien, insbesondere der Katharsis und der gemischten Charaktere, in Lessings Tragödie zu untersuchen. Die Arbeit beleuchtet, ob Lessings bürgerliches Trauerspiel den Vorgaben der „Hamburgischen Dramaturgie“ entspricht oder davon abweicht.
- Die „Hamburgische Dramaturgie“ als dramentheoretische Schrift Lessings
- Die Katharsis als Reinigung der Affekte durch Mitleid und Furcht
- Die Gestaltung von gemischten Charakteren in der Tragödie
- Die Umsetzung der Katharsis und der gemischten Charaktere im fünften Akt der „Emilia Galotti“
- Die Frage nach der Übereinstimmung von Lessings Tragödie mit den Prinzipien der „Hamburgischen Dramaturgie“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Tragödie „Emilia Galotti“ als ein Musterbeispiel des deutschen bürgerlichen Trauerspiels vor. Sie erläutert Lessings Bezug zur aristotelischen Poetik und die Bedeutung der „Hamburgischen Dramaturgie“ für die Analyse des Stückes.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der „Hamburgischen Dramaturgie“ und beleuchtet Lessings Wirken am Hamburger Nationaltheater. Es beschreibt die Intentionen und Ziele der Dramaturgie, insbesondere die Bedeutung der Katharsis und der gemischten Charaktere für die Wirkung des Trauerspiels auf den Zuschauer.
Das dritte Kapitel analysiert den fünften Akt der „Emilia Galotti“ im Hinblick auf die Umsetzung der in der „Hamburgischen Dramaturgie“ dargelegten Prinzipien. Es untersucht die Gestaltung der Charaktere und die Erzeugung von Mitleid und Furcht beim Zuschauer.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die „Hamburgische Dramaturgie“, Gotthold E. Lessing, „Emilia Galotti“, bürgerliches Trauerspiel, Katharsis, Mitleid, Furcht, gemischte Charaktere, Dramentheorie, Tragödie, Theater, Literaturkritik.
Häufig gestellte Fragen
Wie setzt Lessing die "Hamburgische Dramaturgie" in "Emilia Galotti" um?
Die Arbeit analysiert, ob der 5. Akt von Emilia Galotti den theoretischen Forderungen Lessings nach Katharsis und gemischten Charakteren entspricht.
Was versteht Lessing unter "gemischten Charakteren"?
Charaktere dürfen weder vollkommen gut noch vollkommen böse sein, damit der Zuschauer Mitleid empfinden kann; sie müssen menschliche Schwächen zeigen.
Was bedeutet Katharsis bei Lessing?
Im Gegensatz zur rein aristotelischen Sicht interpretiert Lessing Katharsis als die Verwandlung von Leidenschaften in tugendhafte Fertigkeiten durch Mitleid und Furcht.
Ist "Emilia Galotti" ein typisches bürgerliches Trauerspiel?
Ja, es thematisiert den Konflikt zwischen dem Adel (Prinz) und der bürgerlichen Moral (Odoardo/Emilia) und bricht mit der Ständeklausel der klassischen Tragödie.
Warum ist der 5. Akt für die Analyse so entscheidend?
Im 5. Akt kulminiert die Traghandlung in Emilias Tod durch die Hand ihres Vaters, was die Konzepte von Mitleid, Furcht und Charakterzeichnung auf die Probe stellt.
- Citar trabajo
- Jessica Mohr (Autor), 2007, Analyse des 5. Aktes von Gotthold E. Lessings 'Emilia Galotti' unter Verwendung seiner 'Hamburgischen Dramaturgie', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130105