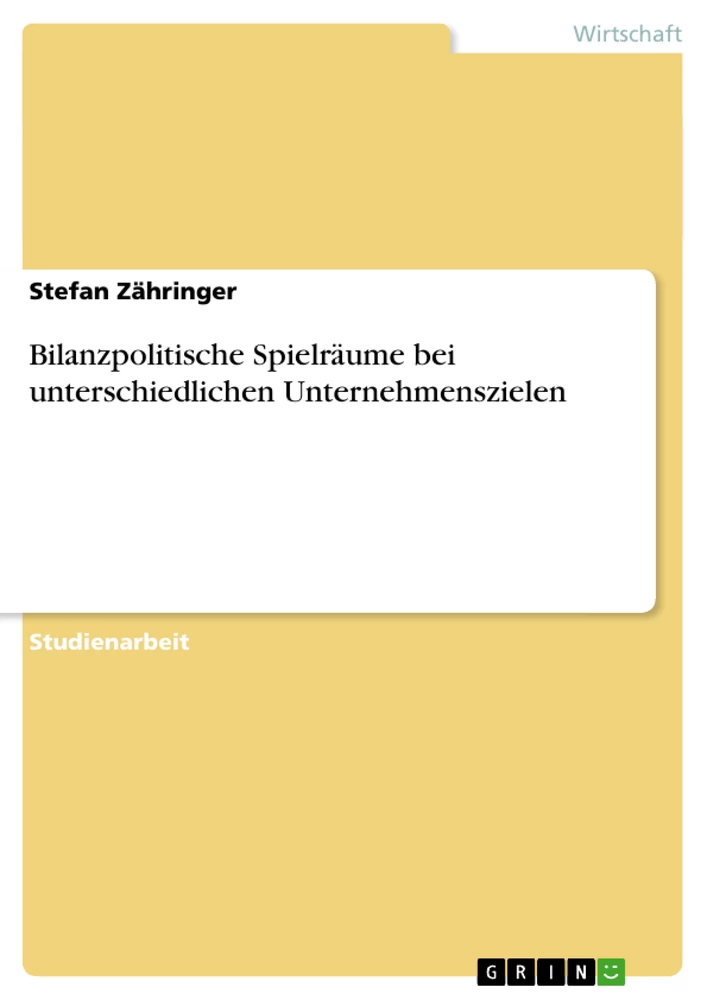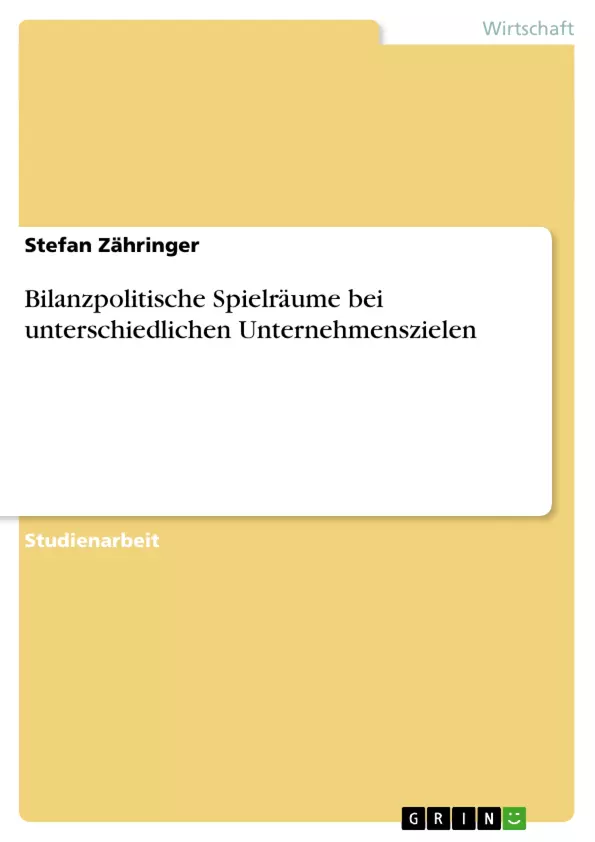Mit dem Jahresabschluss soll die Lage von Unternehmen dargestellt werden. Hierfür bestimmen die Rechnungslegungsvorschriften zwar die Grundstruktur, sind aber in der praktischen Umsetzung in vielerlei Hinsicht gestaltungsfähig. Die Vorschriften können zum
einen nicht alle wirtschaftlichen Sachverhalte konkret regeln, zum anderen enthalten die gesetzlichen Vorgaben auch bewusst Wahlrechte. Auch durch subjektive Einschätzungen, die an vielen Stellen aufgrund einer ungewissen Zukunft erforderlich sind, und durch eine freie Wahl bei der Gestaltung der wirtschaftlichen Sachverhalte, bereits vor dem Bilanzstichtag, werden den Unternehmen Handlungsspielräume bei der Bilanzierung geboten. Dies bewirkt, dass die Rechnungslegung in nicht unerheblichem Umfang von den Unternehmen selbst gestaltet werden kann.
- Quote paper
- Dipl.-Ing. Stefan Zähringer (Author), 2009, Bilanzpolitische Spielräume bei unterschiedlichen Unternehmenszielen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130116