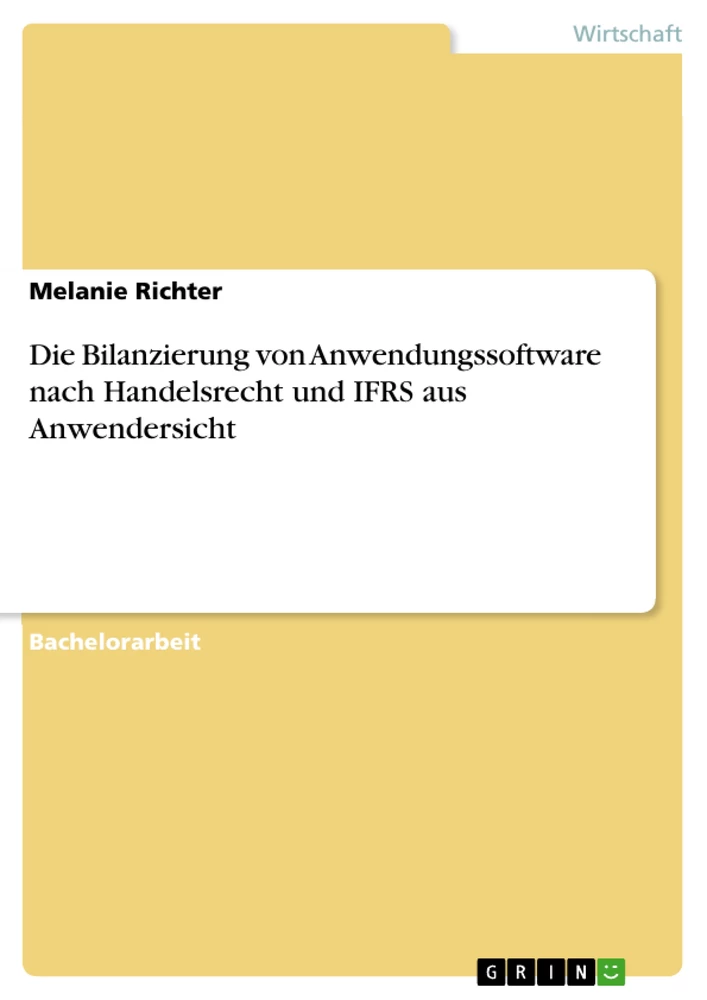Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der bilanziellen Behandlung von Anwendungssoftware sowohl nach nationalem als auch nach internationalem Recht. Hierbei ergibt sich eine Reihe von spezifischen Problembereichen, deren Herangehensweise nach nationalem und internationalem Recht teilweise sehr unterschiedlich ausfallen kann.
Zunächst werden die zur bilanziellen Behandlung von Anwendungssoftware notwendigen Begriffsabgrenzungen sowie eine Klassifizierung der einzelnen Arten von Anwendungssoftware in technischer und bilanzieller Hinsicht vorgenommen. Anschließend erfolgt die Betrachtung der bilanziellen Behandlung nach deutschem Handelsrecht sowie nach internationalen Rechnungslegungsstandards. Darauf aufbauend werden die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Bilanzierung von Anwendungssoftware nach HGB und IFRS verglichen und außerdem die möglichen bilanzpolitischen Spielräume aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Begriffsabgrenzung
- 2.2 Klassifizierung von Anwendungssoftware
- 2.2.1 Standardsoftware
- 2.2.2 Individualsoftware
- 2.2.3 ERP-Software
- 2.3 Bilanzielle Einordung
- 3 Bilanzierung von Anwendungssoftware nach Handelsrecht
- 3.1 Ansatzkriterien
- 3.1.1 Abstrakte Aktivierungsfähigkeit
- 3.1.2 Konkrete Aktivierungsfähigkeit
- 3.2 Bewertungskriterien
- 3.2.1 Zugangsbewertung
- 3.2.2 Folgebewertung
- 3.3 Ausweis und Anhangangaben
- 3.1 Ansatzkriterien
- 4 Bilanzierung von Anwendungssoftware nach IFRS
- 4.1 Ansatzkriterien
- 4.1.1 Abstrakte Aktivierungsfähigkeit
- 4.1.2 Konkrete Aktivierungsfähigkeit
- 4.2 Bewertungskriterien
- 4.2.1 Zugangsbewertung
- 4.2.2 Folgebewertung
- 4.3 Ausweis und Anhangangaben
- 4.1 Ansatzkriterien
- 5 Vergleich der Bilanzierung von Anwendungssoftware nach Handelsrecht und IFRS
- 5.1 Vergleich der Bilanzierung von Anwendungssoftware
- 5.2 Vergleich der bilanzpolitischen Spielräume
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bilanzierung von Anwendungssoftware nach Handelsrecht und IFRS aus Anwendersicht. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Bilanzierungsmethoden aufzuzeigen und die jeweiligen bilanzpolitischen Spielräume zu analysieren.
- Begriffsabgrenzung und Klassifizierung von Anwendungssoftware
- Ansatzkriterien für Anwendungssoftware nach Handelsrecht und IFRS
- Bewertungskriterien für Anwendungssoftware nach Handelsrecht und IFRS
- Vergleich der Bilanzierung nach Handelsrecht und IFRS
- Analyse der bilanzpolitischen Spielräume
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Bilanzierung von Anwendungssoftware ein und beschreibt den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie begründet die Relevanz des Themas im Kontext der modernen Unternehmensführung und der zunehmenden Bedeutung von IT-Systemen.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel legt die notwendigen Grundlagen für das Verständnis der folgenden Kapitel. Es beinhaltet eine klare Begriffsabgrenzung von Anwendungssoftware, eine detaillierte Klassifizierung (Standardsoftware, Individualsoftware, ERP-Software) und eine Erläuterung der bilanzrechtlichen Einordnung von Software.
3 Bilanzierung von Anwendungssoftware nach Handelsrecht: Das Kapitel behandelt ausführlich die Bilanzierung von Anwendungssoftware gemäß Handelsgesetzbuch (HGB). Es erläutert die Ansatzkriterien (abstrakte und konkrete Aktivierungsfähigkeit), die Bewertungskriterien (Zugangs- und Folgebewertung) und die notwendigen Ausweis- und Anhangangaben. Die Diskussion beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der praktischen Anwendung des HGB in diesem Kontext.
4 Bilanzierung von Anwendungssoftware nach IFRS: Ähnlich wie Kapitel 3, konzentriert sich dieses Kapitel auf die Bilanzierung von Anwendungssoftware nach den International Financial Reporting Standards (IFRS). Es analysiert die Ansatz- und Bewertungskriterien unter IFRS und vergleicht diese mit den Vorgaben des HGB. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten beider Regelwerke und den daraus resultierenden Konsequenzen für die Praxis.
5 Vergleich der Bilanzierung von Anwendungssoftware nach Handelsrecht und IFRS: In diesem Kapitel werden die in den vorherigen Kapiteln dargestellten Bilanzierungsmethoden nach HGB und IFRS direkt gegenübergestellt und systematisch verglichen. Der Vergleich beinhaltet eine detaillierte Analyse der Unterschiede in den Ansatz- und Bewertungskriterien, sowie eine eingehende Untersuchung der resultierenden bilanzpolitischen Spielräume. Es wird kritisch hinterfragt, welches Regelwerk für Unternehmen in der Praxis am vorteilhaftesten ist.
Schlüsselwörter
Anwendungssoftware, Bilanzierung, Handelsrecht, HGB, IFRS, Ansatzkriterien, Bewertungskriterien, Aktivierungsfähigkeit, Standardsoftware, Individualsoftware, ERP-Software, Bilanzpolitik, Vergleich, Spielräume.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Bilanzierung von Anwendungssoftware
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Bilanzierung von Anwendungssoftware nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Sie analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Methoden und untersucht die jeweiligen bilanzpolitischen Spielräume.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Begriffsabgrenzung und Klassifizierung von Anwendungssoftware (Standardsoftware, Individualsoftware, ERP-Software), die Ansatz- und Bewertungskriterien nach HGB und IFRS, einen detaillierten Vergleich beider Bilanzierungsmethoden und eine Analyse der daraus resultierenden bilanzpolitischen Spielräume.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einführung, ein Grundlagenkapitel, Kapitel zur Bilanzierung nach HGB und IFRS, ein Vergleichskapitel und abschließend eine Zusammenfassung und einen Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Anwendungssoftware-Bilanzierung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Bilanzierung von Anwendungssoftware nach HGB und IFRS zu vermitteln und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Methoden aus Anwendersicht aufzuzeigen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse der bilanzpolitischen Handlungsspielräume.
Welche Klassifizierung von Anwendungssoftware wird verwendet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Standardsoftware, Individualsoftware und ERP-Software. Diese Klassifizierung dient als Grundlage für die Analyse der jeweiligen bilanzrechtlichen Behandlung.
Welche Ansatzkriterien werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit beschreibt die abstrakte und konkrete Aktivierungsfähigkeit von Anwendungssoftware sowohl nach HGB als auch nach IFRS. Es wird auf die jeweiligen Anforderungen und Unterschiede eingegangen.
Wie werden die Bewertungskriterien behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Zugangs- und Folgebewertung von Anwendungssoftware unter HGB und IFRS. Hierbei wird der Fokus auf die Unterschiede in den zulässigen Bewertungsmethoden gelegt.
Was ist der zentrale Vergleichspunkt der Arbeit?
Der zentrale Vergleich liegt in der Gegenüberstellung der Bilanzierung von Anwendungssoftware nach HGB und IFRS. Dies beinhaltet einen detaillierten Vergleich der Ansatz- und Bewertungskriterien und eine Analyse der daraus resultierenden bilanzpolitischen Spielräume.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Anwendungssoftware, Bilanzierung, Handelsrecht, HGB, IFRS, Ansatzkriterien, Bewertungskriterien, Aktivierungsfähigkeit, Standardsoftware, Individualsoftware, ERP-Software, Bilanzpolitik, Vergleich, Spielräume.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und angrenzender Fächer, sowie für Praktiker in der Finanzbuchhaltung und im Rechnungswesen, die sich mit der Bilanzierung von Anwendungssoftware auseinandersetzen.
- Citar trabajo
- Melanie Richter (Autor), 2008, Die Bilanzierung von Anwendungssoftware nach Handelsrecht und IFRS aus Anwendersicht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130167