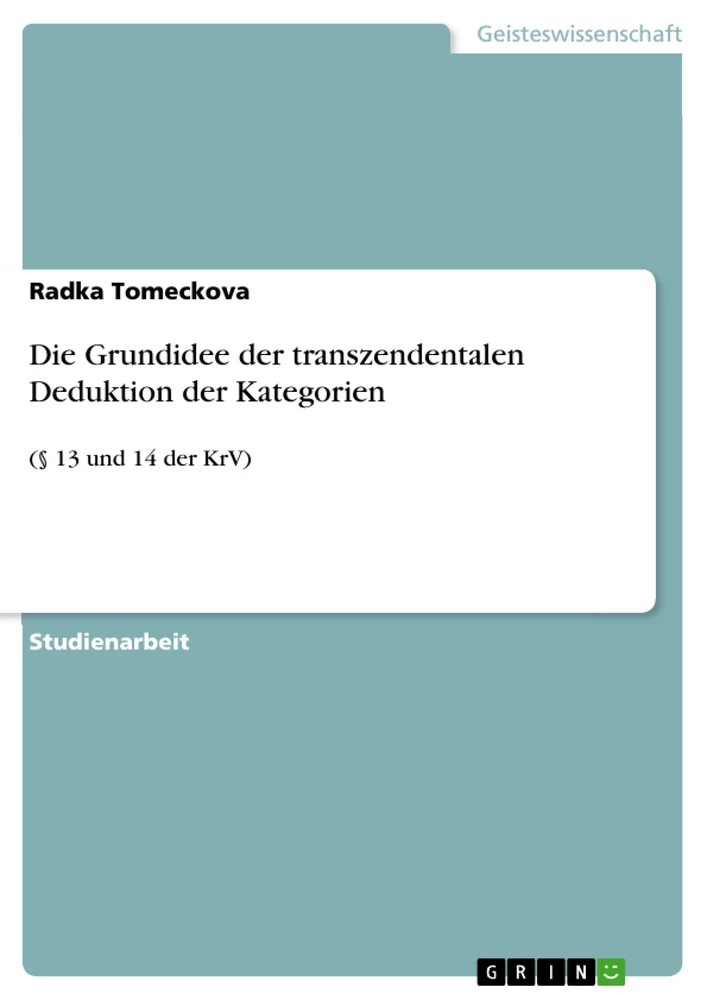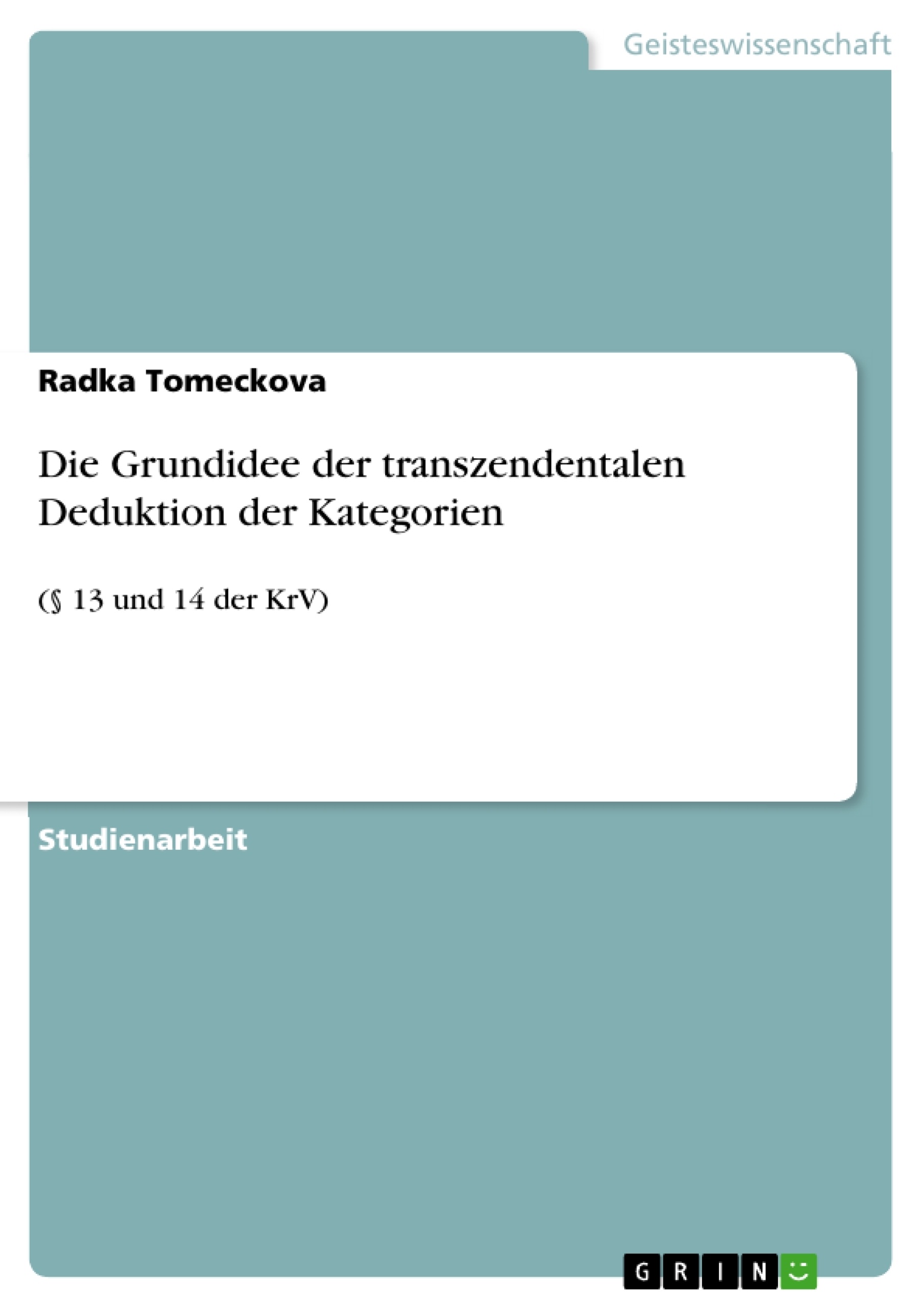Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem „Ersten Abschnitt“ der „Deduktion der reinen Verstandesbegriffen“ in der „Transzendentalen Analytik“. Vorzugsweise möchte ich hier also die einleitenden § 13 und 14 zusammenfassen und analysieren, vor allem um festzustellen, welchen Zweck Kants transzendentale Deduktion der Kategorien hat.
Zuerst möchte ich die kantianische Unterscheidung zwischen qiud iuris und quid facti annähern und den Bezug beider Fragen auf die Begriffe der Deduktion, der transzendentalen Deduktion und der empirischen Deduktion erläutern, so wie dies am Anfang des § 13 vom Kant angegeben ist (Abschnitt I und II). Anhand dieser Erläuterungen möchte ich dann den hier deklamierten Ziel der transzendentalen Deduktion der reinen Verstandesbegriffen (Kategorien) zeigen (Abschnitt II und IV). Dann möchte ich kurz den historischen Zusammenhang mit der berühmten Kritik des Kausalsbegriffes von Hume andeuten, um dabei klar zu machen, dass Kant mit seiner transzendentalen Deduktion zwar einerseits der Schwierigkeit, die Hume für Kausalität diagnostiziert hat, im Allgemeinen für alle unsere Kategorien „zunickt“, dass er aber andererseits Humes skeptische Lösung dieses Problemes abgelehnt hat bzw. überwinden wollte (Abschnitt V). Dann werde ich mich kurz der Frage des rechtswissenschaftlichen Ursprungs des Deduktionsbegriffes anhand des Aufsatzes von D. Henrich widmen (Abschnitt VI) – das Verständnis des ursprünglichen Kontextes dieses Begriffes leitet uns zu Schlüßen, die wir zwar schon vorher erreicht haben, diesmal aber aus einem anderen Blickwinkel, der unsere bisherige Interpretation bereichern kann.
Abschließend versuche ich den Kern der transzendentalen Deduktion der Kategorien anhand § 14 zu rekonstruieren, weil Kant selbst in der Vorrede zur ersten Auflage der Kritik (A XVII, S.871 in Reclam-Ausgabe) vermutete, dass er schon in dieser Passage, d.h. in der Passage A 92 – A 93, einen solchen Kern hinreichend angedeutet hatte. Diese Rekonstruktion ermöglicht uns, die eigene transzendentale Deduktion der Kategorien in Form der Prämissen und Konklusion zu formulieren, anhand deren wir an manche Schwierigkeiten der Interpretation hinweisen werden, die einen breiten Feld für nächste Untersuchungen eröffnen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- I. Die Frage nach der Rechtmäßigkeit (quid iuris) und nach dem Faktum (quid facti) und ihr Verhältnis zu den Begriffen der Deduktion, der transzendentalen Deduktion und der empirischen Deduktion
- II. Von Begriffen a priori gibt es notwendigerweise eine transzendentale Deduktion
- III. Die transzendentale Deduktion der Kategorien: Die Grundidee
- IV. Die transzendentale Deduktion der Kategorien: Die Rekonstruktion der Deduktion
- V. Die transzendentale Deduktion der Kategorien: Die Schwierigkeiten der Interpretation
- VI. Die transzendentale Deduktion der Kategorien: Die Kritik des Kausalitätsbegriffes von Hume
- VII. Die transzendentale Deduktion der Kategorien: Der rechtswissenschaftliche Ursprung des Deduktionsbegriffes
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der transzendentalen Deduktion der Kategorien in Kants Kritik der reinen Vernunft. Ziel ist es, die Grundidee der Deduktion in den einleitenden Paragraphen 13 und 14 der Kritik zu analysieren und den Zweck dieser Deduktion zu ermitteln. Die Arbeit untersucht die kantianische Unterscheidung zwischen quid iuris und quid facti und erläutert den Bezug beider Fragen auf die Deduktion, die transzendentale Deduktion und die empirische Deduktion. Darüber hinaus wird der historische Zusammenhang mit Humes Kritik des Kausalitätsbegriffes beleuchtet und die Frage nach dem rechtswissenschaftlichen Ursprung des Deduktionsbegriffes anhand des Aufsatzes von D. Henrich untersucht. Die Arbeit schließt mit einer Rekonstruktion der transzendentalen Deduktion der Kategorien anhand von § 14 und zeigt dabei einige Schwierigkeiten der Interpretation auf.
- Die kantianische Unterscheidung zwischen quid iuris und quid facti
- Der Zweck der transzendentalen Deduktion der Kategorien
- Der historische Zusammenhang mit Humes Kritik des Kausalitätsbegriffes
- Der rechtswissenschaftliche Ursprung des Deduktionsbegriffes
- Die Rekonstruktion der transzendentalen Deduktion der Kategorien
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die kantianische Unterscheidung zwischen quid iuris und quid facti eingeführt und deren Bezug auf die Deduktion, die transzendentale Deduktion und die empirische Deduktion erläutert. Kant argumentiert, dass die Deduktion die Beantwortung der Frage nach der Rechtmäßigkeit (quid iuris) liefert, während die Frage nach dem Faktum (quid facti) sich mit der Entstehung von Begriffen beschäftigt. Das Kapitel zeigt, dass die Frage nach der Rechtmäßigung besonders wichtig im Zusammenhang mit den a priori gegebenen Begriffen ist, da diese unabhängig von jeder Erfahrung entstanden sind und ihre Anwendung auf die Gegenstände gerechtfertigt werden muss.
Das zweite Kapitel argumentiert, dass für Begriffe a priori keine empirische, sondern nur eine transzendentale Deduktion geeignet ist. Kant zeigt, dass die empirische Deduktion, die die Entstehung von Begriffen aus der Erfahrung erklärt, nicht auf die a priori gegebenen Begriffe anwendbar ist, da diese unabhängig von der Erfahrung entstanden sind.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Grundidee der transzendentalen Deduktion der Kategorien. Kant argumentiert, dass die Kategorien, die reinen Verstandesbegriffe, nicht aus der Erfahrung stammen, sondern a priori gegeben sind. Die transzendentale Deduktion soll zeigen, wie diese Kategorien auf die Gegenstände der Erfahrung angewendet werden können.
Das vierte Kapitel rekonstruiert die transzendentale Deduktion der Kategorien anhand von § 14. Kant selbst vermutete, dass er in dieser Passage den Kern der Deduktion hinreichend angedeutet hatte. Die Rekonstruktion ermöglicht es, die Deduktion in Form von Prämissen und Konklusion zu formulieren und dabei auf einige Schwierigkeiten der Interpretation hinzuweisen.
Das fünfte Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten der Interpretation der transzendentalen Deduktion der Kategorien. Es werden verschiedene Interpretationen der Deduktion diskutiert und ihre Stärken und Schwächen analysiert.
Das sechste Kapitel untersucht den historischen Zusammenhang mit Humes Kritik des Kausalitätsbegriffes. Kant zeigt, dass er zwar Humes skeptische Lösung des Problems der Kausalität ablehnt, aber gleichzeitig die Schwierigkeit, die Hume für die Kausalität diagnostiziert hat, im Allgemeinen für alle unsere Kategorien „zunickt“.
Das siebte Kapitel widmet sich der Frage nach dem rechtswissenschaftlichen Ursprung des Deduktionsbegriffes. Anhand des Aufsatzes von D. Henrich wird das Verständnis des ursprünglichen Kontextes dieses Begriffes erläutert. Dieser Blickwinkel kann die bisherige Interpretation der Deduktion bereichern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die transzendentale Deduktion der Kategorien, die kantianische Unterscheidung zwischen quid iuris und quid facti, die a priori gegebenen Begriffe, die empirische Deduktion, die Kritik des Kausalitätsbegriffes von Hume und den rechtswissenschaftlichen Ursprung des Deduktionsbegriffes. Die Arbeit analysiert die Grundidee der Deduktion und zeigt ihre Bedeutung für die Anwendung von Begriffen auf die Gegenstände der Erfahrung. Darüber hinaus werden einige Schwierigkeiten der Interpretation der Deduktion beleuchtet und verschiedene Interpretationen diskutiert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen „quid iuris“ und „quid facti“ bei Kant?
„Quid iuris“ fragt nach der Rechtmäßigkeit eines Begriffs (warum dürfen wir ihn anwenden?), während „quid facti“ nach der tatsächlichen Entstehung des Begriffs aus der Erfahrung fragt.
Was ist das Ziel der transzendentalen Deduktion der Kategorien?
Sie soll beweisen, dass die reinen Verstandesbegriffe (Kategorien) a priori gültig sind und notwendigerweise auf alle Gegenstände der Erfahrung angewendet werden müssen.
Wie reagierte Kant auf David Hume?
Kant akzeptierte Humes Problemstellung zur Kausalität, lehnte aber dessen skeptische Lösung ab. Die Deduktion soll zeigen, dass Kausalität eine notwendige Bedingung der Erfahrung ist.
Woher stammt der Begriff „Deduktion“ ursprünglich?
Der Begriff hat einen rechtswissenschaftlichen Ursprung und bezeichnete in der frühen Neuzeit die Herleitung eines Rechtsanspruchs aus einem Rechtstitel.
Warum reicht eine empirische Deduktion für Kategorien nicht aus?
Empirische Deduktionen erklären nur, wie Begriffe durch Erfahrung entstehen. Da Kategorien aber unabhängig von der Erfahrung (a priori) sind, bedürfen sie einer transzendentalen Rechtfertigung.
- Citation du texte
- Radka Tomeckova (Auteur), 2008, Die Grundidee der transzendentalen Deduktion der Kategorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130181