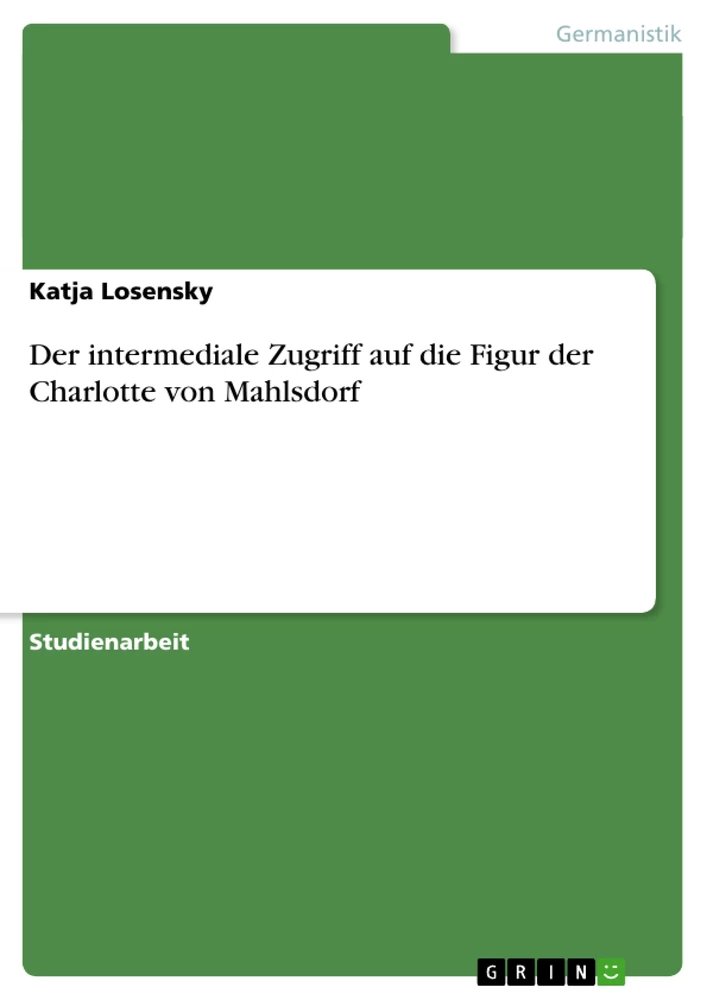1. Einleitung
“Jede Geschichte lässt sich auf fünf Millionen verschiedene Arten erzählen” , heißt es. Diese Zahl, so übertrieben sie sein mag, drückt aus, dass Geschichten, auch wenn sie den gleichen Sachverhalt behandeln, sich eben nicht gleichen müssen. Wer erzählt wie und warum und aus welchem Kontext heraus?
Über Charlotte von Mahlsdorf wurden und werden viele Geschichten erzählt, deren Wahrheitsgehalt von einigen nicht bestritten, von anderen vollständig negiert wird. Sie selbst war eine große Geschichtenerzählerin. Gegenstand aller Geschichten von ihr und über sie war und ist sie selbst, ihr Leben, ihre Lebensmittelpunkt, das Gründerzeitmuseum in Berlin, Mahlsdorf, festgehalten und erhalten durch verschiedenste Medien. Rosa von Praunheim drehte zwei Filme, Peter Süß schrieb zwei Bücher, es gibt zwei Theaterstücke, in denen das Leben der Charlotte von Mahlsdorf auf der Bühne inszeniert wird. Hier deutet sich bereits die Doppelbödigkeit der Geschichten an. Es gibt stets zwei, so als bilde die eine das Korrektiv der anderen, als wäre die ambivalente Persönlichkeit dieses Menschen anders nicht greifbar, wenn sie überhaupt greifbar ist. Daneben finden sich weitere Bücher, Internetseiten, ein Hörbuch. Und auch Menschen, die Charlotte von Mahlsdorf mehr oder weniger gut kannten, erzählen ihre Geschichte(n). Sie alle zusammen bilden einen Flickenteppich der Persönlichkeit und des Lebens der Charlotte von Mahlsdorf, unübersichtlich und ambivalent, in der Schwebe zwischen Fiktion und Fakten.
In dieser Arbeit sollen einige dieser Werke, näher betrachtet werden, daraufhin befragt werden, wie und welches Bild sie von Charlotte von Mahlsdorf transportieren, in welchen Punkten sie sich möglicherweise gleichen, in welchen sie abweichen.
Besonderes Interesse gilt in diesem Zusammenhang den beiden Filmen, die Rosa von Praunheim über und mit Charlotte von Mahlsdorf drehte: „Ich bin meine eigene Frau“ und „Charlotte in Schweden“ , der von Peter Süß herausgebrachten Autobiographie gleichen Titels und dem Theaterstück Doug Wrights, das gleichsam diesen Titel trägt, wenn auch in der englischen Übersetzung „I am my own wife“ . Auch das Theaterstück von Peter Süß, das hier nicht weiter aufgegriffen wird, trägt den Titel „Ich bin meine eigene Frau“. ....
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Charlotte: Biographie und Brüche
- Rosa von Praunheims „Ich bin meine eigene Frau“
- Handlung
- Konzeption des Films
- Peter Süß: „Ich bin meine eigene Frau“
- Zur Wirkung von Film und Buch
- Rosa von Praunheims „Charlotte in Schweden“
- Doug Wrights „,I`m my own wife"
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Figur der Charlotte von Mahlsdorf und analysiert verschiedene Medien, die sich mit ihrem Leben auseinandersetzen. Ziel ist es, die unterschiedlichen Bilder von Charlotte von Mahlsdorf zu untersuchen, die in diesen Werken transportiert werden, und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
- Die Darstellung von Charlotte von Mahlsdorf in verschiedenen Medien
- Die Ambivalenz der Persönlichkeit und des Lebens von Charlotte von Mahlsdorf
- Die Rolle von Fiktion und Fakten in den Geschichten über Charlotte von Mahlsdorf
- Die Rezeption der Figur Charlotte von Mahlsdorf in der Öffentlichkeit
- Die Bedeutung von Charlotte von Mahlsdorf für die Geschichte der Homosexualität in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der verschiedenen Geschichten über Charlotte von Mahlsdorf. Es wird auf die Ambivalenz der Persönlichkeit und des Lebens von Charlotte von Mahlsdorf hingewiesen und die Bedeutung der verschiedenen Medien für die Rezeption ihrer Geschichte hervorgehoben.
Das Kapitel „Charlotte: Biographie und Brüche“ beleuchtet die Lebensgeschichte von Charlotte von Mahlsdorf, ihre Kindheit, Jugend und ihre Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus und der DDR. Es werden die wichtigsten Stationen ihres Lebens dargestellt, darunter ihre Tätigkeit als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) der Stasi und ihre Auswanderung nach Schweden.
Das Kapitel „Rosa von Praunheims „Ich bin meine eigene Frau““ analysiert den gleichnamigen Film von Rosa von Praunheim, der sich mit dem Leben von Charlotte von Mahlsdorf auseinandersetzt. Es werden die Handlung des Films, die Konzeption und die filmische Umsetzung des Stoffes beleuchtet.
Das Kapitel „Peter Süß: „Ich bin meine eigene Frau““ befasst sich mit der gleichnamigen Autobiographie von Charlotte von Mahlsdorf, die von Peter Süß herausgegeben wurde. Es werden die wichtigsten Inhalte der Autobiographie dargestellt und die Rezeption des Buches in der Öffentlichkeit beleuchtet.
Das Kapitel „Zur Wirkung von Film und Buch“ untersucht die Wirkung der beiden Werke von Rosa von Praunheim und Peter Süß auf die Rezeption der Figur Charlotte von Mahlsdorf. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Werke aufgezeigt und die Frage nach der Authentizität der Darstellung von Charlotte von Mahlsdorf diskutiert.
Das Kapitel „Rosa von Praunheims „Charlotte in Schweden““ analysiert den zweiten Film von Rosa von Praunheim über Charlotte von Mahlsdorf, der sich mit ihrem Leben in Schweden auseinandersetzt. Es werden die Handlung des Films, die Konzeption und die filmische Umsetzung des Stoffes beleuchtet.
Das Kapitel „Doug Wrights „,I`m my own wife"“ befasst sich mit dem gleichnamigen Theaterstück von Doug Wright, das sich mit dem Leben von Charlotte von Mahlsdorf auseinandersetzt. Es werden die wichtigsten Inhalte des Theaterstücks dargestellt und die Rezeption des Stückes in der Öffentlichkeit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Figur der Charlotte von Mahlsdorf, die Darstellung von Homosexualität in der neueren deutschen Literatur, die Rolle von Medien in der Konstruktion von Identität, die Ambivalenz von Fiktion und Fakten, die Rezeption von Lebensgeschichten in der Öffentlichkeit, die Geschichte der Homosexualität in Deutschland und die Rolle von Charlotte von Mahlsdorf als Symbolfigur für die Homosexuellenbewegung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Charlotte von Mahlsdorf?
Charlotte von Mahlsdorf (1928–2002) war eine bekannte deutsche Transvestitin, Gründerin des Gründerzeitmuseums in Berlin-Mahlsdorf und eine Symbolfigur der Homosexuellenbewegung.
Welche Rolle spielen die Filme von Rosa von Praunheim?
Von Praunheim drehte die Filme „Ich bin meine eigene Frau“ und „Charlotte in Schweden“. Diese Werke trugen maßgeblich zur öffentlichen Wahrnehmung und Mythisierung ihrer Person bei.
Warum ist ihre Biographie ambivalent?
Ihre Lebensgeschichte schwankt zwischen Fakten und Fiktion. Besonders ihre Tätigkeit als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) der Stasi und ihre Darstellungen der NS-Zeit werden in verschiedenen Medien unterschiedlich bewertet.
Was thematisiert das Theaterstück „I am my own wife“?
Das Stück von Doug Wright setzt sich intermedial mit ihrer Identität auseinander und beleuchtet die Schwierigkeit, die „wahre“ Charlotte hinter den vielen Geschichten zu finden.
Welche Bedeutung hatte sie für die LGBTQ-Geschichte?
Sie galt als Überlebenskünstlerin, die sowohl das Dritte Reich als auch die DDR in ihrer nonkonformen Identität überstand und so zum Vorbild für viele Menschen wurde.
- Quote paper
- Katja Losensky (Author), 2008, Der intermediale Zugriff auf die Figur der Charlotte von Mahlsdorf , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130188