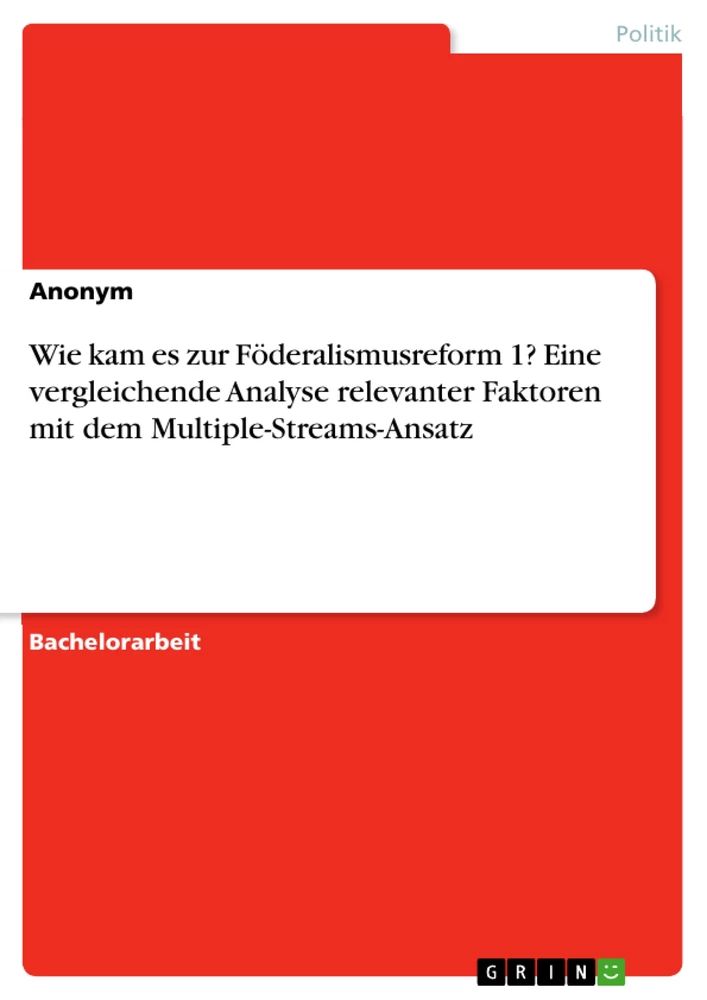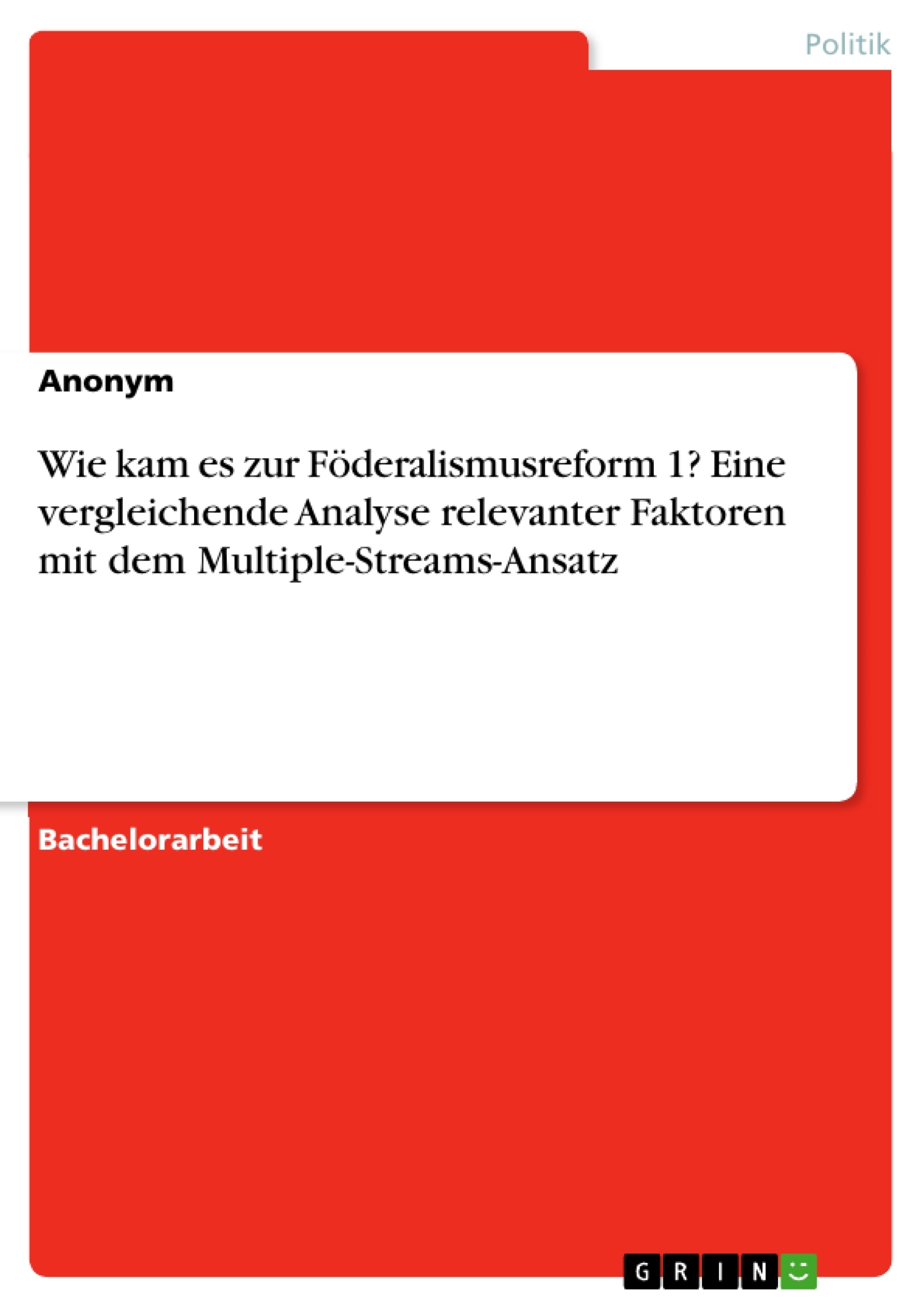Wie konnte die Föderalismusreform 1 im Jahr 2006 trotz vorherigem Scheitern schließlich gelingen? Die Bachelorarbeit beantwortet diese Frage, indem sie sich mit der jeweiligen Ausgangssituation der Reformbestrebungen auseinandersetzt.
Die föderale Staatsordnung gilt gemeinhin als Grund dafür, dass politische Entscheidungen in der Bundesrepublik nur mühsam getroffen werden. Dennoch ist sie bereits seit Inkrafttreten des deutschen Grundgesetzes 1949 verfassungsrechtlich verankert. Mindestens genauso lange wird der Föderalismus in politischen und gesellschaftlichen Debatten diskutiert. Sowohl innerhalb der aktiven Politik als auch im Zuge wissenschaftlicher Untersuchungen stellt er deshalb einen häufig betrachteten Gegenstand dar.
Trotz der Festschreibung des Föderalismus im Grundgesetz ist das Verhältnis zwischen Bund und Ländern keineswegs statisch. Es basiert auf einem ständigen Wandlungs- und Anpassungsprozess. Dennoch sind die unterschiedlichen staatlichen Ebenen eng miteinander verknüpft. Das Grundgesetz legt fest, welche Bereiche von den verschiedenen Ebenen reguliert werden (Kompetenzverteilung).
Immer wieder kommt es dabei zu Problemen. So auch im Jahr 2000, in dem das Verhältnis von Bund und Ländern in das Blickfeld politischer Entscheidungsträger/innen geriet. In der Geschichte des Landes war es im Laufe der Zeit zu einer immer stärkeren Verflechtung zwischen den staatlichen Ebenen gekommen. Die daraus hervorgehende Menge an Vetospieler/innen und die Möglichkeit der gegenseitigen Blockade ebenjener machten das Regieren in der Bundesrepublik schwerfällig.
Das Land befand sich in einer sogenannten Politikverflechtungsfalle. Dieses Problem lösen sollte eine Verfassungsänderung. Dafür rief der Bundestag auf Antrag von SPD, CDU/CSU, des Bündnisses 90/Die Grünen und der FDP die sogenannte Föderalismuskommission zur Modernisierung Bundestaatlicher Ordnung ins Leben. Die Aufgabe dieser lag darin, Vorschläge zur nötigen Entflechtung auszuarbeiten.
Ihre Arbeit scheiterte jedoch bereits kurze Zeit später an inneren Differenzen und wurde ohne Endergebnis niedergelegt. Eine Föderalismusreform konnte in Folge dessen zunächst nicht zustande kommen. Bereits einige Jahre später aber wurde die im Prozess von 2001 bis 2004 angestrebte Verfassungsänderung umgesetzt. Die Föderalismusreform trat am 1. September 2006 in Kraft. Was hatte sich in der Zwischenzeit verändert, sodass das Bestreben letztlich gelingen konnte?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung, Relevanz und Problemstellung
- Stand der Forschung
- Theoretischer Rahmen: Der Multiple-Streams-Ansatz
- Das Garbage Can Model
- Prämissen und Grundannahmen des Multiple-Streams-Ansatzes
- Die Erweiterung des Ansatzes durch Nikolaos Zahariadis
- Methodik und Hypothesen
- Fallauswahl und Vergleichbarkeit
- Operationalisierung und Konzeptualisierung
- Analyse
- Fall 1 - Der Prozess im Zeitraum von 2001 bis 2004
- Fall 2 - Der Prozess im Zeitraum von 2004 bis 2006
- Vergleich der Untersuchungszeitpunkte
- Der Multiple-Streams-Ansatz: Grenzen und Kritik
- Diskussion der Ergebnisse und Grenzen des Multiple-Streams-Ansatzes
- Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Forschungsfrage
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die Föderalismusreform 1 zustande kam. Sie verfolgt das Ziel, die Entstehung der Reform im Kontext des deutschen Föderalismus mithilfe des Multiple-Streams-Ansatzes zu analysieren und die relevanten Faktoren aufzuzeigen.
- Die Entwicklung des deutschen Föderalismus
- Die Rolle der Politik und der politischen Akteure
- Die Relevanz von politischen Problemen und Lösungen
- Der Einfluss von politischen Rahmenbedingungen
- Die Anwendung des Multiple-Streams-Ansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz und die Problemstellung der Arbeit dar. Der Stand der Forschung beleuchtet den aktuellen Wissensstand zum Thema Föderalismusreform und Multiple-Streams-Ansatz. Das dritte Kapitel erläutert den theoretischen Rahmen der Arbeit und stellt den Multiple-Streams-Ansatz in seiner Entwicklung und Anwendung vor. Das vierte Kapitel beschreibt die Methodik und die Hypothesen der Arbeit. Die Fallauswahl und Vergleichbarkeit der Fälle wird im fünften Kapitel behandelt. Das sechste Kapitel widmet sich der Operationalisierung und Konzeptualisierung der verwendeten Begriffe und Variablen. Das siebte Kapitel analysiert die beiden Fälle – den Prozess der Föderalismusreform im Zeitraum von 2001 bis 2004 und im Zeitraum von 2004 bis 2006. Der Vergleich der beiden Untersuchungszeitpunkte wird ebenfalls in diesem Kapitel behandelt. Im achten Kapitel wird der Multiple-Streams-Ansatz in seiner Kritik beleuchtet und die Ergebnisse der Analyse werden diskutiert. Die Forschungsfrage wird am Ende des achten Kapitels beantwortet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Föderalismus, Föderalismusreform, Multiple-Streams-Ansatz, Politikanalyse, Vetospieler, politische Entscheidungsprozesse, Bundesrepublik Deutschland, Bundesrat, Bundestag, politische Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum scheiterte die Föderalismusreform zunächst (2001-2004)?
Die erste Föderalismuskommission scheiterte an inneren Differenzen zwischen Bund und Ländern sowie an der Blockade durch zahlreiche Vetospieler in der sogenannten Politikverflechtungsfalle.
Was änderte sich bis zum Erfolg der Reform im Jahr 2006?
Veränderte politische Rahmenbedingungen und ein neues Gelegenheitsfenster ermöglichten es, die Blockaden aufzubrechen und die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern neu zu ordnen.
Was ist der Multiple-Streams-Ansatz?
Dies ist ein politikwissenschaftliches Modell, das erklärt, wie Themen auf die politische Agenda kommen. Es betrachtet drei Ströme: Probleme (problems), Lösungen (policies) und politische Rahmenbedingungen (politics).
Was versteht man unter der „Politikverflechtungsfalle“?
Sie beschreibt einen Zustand, in dem Bund und Länder so eng miteinander verknüpft sind, dass sie sich gegenseitig blockieren können, was notwendige Reformen extrem erschwert oder unmöglich macht.
Welche Rolle spielen Vetospieler im deutschen Föderalismus?
Vetospieler (wie der Bundesrat) sind Akteure, deren Zustimmung für eine Verfassungsänderung zwingend erforderlich ist. Ihre Vielzahl macht das Regieren in Deutschland oft schwerfällig.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Wie kam es zur Föderalismusreform 1? Eine vergleichende Analyse relevanter Faktoren mit dem Multiple-Streams-Ansatz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1302018