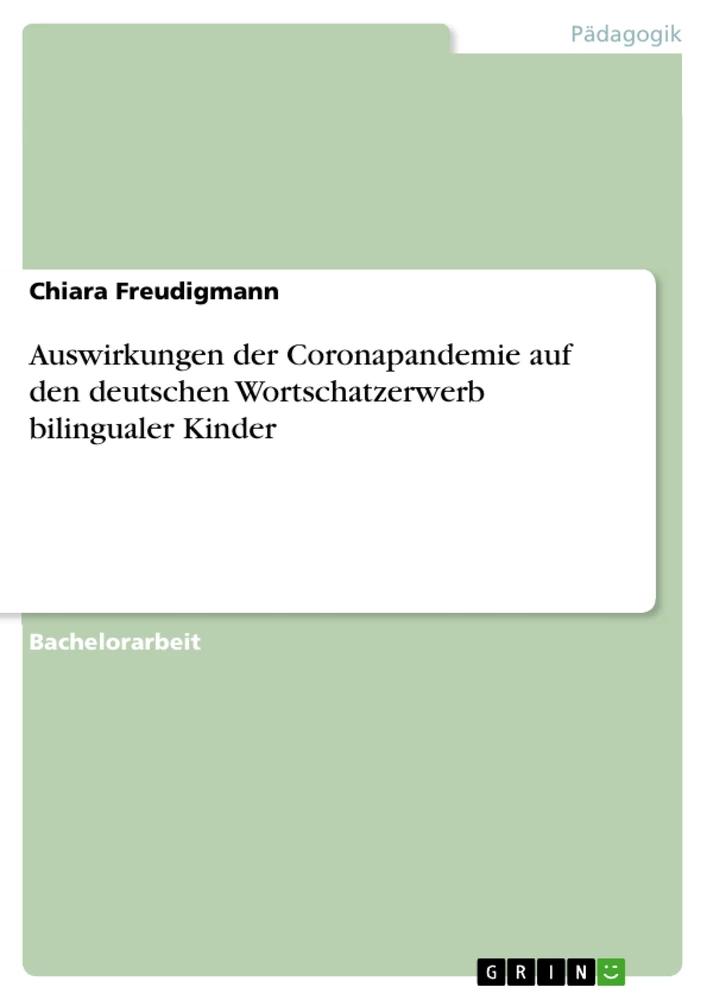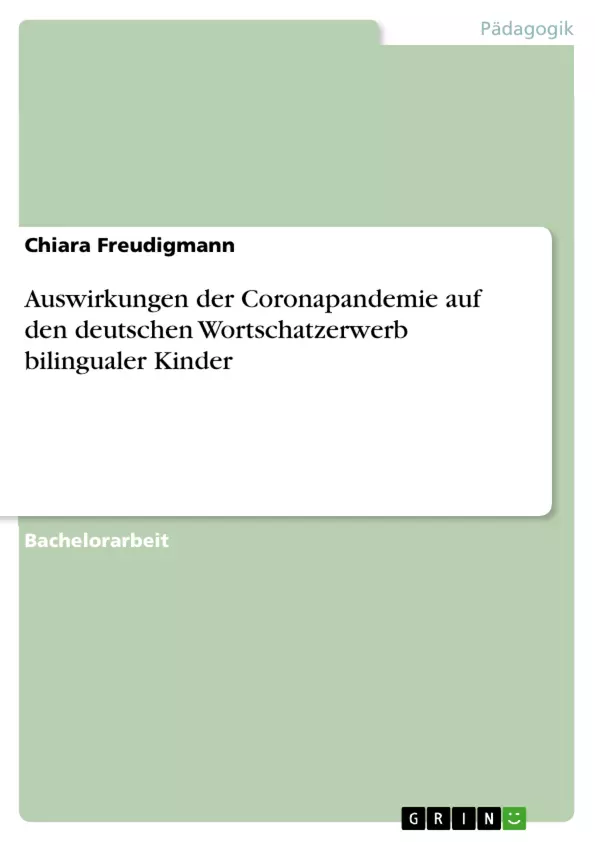In dieser Arbeit wird untersucht, ob die Coronapandemie Auswirkungen auf den deutschen Wortschatzerwerb bilingualer Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren hat. Hierbei werden Sprachexpert*innen nach ihrer subjektiven fachlichen Einschätzung befragt. Im ersten Teil meiner Arbeit werde ich mich den wichtigsten, in dieser Arbeit verwendeten, Begriffen widmen und definieren sowie den benötigten theoretischen Hintergrund für die Thematik geben. Im darauffolgenden Abschnitt wird auf die methodischen Aspekte eingegangen, die Ergebnisse präsentiert und zuletzt diskutiert. Ein Fazit und ein Ausblick schließen die Arbeit ab.
Die Weltbevölkerung sieht sich seit Anfang 2020 mit einer Pandemie konfrontiert. Diese wurde durch den sogenannten Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst. Das Virus breitete sich in kürzester Zeit global aus. So wurde auch im März 2020 die erste sogenannte „Coronawelle“ in Deutschland registriert. Da das Virus hochinfektiös ist und unter Umständen lebensbedrohlich sein kann, wurden Maßnahmen eingeführt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Nun bestimmen diese Maßnahmen den Alltag vieler Menschen, darunter auch den der Kinder. So wurde beispielsweise eine Meldepflicht zum Infektionsgeschehen, Ein- und Ausreiseregeln, ebenso Hygieneregeln wie das Hände waschen/desinfizieren, die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in geschlossenen Räumen und Abstandsregeln von eineinhalb bis zwei Metern. Eine Vielzahl an sozialen Einschränkungen wurden zunehmend ergänzt. Hierzu zählen unter anderem die Quarantäne bei Infektion oder Erstkontakt zu infizierten Personen, die sogenannten „Lockdowns“ als Intensivmaßnahme zur Eindämmung der Infektionsrate, das Schließen von sämtlichen Institutionen im Bereich Bildung, Betreuung, Freizeit und Kultur, das Arbeiten im Homeschooling/Homeoffice und Haushaltsregeln als Kontrolle der Kontaktbeschränkungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Bilingualismus
- 2.2 Definition Sprachentwicklung/Spracherwerb
- 2.2.1 Bilingualer Spracherwerb
- 2.3 Formen des Bilingualismus
- 2.3.1 Simultane und sukzessive Zweisprachigkeit
- 2.3.2 Natürliche und gesteuerte Zweisprachigkeit
- 2.3.3 Additive und subtraktive Zweisprachigkeit
- 2.4 Wortschatzerwerb
- 2.4.1 Aktiver und passiver Wortschatz
- 2.4.2 Die Wortartenentwicklung
- 2.5 Voraussetzungen des Spracherwerbs anhand des Sprachbaums
- 2.5.1 Sprachförderliches Verhalten anhand des Sprachbaums
- 2.6 Die Coronapandemie
- 2.6.1 Entstehung und Verlauf
- 2.6.2 Maßnahmen
- 2.6.3 Folgen
- 3. Fragestellungen und Hypothese
- 4. Methodik
- 4.1 Studiendesign
- 4.2 Studienpopulation
- 4.3 Fragebogen
- 4.3.1 Entwicklung des Fragebogens
- 4.4 Datenanalyse
- 5. Ergebnisse
- 5.1 Merkmale der Studienpopulation
- 5.2 Ergebnisse der Inhaltlichen Fragen
- 6. Diskussion
- 6.1 Problemdarstellung
- 6.2 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
- 6.3 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
- 6.3.1 Methodenkritik
- 6.3.2 Interpretation der inhaltlichen Fragen
- 6.4 Forschungsstand
- 7. Fazit/Ausblick
- Einfluss der Coronapandemie auf den Wortschatzerwerb bilingualer Kinder
- Vergleich der sprachlichen Entwicklung von bilingualen und monolingualen Kindern
- Subjektive Einschätzungen von Sprachexperten*innen zu den Auswirkungen der Pandemie
- Analyse von Inhalts- und Funktionswörtern im Sprachverständnis und der Sprachproduktion
- Bedeutung von Notbetreuung für die sprachliche Entwicklung bilingualer Kinder
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung gibt einen Überblick über die Coronapandemie und ihre Auswirkungen auf den Alltag von Kindern, insbesondere die sozialen Einschränkungen und die Sorge um die Beeinträchtigung der kindlichen Entwicklung.
- Kapitel 2: Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet die relevanten theoretischen Konzepte, die für die Untersuchung des Wortschatzerwerbs bilingualer Kinder in der Pandemie relevant sind. Hier werden Themen wie Bilingualismus, Sprachentwicklung, Formen des Bilingualismus, Wortschatzerwerb und die Coronapandemie behandelt.
- Kapitel 3: Fragestellungen und Hypothese: In diesem Kapitel werden die zentralen Forschungsfragen und die Hypothese der Arbeit vorgestellt, die die Grundlage für die empirische Untersuchung bilden.
- Kapitel 4: Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die Forschungsmethodik, das Studiendesign, die Studienpopulation, den Fragebogen und die Datenanalyse, die für die Untersuchung der Auswirkungen der Pandemie auf den Wortschatzerwerb bilingualer Kinder eingesetzt wurden.
- Kapitel 5: Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung präsentiert und die wichtigsten Erkenntnisse über die sprachliche Entwicklung bilingualer Kinder in der Pandemie dargestellt.
- Kapitel 6: Diskussion: Die Diskussion befasst sich mit der Interpretation und Diskussion der Ergebnisse, der Methodenkritik und dem Forschungsstand.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert die Auswirkungen der Coronapandemie auf den Wortschatzerwerb bilingualer Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren. Die Untersuchung zielt darauf ab, die subjektiven Einschätzungen von Logopäden*Logopädinnen und Erzieher*innen zu den sprachlichen Entwicklungen dieser Kinder zu ermitteln und zu analysieren, wie die sozialen Einschränkungen durch die Pandemie den Wortschatzerwerb beeinflusst haben. Die Studie untersucht, ob und wie sich die Pandemie auf die Sprachentwicklung bilingualer Kinder im Vergleich zu monolingualen Kindern auswirkt.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Bilingualismus, Wortschatzerwerb, Sprachentwicklung, Coronapandemie, soziale Einschränkungen, Sprachexperten*innen, quantitative Querschnittsstudie, Onlinefragebogen, Inhaltswörter, Funktionswörter, Sprachverständnis, Sprachproduktion, Notbetreuung, monolingual, bilingual, Sprachauffälligkeiten, Langzeitfolgen.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte die Coronapandemie auf bilinguale Kinder?
Die Arbeit untersucht, ob soziale Einschränkungen und Kita-Schließungen den deutschen Wortschatzerwerb bei zweisprachigen Kindern im Alter von 3-6 Jahren verzögert haben.
Was ist der Unterschied zwischen simultanem und sukzessivem Spracherwerb?
Simultan bedeutet der gleichzeitige Erwerb zweier Sprachen von Geburt an, sukzessiv ist der zeitversetzte Erwerb einer Zweitsprache.
Warum ist der Kontakt zu Gleichaltrigen für den Wortschatz wichtig?
Für viele bilinguale Kinder ist die Kita der Hauptort, um die deutsche Sprache aktiv anzuwenden und den Wortschatz durch soziale Interaktion zu erweitern.
Was sind Inhalts- und Funktionswörter?
Inhaltswörter tragen die Hauptbedeutung (Nomen, Verben), während Funktionswörter (Artikel, Präpositionen) die grammatische Struktur bilden.
Welche Rolle spielte die Notbetreuung in der Pandemie?
Die Arbeit analysiert, ob Kinder in der Notbetreuung weniger starke Defizite im Wortschatzerwerb zeigten als Kinder, die komplett zu Hause blieben.
- Quote paper
- Chiara Freudigmann (Author), 2022, Auswirkungen der Coronapandemie auf den deutschen Wortschatzerwerb bilingualer Kinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1303401