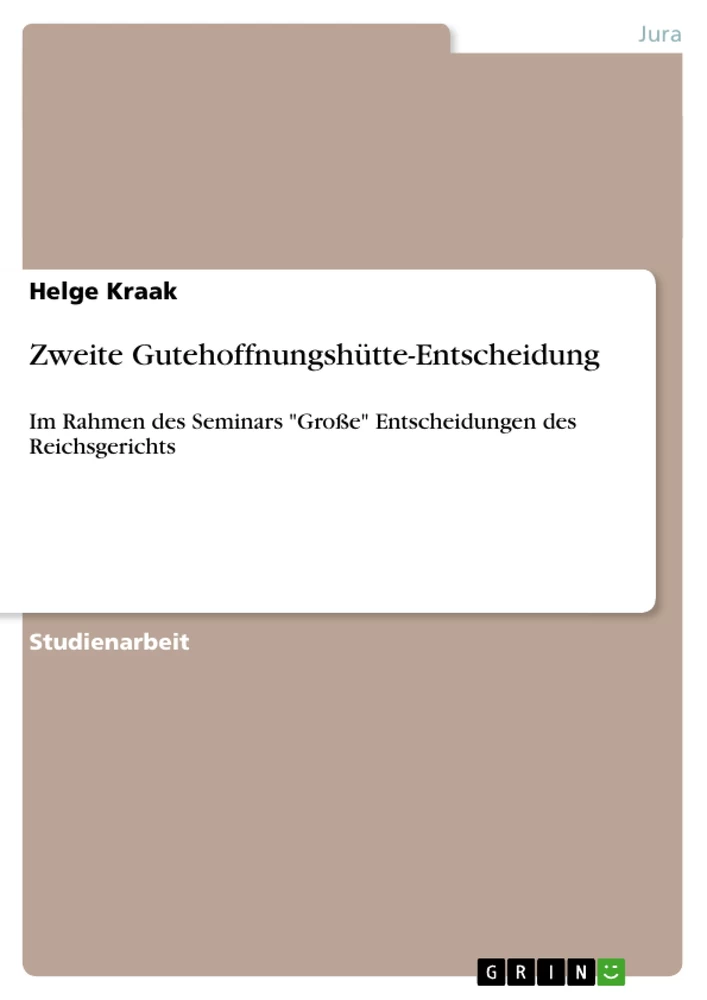In dem Urteil vom 19.03.1937 befasste sich der V. Zivilsenat des Reichsgerichts mit der Klage eines Landwirts aus Oberhausen gegen die Betreiberin der Gutehoffnungshütte. Der Landwirt verlangte für immissionsbedingte Produktionsausfälle Schadensersatz. Entgegen der Rechtsprechungslinie des Reichsgerichts bei ähnlichen Fällen in den Jahren zuvor bejahte das Reichsgericht erstmals eine Ausgleichspflicht der Emittentin infolge der durch sie verursachten landwirtschaftsbetrieblichen Beeinträchtigungen.
Das dieser Arbeit thematisch zugrunde liegende Urteil wirft zunächst zwei wesentliche Fragestellungen auf.
Zum einen ist dies - über eine größere zeitliche Distanz betrachtet - die Frage, welche Bedeutung die industrielle Entwicklung, die in Deutschland durch verschiedene Ereignisse (wie der Zollverein 1833/34 und der geeinigte Deutsche Staat 1871) v. a. seit dem 19. Jhd. stark vorangetrieben wurde, für das Urteil hatte. Zum anderen tritt zu diesem großen Zeitabschnitt von mehr als einem Jahrhundert bis zum Urteil 1937 in Konkurrenz die Frage nach der Bedeutung der konkreten gesellschaftlich-politischen Umstände im Dritten Reich und der Zeit unmittelbar davor.
Mit diesen Fragen einhergehen muss aber auch die Betrachtung der juristischen Aspekte dieses Urteils. Hierbei ist auch ein Blick auf frühere Urteile notwendig, um die Tragweite und Bedeutung des Urteils besser nachvollziehen zu können. Dabei wird sich zeigen, dass insbesondere der § 906 BGB in seiner unveränderten Fassung der Einführung des BGBs eine besondere Stellung einnimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzzusammenfassung des "Zweite Gutehoffnungshütte-Urteils".
- Grundlegende Fragestellungen zum Urteil...
- Wichtige gesetzliche Grundlagen...........
- Wortlaut des § 906 BGB.
- Wortlaut des § 148 AGB (Preußisches Allgemeines Berggesetz).
- Wortlaut des § 26 GewO
- Geschichtliche Hintergründe zur Formulierung des § 906 BGB.
- Entwicklung der Rechtsprechung anhand ausgewählter Urteile......
- 1910: Eisenhüttenwerk-Thale-Urteil (RG Gruch 55, 105)
- Streitgegenstand….......
- Stellungnahme des Reichsgerichts
- Überblick über das Urteil
- Besonderheiten des Urteils im Einzelnen
- 1932: "Erstes Gutehoffnungshütte-Urteil" (RGZ 139, 29)
- Streitgegenstand…………………………...
- Stellungnahme des Reichsgerichts
- Überblick über das Urteil
- 1937: "Zweites Gutehoffnungshütte-Urteil" (RGZ 154, 161).....
- Streitgegenstand…........
- Stellungnahme des Reichsgerichts.
- Überblick über das Urteil
- Besonderheiten des Urteils im Einzelnen .
- Nachbarliches Gemeinschaftsverhältnis und § 241 BGB.
- 1910: Eisenhüttenwerk-Thale-Urteil (RG Gruch 55, 105)
- Die Rahmenbedingungen der Urteile von 1932 und 1937......
- Besetzung des V. Zivilsenats
- Die Faktische Situation der Landwirtschaft zur Zeit um 1932.
- Faktische Situation der Landwirtschaft zur Zeit um 1937
- Rolle der Landwirtschaft in der Politik der Nationalsozialisten
- Begriff der "Volkgemeinschaft".
- Schlussfolgerungen..
- Vorbemerkung
- Das Urteil betrachtet im Zeitfenster der 1930er Jahre bis 1940er Jahre.........
- Das Urteil betrachtet im Zeitfenster Ende 1900 bis in die 1940er Jahre
- Vorläufiges Fazit.
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert das "Zweite Gutehoffnungshütte-Urteil" des Reichsgerichts aus dem Jahr 1937. Sie untersucht die rechtlichen Grundlagen, die historischen Hintergründe und die Entwicklung der Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem Urteil. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Urteils im Kontext der damaligen Zeit und analysiert die Rolle des Reichsgerichts in der nationalsozialistischen Rechtsprechung.
- Die Entwicklung des § 906 BGB und seine Anwendung in der Rechtsprechung.
- Die Rolle des Reichsgerichts in der nationalsozialistischen Rechtsprechung.
- Die Bedeutung des "Zweiten Gutehoffnungshütte-Urteils" für das Nachbarrecht.
- Die Auswirkungen des Urteils auf die Landwirtschaft und die "Volkgemeinschaft".
- Die historische Einordnung des Urteils im Kontext der 1930er Jahre.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Kurzzusammenfassung des "Zweiten Gutehoffnungshütte-Urteils". Anschließend werden die grundlegenden Fragestellungen zum Urteil erläutert und die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen, wie der § 906 BGB, der § 148 AGB und der § 26 GewO, vorgestellt.
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die geschichtlichen Hintergründe zur Formulierung des § 906 BGB beleuchtet. Es folgt eine Analyse der Entwicklung der Rechtsprechung anhand ausgewählter Urteile, darunter das Eisenhüttenwerk-Thale-Urteil von 1910 und das "Erste Gutehoffnungshütte-Urteil" von 1932.
Die Arbeit untersucht auch die Rahmenbedingungen der Urteile von 1932 und 1937, einschließlich der Besetzung des V. Zivilsenats, der faktischen Situation der Landwirtschaft zur damaligen Zeit und der Rolle der Landwirtschaft in der Politik der Nationalsozialisten.
Abschließend werden Schlussfolgerungen gezogen und das Urteil im Kontext der damaligen Zeit eingeordnet. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Urteils für das Nachbarrecht und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die "Volkgemeinschaft".
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das "Zweite Gutehoffnungshütte-Urteil", das Reichsgericht, das Nachbarrecht, § 906 BGB, die Rechtsprechung, die historische Einordnung, die Nationalsozialistische Zeit, die Landwirtschaft, die "Volkgemeinschaft" und die Entwicklung des Rechts.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Besondere am "Zweiten Gutehoffnungshütte-Urteil" von 1937?
Das Reichsgericht bejahte erstmals eine Ausgleichspflicht der Industrie für landwirtschaftliche Produktionsausfälle durch Immissionen.
Welche Rolle spielte § 906 BGB in diesem Urteil?
Dieser Paragraph regelt die Einwirkungen auf das Nachbargrundstück und war die zentrale Rechtsgrundlage für die Entscheidung.
Wie beeinflusste die NS-Ideologie das Urteil?
Begriffe wie "Volksgemeinschaft" und die Aufwertung der Landwirtschaft in der NS-Politik spielten eine Rolle bei der Abkehr von früheren industriefreundlichen Urteilen.
Was war der Unterschied zum Urteil von 1932?
1932 lehnte das Reichsgericht Schadensersatzansprüche noch weitgehend ab; 1937 erfolgte ein richtungsweisender Wandel in der Rechtsprechung.
Welche Bedeutung hatte das Preußische Berggesetz?
Neben dem BGB wurden auch spezielle Gesetze wie die Gewerbeordnung und das Berggesetz auf ihre Anwendbarkeit im Immissionsschutz geprüft.
- Citar trabajo
- Helge Kraak (Autor), 2006, Zweite Gutehoffnungshütte-Entscheidung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130355