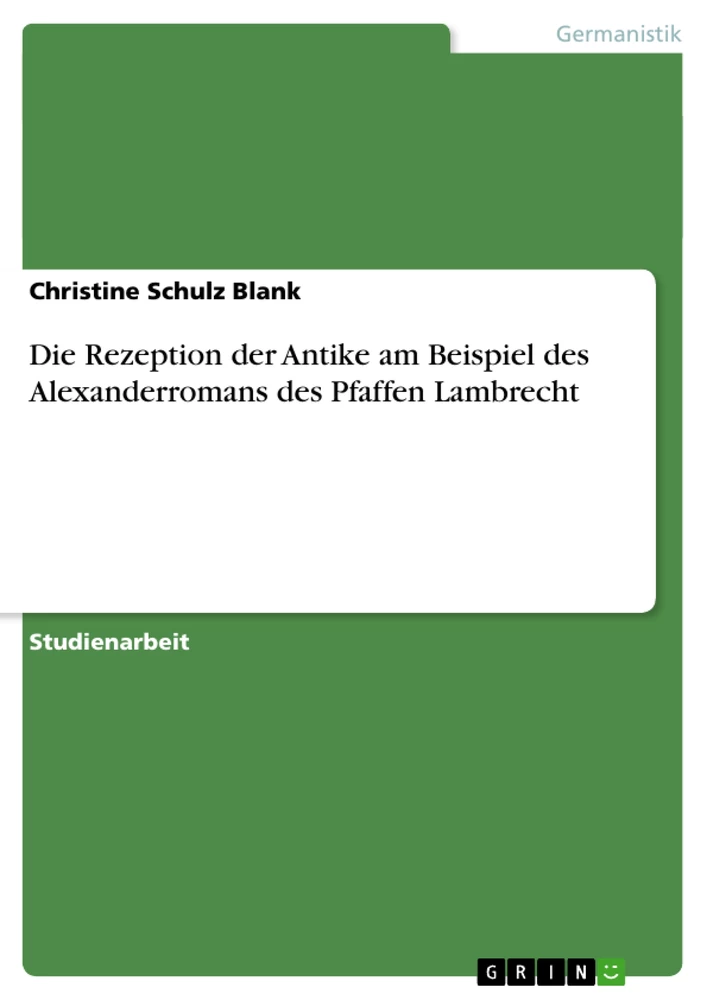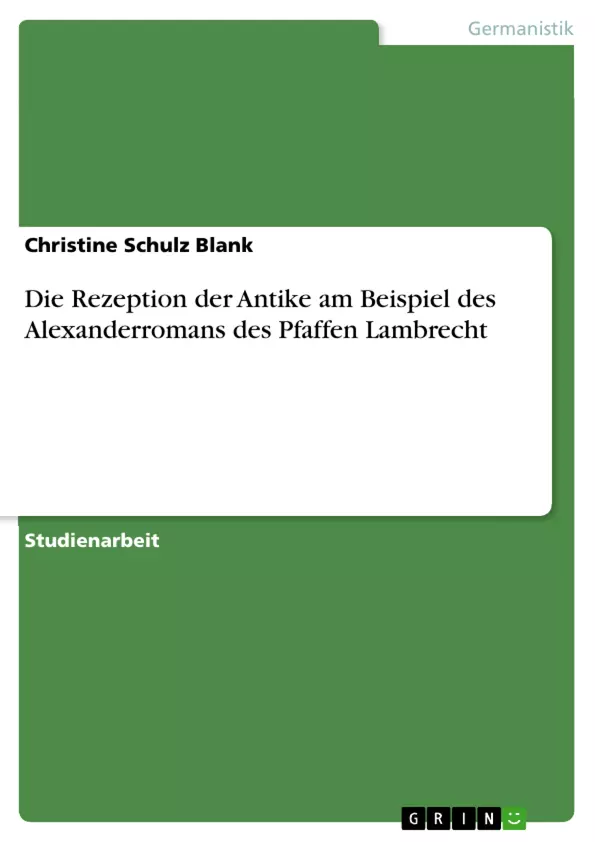Die Geschichte Alexanders des Großen faszinierte und beschäftigte die Menschen von jeher und dies hat sich von der Antike übers Mittelalter bis in unsere heutige Zeit fortgesetzt.Die Gründe für eine solche Popularität sind vielseitig und schon sein historisches Leben war so einmalig, dass es genügend literarischen Stoff bietet. Dies konnte leicht als packende Abenteuer– und Herrschergeschichte dargestellt werden und darüberhinaus war es möglich, die Darstellung Alexanders immer wieder zu verwandelt und zu funktionalisieren, je nach Entstehungszeit, kulturellem Umfeld und Publikumserwartungen. Im 12. Jahrhundert setzte zudem eine Wende in der Literatur ein. Das Interesse fokussierte sich nicht mehr nur auf biblische Stoffe und die Heilsgeschichte, sondern es wurden auch zunehmend „säkulare“ Herrschergeschichten thematisiert. Der Alexanderroman des Pfaffen Lamprecht stellt die erste Heldenepik in dieser Reihe dar. Die Wahl antiker Stoffe war in jener Epoche weit verbreitet, da deren Wahrheitsgehalt nicht bezweifelt wurde und die Antike als Leitbild einer säkularen Kultur diente. „Durch die Erwähnung des Makedonierkönigs in der Bibel“ konnte der Roman Lamprechts „als Brücke zwischen geistlicher und aufkommender weltlicher Literatur“ dienen. Es wird angenommen, dass sein Alexanderroman um 1160 entstanden ist. Als Vorlage benutzte er offensichtlich Alberic de Pisançons «Roman d’Alexandre», außerdem waren ihm wahrscheinlich die antiken Quellen bekannt. Die Originalversion ist allerdings verlorengegangen, weswegen nur anhand von drei verschiedenen Abschriften, den Versionen Vorau, Straßburg und Basel Rückschlüsse auf das Original gemacht werden können. Wie schon erwähnt, wurde die Geschichte Alexanders im Mittelalter aus unterschiedlichen Beweggründen und auf unterschiedliche Weise adaptiert und umgeändert. Allgemein wurden von der Forschung die Art und der Umfang der Antikenrezeption im Mittelalter immer wieder anders gedeutet und dargestellt. Nach Meinung von Rüdiger Schnell hat der Rückgriff auf die Antike „einen Dialog zwischen Antike und Neuzeit“ ermöglicht und „die Anverwandlung und Umwandlung der Antike durch das Mittelalter“ ist „als eine besondere Leistung“ zu betrachten. Im Rahmen der vorliegenden Hausarbeit möchte ich Rüdiger Schnells Auffassung nachgehen und untersuchen, inwiefern diese Transformation und Rezeption im Vorauer und im Straßburger Alexanderroman stattfand.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Die Erziehung Alexanders des Großen
- 3 Das heilsgeschichtliche Exempel
- 4 Die Candacis-Episode
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Transformation und Rezeption der antiken Alexandergeschichte im mittelhochdeutschen Alexanderroman, insbesondere im Vorauer und Straßburger Alexanderroman. Im Fokus steht die Analyse, inwiefern die Adaption der antiken Vorlage den Dialog zwischen Antike und Mittelalter widerspiegelt und welche Bedeutung der Transformation für das Verständnis der mittelalterlichen Kultur zukommt.
- Rezeption der Antike im Mittelalter
- Erziehung Alexanders des Großen im mittelalterlichen Kontext
- Das höfische Ritterideal und seine Darstellung im Alexanderroman
- Die literarische Funktionalisierung der Alexandergeschichte
- Vergleichende Analyse des Vorauer und Straßburger Alexanderromans
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Die Einleitung beleuchtet die anhaltende Faszination für die Geschichte Alexanders des Großen und deren vielfältige Adaptionen im Mittelalter. Sie hebt die besondere Bedeutung des Alexanderromans des Pfaffen Lamprecht hervor, der als erste Heldenepik in einer Zeit zunehmender säkularer Literatur gilt. Die Einleitung skizziert die Forschungslandschaft zur Antikenrezeption im Mittelalter und benennt die vorliegende Arbeit als Untersuchung der Transformation und Rezeption der Alexandergeschichte im Vorauer und Straßburger Alexanderroman, basierend auf Rüdiger Schnells Auffassung eines Dialogs zwischen Antike und Neuzeit. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Darstellung Alexanders Erziehung und seines Verhaltens im Kontext mittelalterlicher Ideale.
2 Die Erziehung Alexanders des Großen: Dieses Kapitel analysiert die nahezu identische Darstellung der Erziehung Alexanders im Vorauer und Straßburger Alexanderroman, wobei die Straßburger Version als Untersuchungsgegenstand dient. Die Erziehung wird in drei Abschnitte gegliedert: einen Überblick über die Lehrer, die detaillierte Beschreibung der einzelnen Lehrer und deren Unterrichtsfächer (entsprechend den septem artes liberales), und schließlich die Betonung der Ritterausbildung. Die Analyse hebt die Gewichtung der Ritterlehre hervor, die im Vergleich zur geistigen Ausbildung stärker betont wird und Alexanders Ausbildung als idealisierten höfischen Herrscher präsentiert. Die Kapitel schliesst mit der Beschreibung Alexanders als "listig, gewaltig und bald", was die Priorität von sapientia und fortitudo im Alexanderroman verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Alexander der Große, Mittelalter, Alexanderroman, Antikenrezeption, mittelhochdeutsche Literatur, höfisches Ritterideal, sapientia et fortitudo, Vorauer Alexanderroman, Straßburger Alexanderroman, literarische Adaption, Transformation.
Häufig gestellte Fragen zum mittelhochdeutschen Alexanderroman
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Transformation und Rezeption der antiken Alexandergeschichte in zwei mittelhochdeutschen Alexanderromanen: dem Vorauer und dem Straßburger Alexanderroman. Im Fokus steht der Dialog zwischen Antike und Mittelalter, der sich in der Adaption der antiken Vorlage widerspiegelt, und die Bedeutung dieser Transformation für das Verständnis mittelalterlicher Kultur.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rezeption der Antike im Mittelalter, die Erziehung Alexanders des Großen im mittelalterlichen Kontext, das höfische Ritterideal und seine Darstellung im Alexanderroman, die literarische Funktionalisierung der Alexandergeschichte und einen vergleichenden Analyse des Vorauer und Straßburger Alexanderromans.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einführung, die die anhaltende Faszination für die Alexandergeschichte und deren Adaptionen im Mittelalter beleuchtet. Es folgt ein Kapitel zur Erziehung Alexanders des Großen, welches die Darstellung in den beiden Romanen vergleicht und die Betonung der Ritterausbildung im Vergleich zur geistigen Ausbildung herausstellt. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung ab.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über die Einleitung, welche die Forschungslandschaft zur Antikenrezeption im Mittelalter skizziert und die Ziele der vorliegenden Arbeit darlegt. Die Zusammenfassung zum Kapitel über die Erziehung Alexanders des Großen beschreibt die Analyse der nahezu identischen Darstellung in beiden Romanen, die Gliederung der Erziehung in drei Abschnitte (Lehrer, Unterrichtsfächer, Ritterausbildung) und die Schlussfolgerung, dass die Ritterlehre stärker betont wird und Alexander als idealisierten höfischen Herrscher präsentiert wird.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Alexander der Große, Mittelalter, Alexanderroman, Antikenrezeption, mittelhochdeutsche Literatur, höfisches Ritterideal, sapientia et fortitudo, Vorauer Alexanderroman, Straßburger Alexanderroman, literarische Adaption, Transformation.
Welche Versionen des Alexanderromans werden verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf den Vorauer und den Straßburger Alexanderroman.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass die Adaption der antiken Alexandergeschichte im mittelhochdeutschen Alexanderroman einen wichtigen Dialog zwischen Antike und Mittelalter widerspiegelt und die Transformation der Geschichte Aufschluss über das Verständnis mittelalterlicher Kultur gibt.
Wie wird die Erziehung Alexanders dargestellt?
Die Erziehung Alexanders wird in den Romanen nahezu identisch dargestellt und gliedert sich in die Darstellung der Lehrer, die Beschreibung der Unterrichtsfächer (septem artes liberales) und die Betonung der Ritterausbildung. Die Ritterausbildung wird stärker gewichtet als die geistige Ausbildung, was Alexanders Darstellung als idealisierten höfischen Herrscher unterstreicht.
- Citation du texte
- Christine Schulz Blank (Auteur), 2009, Die Rezeption der Antike am Beispiel des Alexanderromans des Pfaffen Lambrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130367